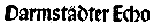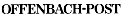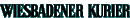|
Was aber frommt Rußland? Fremd steht Modest Mussorgskys "Chowanschtschina" in der Opernlandschaft, monolithisch und unabgeschlossen zugleich. Die Komposition dieses "Volksdramas", das mit einer hoffnungsvollen Morgendämmerung an der Moskwa anhebt, um im infernalischen Licht eines Massenselbstmords zu enden, blieb unvollendet. Bis auf wenige instrumentierte Passagen hat Mussorgsky nur eine Klavierskizze hinterlassen, und selbst diese ist nicht komplett: Es fehlen die Schlüsse zum zweiten wie zum fünften Akt. Wohlmeinende Kollegen, darunter Maurice Ravel, Boris Assafjew und Igor Strawinsky, haben das Fragment postum bearbeitet, sind ihm, wie Rimskij-Korsakow, glättend, entschärfend und großzügig "korrigierend" zu Leibe gerückt oder haben sich, wie Dmitrij Schostakowitsch, Mussorgskys ungeschminktem Klangideal in der Absicht einer möglichst authentischen Rekonstruktion angenähert. Schostakowitschs Orchestrierung macht die Unversöhnlichkeiten einer musikalischen Sprache hörbar, die sich in scharfen Kontrasten und drastischen Schnitten, harmonischen Polarisierungen und auseinanderklaffenden Klängen artikuliert und deren Ausdrucksradikalität gegenüber dem fünf Jahre zuvor komponierten "Boris Godunow" noch gesteigert ist. Sie lag nun der Frankfurter Inszenierung von Christian Pade in Kirill Petrenkos Interpretation mit dem Museumsorchester zugrunde. Wenngleich Mussorgsky auch manche Schroffheit seiner Komposition in einer eigenen Überarbeitung womöglich noch eine Spur verbindlicher gemacht hätte, bleibt doch das Aufeinanderprallen disparater Klangsphären ein zentraler Ausdrucksimpuls seiner letzten Oper, deren Fragmentcharakter sich nicht in Unfertigkeit erschöpft. Hatte Mussorgsky schon für die Verfallsgeschichte des Zaren Godunow ein Ende komponiert, das harmonisch wie metrisch vage bleibt und kaum wirkliche Schlußwirkung entfaltet, so scheint das eigentliche Problem der "Chowanschtschina" weniger in der Vollendbarkeit des letzten Bildes gelegen zu haben als in der Frage, wie ein Schluß kompositorisch verbindlich und zugleich dramatisch offen zu gestalten sei. Denn drastischer noch als in dem Vorgängerwerk geht es in dieser Oper um eine Geschichte ohne Anfang und ohne Ende: um Phasen eines verhängnisvollen Kreislaufs, einen unheilvollen historischen Mechanismus. Das Frankfurter Produktionsteam tat daher gut daran, auf den von Schostakowitsch hinzukomponierten Schluß zu verzichten, der die Morgenstimmung des Anfangs wieder aufgreift, und das Werk statt dessen in der von Strawinsky realisierten Version mit dem pianissimo verlöschenden Gesang jener Altgläubigen ausklingen zu lassen, die den Flammetod wählen, um der Vernichtung durch die Garde Peters des Großen zu entgehen. Thema der Oper sind die politischen und religiösen Wirren vor Peters Thronbesteigung im Jahr 1689. Ein Aufstand der Strelitzen, der einstigen Garde Iwans des Schrecklichen, hatte der Halbschwester des noch minderjährigen Peters, Sofia, die Regentschaft gebracht, während ihr gebildeter, von Reformprojekten erfüllter, jedoch erfolgloser Günstling Golizyn die politischen Geschäfte führte. Gegenmächte waren die von Iwan Chowanski geführten Strelitzen sowie die Raskolniki, eine Sekte von Altgläubigen, die sich gegen die vom Zarenhof unterstützten liturgischen Reformen zusammengeschlossen hatten. Selbstverständlich ging es Mussorgsky nicht um den historisierenden Bilderbogen einer fernen russischen Geschichte, sondern um jenes "Vergangene im Gegenwärtigen", das aufzudecken er als seine zentrale Aufgabe empfand. Konsequenter noch als im "Boris" tritt in "Chowanschtschina" die Kontinuität einer erzählerischen Entwicklung in den Hintergrund. Statt dessen entfaltet sich das Geschehen als Konstellation in Tableaus. Die Modernität dieser Konzeption, die dem Werk bis heute immer wieder als dramaturgische Schwäche ausgelegt wird, ist kühn. Denn um den Preis einer dramatischen Gerichtetheit reflektiert die Form der Oper so exakt ihr Thema: als zermalmendes Kräftegeschiebe disparater Blöcke, dem das russische Volk ohnmächtig ausgeliefert erscheint. Die riesige betongraue Säulenmauer, die Alexander Lintls Bühnenbild beherrscht, liefert dafür ein suggestives Bild. Schemenhaft und zweidimensional erscheint sie zu Beginn, offenbart ihre menschenfeindlich-monumentale Architektur dann zunehmend konturierter, dreht sich, spaltet die Bühne in konkurrierende Lager, spuckt Chormassen aus und saugt sie wieder ein, bricht schließlich in drei Teile, aus denen wiederum nur eine neue Variante desselben steingewordenen Machtgedankens hervorgeht, wenn Peter die Regentschaft übernimmt. Lintls Kostüme, die in den ersten drei Akten noch zeitlos erscheinen, werden im Verlauf der Inszenierung zunehmend konkreter und historischer, als würde sich die Geschichtsspirale zurückdrehen. Die wenig individualisierten Figuren - bis auf die innerlich zerrissene Marfa allesamt nur Repräsentanten von Prinzipien - läßt Pade gelungen isoliert und mitunter beinahe pantomimisch agieren. Seine "Chowanschtschina" überzeugt dennoch nicht überall, weil er dem eingeschlagenen Weg einer darstellerischen Abstraktion nur halbherzig folgt. Mit den Akten mehren sich die Regiemätzchen, irreführend etwa im Bild jener minderjährigen Ballettmäuse, die bei Pade die persischen Tänzerinnen ersetzen. Die so angedeutete Pädophilie Iwan Chowanskis fügt der Figur einen individuellen Zug hinzu, durch den dramaturgisch nichts gewonnen wird. Geradezu lächerlich gerät das die Flammen verweigernde Schlußbild mit einem sich herabsenkenden Riesenregal, das sich als Himmelsgarderobe entpuppt, woran die Altgläubigen ihre gelb gefütterten Mäntel hängen wie das Ölzeug einer kompletten Schiffsmannschaft. Musikalisch gelang die Premiere sehr eindringlich. Petrenko animierte das Orchester zu packendem, kontrastreichem und effektvollem Spiel, wenn auch gelegentlich dynamisch zu monochrom. Elena Cassian sang eine leidenschaftlich glühende Marfa, mit schlankem, dunkel gefärbtem Timbre ohne gutturale Forciertheiten. Simon Bailey war ein geheimnisumwobener Schaklowiti, mit melodiös geführter, betörender Baritonfülle. Anatoli Kotscherga gab rollensicher und etwas chargenhaft den Altgläubigen-Mönch Dosifei, Gregory Frank einen soliden, ein wenig zu blassen Iwan Chowanski, Göran Eliasson einen stimmlich farbigeren Sohn Andrei. Lars Erik Jonsson war ein aalglatter Golyzin und Hans-Jürgen Lazar ein gelungen kurzatmiger, lyrischer Schreiber. Fabelhaft präsent, artikuliert und durchdringend agierten die von Alessandro Zuppardo vorbereiteten Chöre. JULIA SPINOLA |
|
Die Mächtigen streiten, und das Volk leidet VON HANS-KLAUS JUNGHEINRICH Ach ja, Russland. Die größten Gefühlsmusiker kamen von da. Aber auch Modest Mussorgskij, der vielleicht ein Realist war, aber mit mystischer Beziehung zum "Volk", jener merkwürdigen, fast irrealen Größe, die sich so schwer individualisiert, dafür leicht dem empathischen Blick erschließt als bewegliche, bewegende Kollektivseele: als Massenopfer der Erniedrigung und Beleidigung wie als Subjekt geheimnisvoller Auferstehung. Wie das geknechtete "Volk" inbrünstig den Führer, den Erlöser ersehnt, so erwarten mystagogische Narodniki (oder solche, die sich dafür ausgeben) die Wahrheit, Echtheit, Ganzheit vom Kraft- und Gärstoff "Volk", der unberührt scheint von jenen Zerrissenheiten, denen die gebildeten, kultivierten Wenigen ausgesetzt sind. Gleichwohl weiß auch Mussorgskij, wie manipulierbar das Volk ist. Es hat ja keine Chance. So hat Russland keine Chance. Gegenentwurf zu Wagner Wer könnte an der Aktualität der bitteren, ausweglosen Musikdramatik Mussorgskijs da noch zweifeln? Diese war wohl einer der ernsthaftesten Gegenentwürfe zu Richard Wagners gleichzeitigen mythologisch-kunstreligiösen Allegorien. Boris Godunow, überbordend polymorph als Geschichtspanorama, geriet zum russischen Volksdrama par excellence, weit oberhalb von jeglichem "Nationalopern"-Nimbus. Mit einem zweiten, ähnlich groß dimensionierten Werk - Chowanschtschina - spannte Mussorgskij einen ebenso weiten Bogen zwischen privaten Einzelschicksalen, politisch-religiösen Machtgruppierungen und hin- und hergeschleuderten Kollektiven; das Werk blieb unvollendet. Ein drittes geschichtsdeutendes Vorhaben über den Pugatschew-Kosakenaufstand 1773/74 kam nicht mehr zustande. Der Komponist war, schwer depressiv und alkoholabhängig, 1881 mit 42 Jahren gestorben. Der Professionellste und Disziplinierteste aus dem Freundeskreis der nationalrussischen "Novatoren", Nikolaj Rimskij-Korssakow, legte Hand an seine Partituren und brachte auch für Chowanschtschina eine aufführungspraktische Fertigstellung zustande. Eine immense Freundschaftstat. Doch dieses philologisch unbedenkliche "Weiterkomponieren" befriedigte spätere Generationen nicht. Fast 20 Jahre beschäftigte sich Schostakowitsch mit einer stärker auf die Kruditäten Mussorgskijs eingehenden Chowanschtschina-Version. Aber auch er gestattete sich mit einem neu "erfundenen" Finale zu weiten tondichterischen Auslauf. Die nun in der Frankfurter Aufführungsgestalt benutzte Strawinsky-Schlusslösung (entstanden 1913 für die Pariser Diaghilew-Crew) schloss sich diskreter an die vorangegangene Schostakowitsch-Instrumentierung an. Sie verwies auf einen schmucklosen Lakonismus, wie er in Schostakowitschs Klangbild (von Mussorgskijs Hand ist kaum mehr als ein Klavierauszug überliefert) nicht immer realisiert worden war. Chowanschtschina (frei übersetzt etwa: "die Umtriebe der Fürsten Chowanski") gilt als ein dramaturgisch krauses Stück mit verwirrenden Handlungszügen. Es behandelt einen geschichtlichen Zeitraum im 17. Jahrhundert, der von nahezu anarchischen Machtkämpfen des Adels und religiöser Gruppierungen geprägt war. Eine Sonderrolle spielen die "Strelizen", eine von Zar Iwan gegründete Miliz, die dann, als freikorpsartige Schlägertruppe von den Fürsten in Dienst genommen, sich verselbständigte und schließlich von Zar Peter brutal liquidiert wurde. Eine dem ideologischen Zentralismus feindlich gegenüberstehende Organisation sind aber auch die sektiererhaft-fundamentalistischen "Altgläubigen", mit deren gemeinschaftlicher Selbstverbrennung die Oper endet. Sodann versuchen die Lutheraner, in Russland Fuß zu fassen (Mussorgskij skizziert ihren Pastor ähnlich spitzig-idiosynkratisch wie den Jesuiten Rangoni in Boris Godunow). Auch die Fürsten sind untereinander zerstritten; ebenso wie der bärenhafte Warlord Iwan Chowanski (er wird in seinem eigenen Haus ermordet) scheitert der Fürst Golizyn, der in die Verbannung geschickt wird (in Frankfurt baumelt er an einem Strick dem Schnürboden entgegen). Integriert in die politischen Vorgänge ist die unglückliche Liebesepisode der altgläubigen Marfa zu dem jungen Fürsten Andrej Chowanski, der seinerseits erfolglos der Lutheranerin Emma nachstellt. Am Ende treffen sich Marfa und Andrej am Scheiterhaufen wieder, und es verbindet sich dann mit dem heroischen Spektakel eine romantische Konstellation, die ein wenig an das Aida-Finale erinnert (Andrej als Melange aus Radames und Amneris). Das vermeintlich Opake der Handlung entspricht der Chaotik einer Geschichtsbetrachtung, die sich nicht zu falschen Vereinfachungen verstehen will. Mussorgskijs holistische Konzeption mag eine dramaturgische Schwäche implizieren; zugleich willfährt sie der utopischen Unbedingtheit, aus dem historischen Material gültige "Wahrheit" zu destillieren. Als neutraler Beobachter fühlt sich der Komponist (hier auch sein eigener Textautor) gleichwohl nicht; seine Sympathien für die Altgläubigen sind ebenso deutlich wie die für den "Schreiber", den Gottesnarren in der Maske des Intellektuellen; vor allem aber zeigen sie sich in der lyrischen Bedachtsamkeit und leisen Unbeirrbarkeit, mit denen er die große Liebende Marfa lebendig werden lässt. Und nicht zuletzt in der Wucht der Chöre, die dem Geschehen erst das Relief eines "Volksdramas" verleihen. Es gehört zu den Qualitäten einer mystischen "Volksverbundenheit", dass Mussorgskij die Menge der einfachen Menschen auch in ihren grausamen und schwankenden Äußerungen niemals von oben herab denunziert. Ein Hauch von Tschechow Falsch verstanden wäre der Wurf der Chowanschtschina, würde er in einer historisierenden Kostüm- und Ausstattungsorgie landen. Nichts davon bei Christian Pades sorgfältiger, nachdenklicher, schrille Effekte meidender Frankfurter Inszenierung. Merklich modernisiert die von Alexander Lintl gebauten Räume mit stufigen und durchbrochenen Wandflächen, sinnfälligen Zeichen einer bizarren Imponier-Architektur. Auch in den vielfachen Uniformierungen Anspielungen auf (durchaus aktuelle) militarisierte Realität. Ein Hauch von Tschechow im Hause Chowanski (4. Akt, 1.Bild): Der Fürst langweilt sich bei Wodka und kindlich-kläglichen Tanzversuchen vorpubertärer Sklavinnen (zu den stilisierten "Perserinnen"-Ballettklängen). Ohne funebren Pomp die Schlussszene mit wie Flammen(seelen) an einem Gerüst nach oben schwebenden gelben Altgläubigen-Obergewändern. Geschichte und Gegenwart, ineinander verwirkt in einer spannungsvollen Bühnenerzählung. Bewundernswert suggestiv formte der Dirigent Kirill Petrenko die musikalischen Ereignisse auf der Basis einer gleichsam unangestrengt lyrischen Diktion, aus der sich umso triftiger Akzente und Steigerungen heraushoben. Ebenso wie der von Alessandro Zuppardo minuziös einstudierte Chor leistete das Orchester Wunder an Differenzierung, an subtilen, oft geradezu impressionistischen Valeurs. Ungeachtet der russischen Originalsprache durchweg souveräne Gesangsleistungen. Gregory Frank war ein machtvoll präsenter Iwan Chowanski, Elena Cassian eine in schönster Tongebung in sich ruhende Marfa, Simon Bailey ein charismatisch-grandioser Dosifei, Göran Eliasson und Lars Erik Jonsson (Andrej und Golizyn) waren die leuchtkräftigen Tenöre. [ document info ] Dokument erstellt am 28.03.2005 um 17:28:21 Uhr Erscheinungsdatum 29.03.2005 |
|
Die Welt ist nicht zu retten Von Michael Dellith Der Pessimismus zweier Männer hat sich in dieser gewaltigen Regiearbeit gleichsam potenziert: die pessimistische Weltsicht des russischen Komponisten Mussorgski, der mit 42 Jahren im März 1881 starb, von Depressionen und Alkoholismus gezeichnet, so dass er seine Oper "Chowanschtschina" über den Aufstand des konservativen Armeekorps der Strelitzen gegen den westlich orientierten Zaren Peter den Großen nicht mehr vollenden konnte – und der Pessimismus des Regisseurs Christian Pade, der Mussorgskis ausladendes musikalisches Historiengemälde auf der Frankfurter Bühne, wo schon 1924 die deutsche Erstaufführung dieser Oper gegeben wurde, in düsteren Tableaus entfaltet. Pade entschied sich für die Fassung von Schostakowitsch, kombiniert mit dem Finale Strawinskys, was die deprimierende Wirkung der Oper noch verstärkt. Komponist und Regisseur lassen keinen Zweifel: Die Welt ist nicht zu retten. "Chowanschtschina" ist eine politische Oper. Die Nachsilbe "schina" im Titel bedeutet so viel wie "Schweinerei" oder "Schurkerei" und zielt auf die chaotischen Machtverhältnisse im Russland des ausgehenden 17. Jahrhunderts: Da sind die Anhänger des Zaren, die dem westlichen Fortschrittsglauben huldigen, auf der anderen Seite die heruntergekommene Garde der Strelitzen, die ihre Situation nur noch im Suff ertragen können, und schließlich die religiösen Fundamentalisten in der Gruppe der Altgläubigen, die jede Veränderung der Tradition als Gottlosigkeit geißeln und am Ende den kollektiven Freitod wählen. Und alle drei Kollektive haben ihren Anführer, die sich in der zentralen Szene der Oper im zweiten Akt der entscheidenden Frage stellen müssen: "Wo ist Russlands Untergang und wo Russlands Rettung zu suchen? Die Antwort bleiben die Fürsten Golizyn, Chowanski und Dosifej schuldig. Für Pade sind diese Fragen nicht nur symptomatisch für das Russland des 17. Jahrhunderts, sie durchziehen die ganze Menschheitsgeschichte – bis heute. Alexander Lintl, der zusammen mit Pade in Frankfurt bereits Brittens "Turn of the Screw" zwingend inszenierte, hat auch für die Mussorgski-Oper ein raffiniertes Bühnenbild entworfen: eine äußerst bedrohlich wirkende teil- und wandelbare Säulenwand, die an die Architektur im faschistisch-totalitären Europa des 20. Jahrhunderts erinnert, ein Bollwerk der Macht mit variablen Durchlässen für die zahlreichen von Pade sehr differenziert behandelten Massenszenen. Das erste Lob auf musikalischer Seite gebührt denn auch dem von Alessandro Zuppardo fabelhaft einstudierten Opernchor, der sängerisch wie darstellerisch äußert flexibel agierte und durch den exquisiten Kinderchor ergänzt wurde. Die große Partie der Altgläubigen Marfa füllte Elena Cassian mit ihrem lodernden Alt, den sie aber auch ganz lyrisch einzufärben verstand. Prachtvoll besetzt waren zudem die männlichen Hauptrollen mit Gregory Frank als Fürst Iwan Chowanski, Göran Eliasson als dessen Sohn Andrej und Lars Erik Jonsson als Fürst Golizyn. Als feinsinnige Charakterdarsteller erwiesen sich Simon Bailey (Bojar Schaklowiti), Hans-Jürgen Lazar (Schreiber) und Ann-Marie Backlund (Emma). Hochachtung verdienen nicht zuletzt der russische Dirigent Kirill Petrenko und das Frankfurter Museumsorchester. Hier wurde nichts geglättet, nichts geschönt, doch bei aller Drastik des Ausdrucks behielt die Musik stets eine kantable Note, blieb im Sinne Mussorgskis "menschliche Rede". Am Ende gab es enthusiastischen Beifall für einen langen, aber lohnenden Abend. |
|
Verführer und Verführte Von Johannes Breckner FRANKFURT. Fürst Iwan Chowanski ist am Ende. Die Herrschaft seiner Strelitzentruppe zerbricht, eine politische Lösung ist ebenso wenig in Sicht wie eine durch Gewalt herbeigeführte. Der Mann hockt auf seinem Landsitz, und im Schein einer Lampe, von der ein Mordopfer herabbaumelt, lässt er Kinder für sich tanzen und sich von kleinen Mädchen anhimmeln. So zeigt der Regisseur Christian Pade das Ballett zu Beginn des dritten Aktes von „Chowanschtschina" als starkes Bild zerbrechender Macht im Zwielicht von Größe und Untergang. Modest Mussorgskis Oper ist selten zu sehen und zu hören. Das mag an der Geschichte liegen, die keine zwingende Handlung erzählt, sondern einen Wendepunkt russischer Geschichte als Bilderbogen ausbreitet, in dem widerstrebende politische Kräfte sich kaum in jener privaten Gefühlsebene bündeln, wie es die Oper sonst verlangt. Die Politik selbst ist das Drama, und dass Mussorgski nicht nur die Geschichte aus dem 17. Jahrhundert meinte, merkte auch die zaristische Zensur, als das Werk 1883, zwei Jahre nach dem Tod des Komponisten, nur mit erheblichen Kürzungen erscheinen durfte. Wie zeitlos die Kämpfe um Herrschaft und Glauben, um Widerstand und Anpassung, um Revolution und Machterhalt zumal im Licht des 20. Jahrhunderts sind, arbeitet Pades Inszenierung am Frankfurter Opernhaus beispielhaft heraus. Der Regisseur verzichtet darauf, der viereinviertelstündigen Aufführung aktionistische Kurzweil aufzuzwingen. Und er ist klug genug, nicht allen historischen Verästelungen des Textes nachzugrübeln. Aber er entwirft eine in sich schlüssige Folge dramatischer Bilder – von der Schreckensherrschaft der Strelitzen, die im ersten Akt die Menschen in Moskau niederdrückt, bis zum gemeinsamen Selbstmord der Altgläubigen im Finale, die ihre Selbstverbrennung als Zeichen deuten wollen, weil sie ja auch keine andere Alternative haben. Die „Chowanschtschina", die Machenschaften der Familie Chowanski und ihrer Truppen, sind allenfalls ein lockerer roter Faden, der diese Studien des politischen Machtkampfes aneinander knüpft. Man sieht einen Reigen von Verführern und Verführten: Verdacht, Verrat und Gewinnstreben regieren, heißt es in der Szene beim Fürsten Golizyn, der mit der Schreckensherrschaft paktiert, so lange es seinen Interessen dient – Lars Erik Jonsson porträtiert ihn als Polit-Opportunisten, der seiner Gewissenlosigkeit zum Opfer fällt. Auch der Mönch Dosifej, den Anatoli Kotscherga mit mächtigem Bass ausstattet, ist nicht nur charismatischer Anführer der Altgläubigen, sondern verfolgt handfeste Machtinteressen. So beweglich wie die Blöcke der Macht sind auch die monumentalen Bauteile von Alexander Lintls Bühne, die auch als Postamt-Fassade im Mussolini-Stil durchgehen würde. Mit ihren so einfachen wie bezwingenden Raumlösungen passt sie vorzüglich zu dieser Inszenierung, die ja eher auf bildmächtige Vereinfachung zielt als auf historische Detaildeutung. Dass dies über die lange Dauer der Aufführung spannend gelingt, spricht für die Kraft dieser Bildeinfälle. Vor allem aber lässt dieses Konzept Raum für Mussorgskis beredte Musik und die psychologische Schärfe ihrer dramatischen Entwürfe. Nicht zuletzt das Frankfurter Opernhaus- und Museumsorchester sorgt für die spektakuläre Größe dieser vom Premierenpublikum umjubelten Aufführung: Der Dirigent Kirill Petrenko ist ein sicherer Konstrukteur sinnlicher Klangräume, dem zarte Farben ebenso gelingen wie die großen Massenszenen mit den starken Chören (Alessandro Zuppardo). Zudem sind es die Sänger, die auf durchweg hohem Niveau diesen abstrakten Bildern die notwendige menschliche Konturenschärfe geben – Gregory Frank als kraftstrotzender Iwan Chowanski, Göran Eliasson in der Rolle des Sohnes Andrej, dem die hoffnungslose Liebe zu Emma (Ann-Marie Backlund) wichtiger ist als jedes politische Kalkül. Die stärksten Auftritte hat Elena Cassian, deren intensiv dunkle Stimmfärbung die Figur der Marfa in den Mittelpunkt rückt. Bis in kleinere Rollen reichen die starken Leistungen, die in ihrer Summe einen großen Opernabend ausmachen. |
|
Monumentale russische Passion
Allein fünf, teilweise hart in die Pflicht genommene Tenöre und einen Chor der Sonderklasse verlangt der Besetzungszettel: Mit Modest P. Mussorgskis "Chowanschtschina" in der Fassung von Schostakowitsch (mit dem Finale Strawinskys) hatte sich die Oper Frankfurt wieder einmal gesanglich auf ein aufwändiges Unternehmen eingelassen. Und schon zur Premiere am Sonntagabend verblüffte, was das Ensemble so alles hergibt, hier von Gastsängern auch russischen Idioms ergänzt. Großer Jubel am Ende für eine monumentale Opern-Passion, die der Wahl-Berliner Kirill Petrenko im bedächtigen hymnischen Fluss hielt. Beifall auch für den jungen Regisseur Christian Pade und seine Szenen um Glaube, Liebe und grausamen Tod. Trotz deutscher Übertitel sollte man sich bei der russisch gesungenen Volksoper vorab mit der Fülle an Personal vertraut machen, die an Pasternaks Romane gemahnt. Immerhin sind hier die Machtkämpfe aus fünfzig Jahren russischer Geschichte des 17. Jahrhunderts auf dreieinhalb Opern-Stunden komprimiert - und individuelles Leid wird nicht ausgespart. Denn Mütterchen Russland darbt an vielen Wunden. Wobei es müßig ist, nach den Guten in diesen mörderischen Ränkespielen zu suchen - jeder hat Dreck am Stecken. Gegensätze sind der westlich orientierte Fürst und die auf russische Tradition pochenden Altgläubigen. Mittendrin stehen die grausamen Strelitzen, ehemals mächtige Schützenregimenter. Und dann gibt es eine Art Herrscher ex Machina, Zar Peter den Großen, zwar nicht auf der Bühne präsent, doch das blutige Spiel befördernd: Den gen Westen schielenden Fürsten schickt er in die Wüste, lässt den Strelitzenführer ermorden und zwingt letztlich die Altgläubigen zu kollektiver Selbstverbrennung. Zwar wartet Christian Pade mit einprägsam choreografierten Massenszenen auf, doch scheint er etwas unschlüssig zwischen russischem Naturalismus und schwer deutbarem abstrakten Überbau. Doch gelingen ihm vor und innerhalb einer hermetisch wirkenden, trutzigen Mauer (Ausstattung und Kostüme: Alexander Lintl), die sich aufklappen lässt, wie sie im Volksaufschrei oder gläubigen Furor auch zu kippen droht, an wichtigen Spielstationen zwingende Szenen. Bürgerkriegselend zur musikalischen "Morgenstimmung": Neben einem mit blutigen Händen versehenen Pendel haust der Schreiber (Hans-Jürgen Lazar mit viel Leidensdruck in hoher Stimme) in einer Kartonage, als Büttel von Machthabern und marodierenden Soldaten geschurigelt. Halb öffnet sich die Mauer, wenn der noch regierende Fürst Golizyn (Lars Erik Jonsson mit kraftvoll zupackendem und auch heuchlerisch lockendem Tenor) seine gefährlichen Gegner aus Militär und Klerus empfängt, der Kreml mit Büsten geziert, die den noch historisch fernen Selbstdarsteller-Kult zu karikieren scheinen. Überhaupt klingt die Gegenwart an. Zumindest die des Bearbeiters Schostakowitsch: Die Schergen des Zaren sind wie Stalins Rotarmisten uniformiert. Schwierig zu deuten dagegen jene Hand, die das Heil in Form eines mächtigen Pfeils auf Altgläubige herunter schleudert. Letztere reißen die an ihn befestigten Mosaiksteine herunter - vielleicht Bilderstürmer besonderer Art. Der schnelle Wechsel von pittoresker russischer Ansicht zur beklemmenden Realität bestimmt nicht nur den Chor der von Frauen mit Putzeimern bedrängten Soldateska, sondern vor allem die Szene auf dem Landgut des Strelitzenfürsts Iwan Chowanski, der sich im Nähstuben-Ambiente von jungen Ballettmädchen umgarnen lässt - und dann auch von solch einer Kindfrau erstochen, vom Rest sogar im Tod noch bespuckt wird. Das bedarf ebenso keiner Erklärung wie der schlussendliche Marsch jener religiösen Sektierer ins reinigende Feuer. Die Bahnhofsmauern werden zum Himmelsportal. Während die Gläubigen ihre feuergelben Mäntel den Fächern eines Regals überlassen, das noch oben verschwindet und sich zur ewigen Ruhe niederlegen, verlöschen im Vordergrund nicht nur die Kerzen, auch die Musik (mit Bezug auf "Morgenstimmung") verhaucht langsam. Sie ist natürlich bei dem agilen Kirill Petrenko, Generalmusikdirektor an der Komischen Oper Berlin, in besten Händen. Ein Spiel auf vielen klanglichen Ebenen, ein permanenter Trauermarsch mit Anleihen bei russischem Volkston und modaler Kirchenmusik, bei üppigen Volksliedgut, aber auch von einer Realistik, die schaudern macht. Mit dem ganz breiten Pinsel malt Petrenko diesen manchmal sogar recht zäh fließenden Klang, den seelischen Druck noch verstärkend, der hier aufgebaut wird. Man muss schon Russe sein, um sich ihm ebenso intensiv hinzugeben. Mussorgski hatte nur einen Klavierauszug der Oper hinterlassen, die Fassung von Schostakowitsch betont zudem die Modernität des Romantikers an Stellen wundersamen harmonischen Zerfließens, als wäre klangliches Lametta angelegt, aber auch wenn sich der Druck in sperrigen Bläser-Attacken entlädt oder die Tieftöner samt Kesselpauker russisch-rau das Gruseln lehren - wahrlich ein großer Tag des Museumsorchesters wie des von Alessandro Zuppardo einstudierten Chores. Der singt nicht nur samt Kinderchor hymnisch rein, sondern agiert auch schneidend scharf und manchmal sogar in grotesker Häme. Etwa bei Iwan Chowanski, selbst in Todesangst noch überheblich: Gregory Franks trifft das ideal mit seinem elastischen Bariton. Und wenn die Furcht förmlich greifbar wird, setzt der Frauenchor das milde volkstümliche Lied noch unter massiven dynamischen Druck. Bei einem Russen laufen all diese emotionalen Stränge zusammen: Der Bassist Anatoli Kotscherga durchlebt so stark seine Rolle des gebrochenen Religionsführers, dass die Stimme intonatorisch leicht flackert. Ohne Zweifel ist Elena Cassian als Marfa die starke Frau im inneren Zirkel: Ihre Liebe zum Chowanski-Sohn Andrei (Göran Eliasson) unerfüllt, der eine andere, Emma (Anne Marie-Backlund) wie rasend begehrt. Frau Cassians Mezzo ist wahrlich eine Macht, prädestiniert für die vielen Facetten dieser Tragödinnenrolle. Dem nicht unerheblichen Rest des Ensembles gebührt ein Sammellob. Mussorgski in Frankfurt: Da muss es nicht der viel zitierte "Boris Godunow" sein. Lieber die rare "Chowanschtschina". Und mit diesem Neugierde schürenden Konzept liegt die Oper am Willy-Brandt-Platz wieder einmal richtig. KLAUS ACKERMANN |
|
Premiere von Modest Mussorgskys "Chowanschtschina" in Frankfurt Von Axel Zibulski
Der erste Mord geschieht schon während der pittoresken Ouvertüre, überhaupt wird viel gestorben auf der großen historischen Bühne, aber auch gebetet, getrunken, um die Macht intrigiert. Ähnlich wie in seiner bekanntesten Oper "Boris Godunow" konzentrierte sich Modest Mussorgsky in "Chowanschtschina" auf eine Umbruchssituation in der russischen Geschichte, als Ende des 17. Jahrhunderts die Anhänger Peters des Großen ihre Macht sicherten. An der Oper Frankfurt ist jetzt zu erleben, wie Mussorgsky in epischer Breite das Geschehen schildert. Der so sperrige Titel der Oper verweist auf den Fürsten Chowanski, der als Anführer der Strelitzen eines vorgeblichen Staatsstreichs gegen den Zaren bezichtigt wird. Er überlebt die Oper ebenso wenig wie die Schar der russischen Altgläubigen, die am Ende in einem kollektiven Suizid die Selbstverbrennung suchen. Unter dem Eindruck der Frankfurter Premiere ahnt man, warum das Werk so selten aufgeführt wird. Einschließlich zweier Pausen dauert die Aufführung stolze viereinhalb Stunden, die über weite Strecken oratorisch wirken. Selbst ein großes Haus wie die Oper Frankfurt wird dabei an die Grenzen des Möglichen geführt: Nur ein so exzellenter Chor, wie er dort derzeit zur Verfügung steht, dürfte den hohen Ansprüchen der zahlreichen Volksszenen Mussorgskys gewachsen sein. Dabei wächst dieses von Alessandro Zuppardo und Pablo Assante einstudierte Ensemble aus Chor, Extra-Chor und Kinderchor mit nie nachlassender Genauigkeit und tönender Fülle noch über sich hinaus - einer der so vielen starken Eindrücke von der musikalischen Umsetzung dieser "Chowanschtschina". Denn auch das Frankfurter Museumsorchester spielt unter der Leitung von Gastdirigent Kirill Petrenko exzellent, farbenreich und selbst bei der Nachahmung wuchtiger Glockenschläge niemals bloß plakativ. Zu hören ist im wesentlichen Schostakowitschs Orchestrierung des "Volksdramas", das Mussorgsky nur im Klavierauszug vollenden konnte. Einzig für den finalen Flammentod greift man auf Igor Strawinkys ätherische Instrumentierung zurück. Aus dem Solisten-Ensemble ragt Anatoli Kotscherga mit tiefschwarzem, vollem Bass als Anführer der Altgläubigen heraus, Gregory Frank ist ein konditionsstarker Fürst Iwan Chowansky, die Altgläubige Marfa, zentrale Frauengestalt der Oper, wird von Elena Cassian mit viel Kraft und glühender Intensität gegeben. Auch die zahlreichen anderen Partien sind durchweg solide besetzt. So fällt es auch kaum ins Gewicht, dass Christian Pades Regie das epische Musikdrama eher dienend unterstützt. Auf der Drehbühne, für deren Ausstattung Alexander Lintl ebenso verantwortlich ist wie für die historisch gehaltenen Kostüme, gelingen die Massenauftritte des Chores nahtlos. Ein blutiger Handabdruck auf der Wand, eine umfallende Büste, herumgereichte Wodkaflaschen sind atmosphärisch passende Accessoires. Diese "Chowanschtschina" überzeugt vor allem musikalisch - und das bedeutet bei einem so aufwändigen Werk eine ganze Menge. |
|
Suggestive Symbolik "Chowanschtschina" in der Oper Frankfurt Von Markus Häfner Auf den ersten Blick scheint es so, als versuche der junge Regisseur Christian Pade hier die Quadratur des Kreises: Sorgsam angepflanzte Grashalme hier, fein modellierte Treppchen und Büsten dort. Detailverliebte Kostüme der Arbeiter, Aristokraten, Soldaten oder Religionsfanatiker. Dem aber steht ein geometrisch-abstraktes Bühnenbild (Alexander Lintl) gegenüber, das mit hochdosierter Symbolik eine visuelle Ausdeutung von so schwierigen Begriffsinhalten wie "Macht", "Isolation", "Despotismus" oder "Orthodoxie" unternimmt. Schnell wird deutlich, dass es kein Widerspruch sein muss, auf der Bühne Realismus und Symbolik, Detailbezug und Abstraktion zu kombinieren. Mehr noch: Christian Pades Frankfurter Inszenierung von Modest Mussorgskis "Chowanschtschina" wirkt im Ganzen derart suggestiv und in sich geschlossen, dass sie all jene Stimmen Lügen straft, die das unvollendet gebliebene Werk als "dramaturgisch zusammenhanglos" etikettieren. Die politische Handlung und nicht etwa die Liebesgeschichte steht hier einmal ganz im Vordergrund eines Bühnenwerks, mit dem Mussorgski eine nationalkritische, bis zum heutigen Russland unter Putin brandaktuell wirkende Gesellschaftsanalyse geschaffen hat. Schostakowitschs Instrumentation des Klavierauszugs erschien Norbert Abels (Dramaturgie) und dem Generalmusikdirektor der komischen Oper Berlin, Kirill Petrenko, als die werkgerechteste Spielfassung, mit deren insgesamt sehr dunkel gefärbter Klangwelt die von schwarz-grauen Farben dominierte Bühne ideal korreliert. Petrenko hat das Frankfurter Museumsorchester so hervorragend eingestellt wie Alessandro Zuppardo den Chor, der als passiv-erduldendes Volk in "Chowanschtschina" eine zentrale Rolle spielt. Beide sind hervorragend aufeinander abgestimmt: in blitzschnellen Crescendi, homogenen Tonabschlüssen, variantenreicher Artikulation, dem nötigen "Drive" in breit dahinströmenden Passagen und mit fein gesponnener Dynamik in den Gebetsszenen. Großartig das Solistenensemble: Mit der verführerischen Mischung aus dämonisch angeschliffenen Tönen und sympathisch-leuchtkräftiger Bassstimme singt Anatoli Kotscherga den Sektenführer "Dosifei". Raumgreifend präsent und ungemein wandlungsfähig in Dynamik und Stimmfarbe: Elena Cassians "Marfa". Gregory Frank, Göran Eliasson und Lars Erik Jonsson bewegen sich ebenfalls so souverän über ihren Partien, dass sie Mussorgskis Idee eines Parlando-Vokalstils bis in kleinste emotionale Schattierungen lebendig verwirklichen. |
|
Triumph der Musik über das Drama Von Götz Thieme Im Ephemeren der Oper, der Vergänglichkeit einer Aufführung, sind Heil und Trauer verschwistert. Im Misslungenen liegt die Chance der Wiedergutmachung durch Wiederholung - dem gelungenen Augenblick ist die Trauer um die Vergänglichkeit, Unwiederholbarkeit des lebendigen Kunstwerks eingeschrieben. Zwischen diesen Polen bewegt sich die zarte Kunstform Oper, die oftmals mit brachialen Bild- und Musikmitteln die Zuhörenden und Zuschauenden bezwingt. Am Ende bleibt der Nachklang der Musik, das Zittern eines Sekundintervalls, der Schauer eines A-capella-Chores, das Orgeln einer Bassstimme. So geschehen an der Oper Frankfurt, die zu Ostern mal nicht Wagners "Parsifal" ansetzte, sondern das russische religiöse Gegenstück, Modest Mussorgskis unvollendetes Volksdrama "Chowanschtschina", fragmentarisch nur überliefert in der Finalszene. Kirill Petrenko, der gastierende Generalmusikdirektor der Komischen Oper Berlin, wählte die aufgeraute Schostakowitsch-Instrumentation und für den Schluss, die Selbstverbrennung der Altgläubigen, Igor Strawinskys Rekonstruktion. Der russische Dirigent überbrückte mit seiner spannungsvollen, weiträumigen Interpretation der Partitur, die vom Frankfurter Museumsorchester klangmächtig umgesetzt wurde, die verwickelten Handlungsstationen, verkürzte das lange Werk zum verdichteten Drama. Petrenkos Stärke ist der Sinn für das Lyrische, den verhauchten Ton - dieser ernste, stille Dirigent sieht einer große Karriere entgegen. Der Regisseur Christian Pade hielt sich mit scharf gezeichneten Tableaus, und davon gibt es in diesem Fünfakter viele, zurück. Er setzte auf die Doppeldrehbühne eine Art schwarz-mächtiges Stauwehr, das durch Verschwenken und Teilung wechselnde Räume ergab. Dem aktualitätsträchtigen Plot - die Adelsintrigen der Bojaren und Strelitzen, religiöse Eiferer, die verfolgt, freiwillig in den Tod gehen - verweigert Pade die Bildermacht heutiger TV-Realität, von der viele Regisseure sich hätten versuchen lassen. Der Regisseur setzt auf die Binnenbeziehungen der Handelnden, sucht das Kammerdrama der Blicke und Gesten, geht dem Genrehaften aus dem Weg - und tappt dabei gelegentlich in die Originalitätsfalle, etwa beim Attentatstod des Rädelsführer Iwan Chowanski. Der Tanz der persischen Sklavinnen, einigermaßen bekannt geworden durch Promenadenkonzerte, wird bei Pade zu einer etwas bizarren Nummer mit pädophilem Hautgout: Mädchen in Ballettröckchen necken den Hünen, sein Ende bereitet ihm eine der Zehnjährigen mit blitzesschnell gezücktem Taschenmesser. Das mag nicht mal der Darsteller, Gregory Frank, so recht glauben und plumpst ein wenig verlegen darnieder. Getragen wird der Abend durch das Sängerensemble und den Chor, eine der großen Qualitäten von Bernd Loebes Intendanz. Seine Stars sind die Marfa der glutäugigen Elena Cassian mit schwerer, aber beweglicher Altstimme sowie der ukrainische Bassveteran Anatoli Kotscherga, dem im letzten Akt zwar die Schaljapin-Stimme, aber nicht die pathosgeliehene Miene abhanden kommt. Eindrucksvoll Lars Erik Jonssons Golizyn, eine Charakterstudie mit schöner Tenorfarbe. |
|
Mussorgskis Oper "Chowanschtschina" als Oster-Event Gebrochene Schönheitssehnsucht Von Frieder Reininghaus Heute vor 124 Jahren starb der russische Komponist Modest Mussorgskis - ein Opfer des Alkoholismus. Die meisten seiner Werke waren unvollendet; sein Freund Rimski-Korsakoff hat sie später nachbearbeitet. In Frankfurt hat jetzt Christian Pade "Chowantschina" neu inszeniert. Wie wird heute mit großen Historien-Opern verfahren? Zumal, wenn keine definitiv "gültige" Fassung des zur Diskussion stehenden Werks vorliegt und schon von daher zwangsläufig die Bearbeitungs- und Rezeptionsgeschichte Bestandteil des Unternehmens sind? Die neue Frankfurter "Chowanschtschina"-Produktion präsentiert die Sittenbilder aus einem gar nicht so alten Rußland als Studien zu Begehren, Macht und Angst vor Machtverlust, Gewaltförmigkeit bei abwesender Rechtstaatlichkeit und Vernichtung einer ganzen Volksgruppe vor einer vieldeutigen und in verschiedenen Varianten sich präsentieren Treppen- und Tor-Anlage, die entfernt an einen Repräsentationsbau der sozialistischen Monumental-Architektur erinnert. Ohne dass es mit Holzhämmern eingebleut würde, hat Christian Pade die fortdauernde Aktualität der im Jahr 1682 angesiedelten Handlung akzentuiert, zugleich aber immer wieder auch auf die Historizität verwiesen. Eingangs durch eine Grabungsstelle auf dem Platz, der dank Alexander Lintls kluger Bühnen-Installation auf Zitate der Kreml-Außenansicht verzichtet. Eine alte Zarenkrone kommt da zum Vorschein und mit ihr der Traum von der Macht. Zugleich aber zeigt sich nicht nur sozialer Konfliktstoff, sondern - changierend zwischen vorgestern, gestern und heute - der Konflikt zwischen einem um Reformen ringenden Land und Kräften des konservativen Beharrens. "Chowanschtschina" präsentiert bürgerkriegsähnliche Zustände von Anfang an und am Ende eine wohl sehr russische Konfliktlösung: Zum Untergang verurteilt werden vom Zaren Peter, dem später das Attribut "der Große" zukam, die Strelizen, die Angehörigen des Moskauer Garde-Regiments der vorangegangenen Herrscher (heute würde man von Präsidentengarde sprechen oder den Truppen des Innenministeriums); ihre Anführer werden entmachtet und gemeuchelt, die Reste des einst so mächtigen Häufleins ins Feuer getrieben, das sie in rechtgläubigem Fanatismus selbst legten. Aber auch Fürst Golizyn, der Mann des Fortschritts im Kreml - von Lars Eric Jonsson ganz hervorragend als korrupter Taktierer mit verführerischem Tenor vorgeführt verliert schlagartig Macht und Reichtum. In "Zeiten des Verdachts, des Verrats und der Gewinnsucht", so das Schlüssel-Motiv, wird er verbannt. Christian Pade läßt ihn aus seinem Dienstsitz tragen, an das Nornenseil binden (an dem zuvor ein Schicksalspendel hing) und in den Bühnenhimmel schweben: hilflose Gesten begleiten den unerbittlichen Flug in die historische Leere und Bedeutungslosigkeit. Der junge russische Dirigent Kirill Petrenko, auf den man um die Jahrhundertwende als Generalmusikdirektor von Meiningen aufmerksam wurde und der nun als Chefdirigent an der Komischen Oper Berlin wirkt, animierte das Frankfurter Museumsorchester und die Chöre zu einer bemerkenswerten Leistung: die knappen, konzisen Gesten Mussorgskis erhielten ebenso klare Konturen wie die Volkschöre wohlklingende Tiefe und geballte Erregung. Das Solistenensemble war kompetent zusammengestellt - herausragend neben Anatoli Kotscherga als geistlichem Führer Dosifej die kundryhafte Elina Cassian als Marfa und Lars Eric Jonsson als Fürst Golizyn. Die Schrecken der Geschichte und Gegenwart, die Christian Pades Inszenierung durchaus drastisch, aber eben nicht so exzessiv lustvoll wie beispielsweise Calixto Bieito zeigt, werden kontrapunktiert von der ironisch gebrochenen Schönheitssehnsucht und dem Vorschein oder Nachklang von Schönheit. So stellt sich Dialektik her auf dem Theater und in den höheren wie den tieferen Sphären seiner Musik. © 2005 Deutschlandradio |
|
FINANCIAL TIMES April 8, 2005 Frankfurt Opera: Khovanshchina Alcoholism, depression and loneliness were a few of the things that killed Modest Mussorgsky in 1881. He was 42 years old. He left behind the unfinished piano score of Khovanshchina, a vast historical opera that was, among other things, a criticism of Tsar Peter I. Rimsky-Korsakov, Stravinsky and Shostakovich all had a go at completing and orchestrating the opera but it still has not really entered the repertoire. Each good revival makes you wonder why not. Bloodier and more turbulent than Boris Godunov, Khovanshchina is also more politically complex than Mussorgsky's earlier opera. For all that it deals with historical events, the piece is laden with ambiguity and was always intended to be read as contemporary. Christian Pade does this meticulously. The scribe lives in a cardboard box, the children sniff glue, the power, corruption and murder are all convincingly immediate. Alexander Lintl's starkly symbolic sets somehow sit well with Pade's detailed realism. The strongest moments are those of innuendo - Khovansky's troupe of child ballerinas, shivering in their underwear, or the persecuted Emma's defensive body language. Both Pade and Kirill Petrenko share a flair for the garish. Petrenko, the very young general music director of Berlin's Komische Oper, conducts Shostakovich's astringent version of the score (except for the ending, where he chooses Stravinsky) with a sure sense of structure and splashy effects. He is good at loud and bombastic but can also do brittle, vulnerable and compassionate, though the third-night orchestra was not on top form. Gregory Frank is steely yet dissolute as Khovansky, Göran Eliasson plausibly self-destructive as his son, with Hans-JürgenLazar's peevish scribe adding contrast. Lars Erik Jonsson is a powerful Golitsyn, Elena Cassian a determined Marfa. |