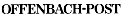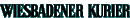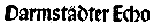|
Flüchtige Gäste Auf seiner viermonatigen Ostasien-Reise lernte Benjamin Britten im Januar 1956 in Tokio das No-Drama "Sumidagawa" kennen, das Juro Motomasa um 1430 geschrieben hatte. Es erzählt von der verzweifelten Suche einer adligen Witwe nach ihrem entführten Söhnchen. Wahnsinnig, aber auch hellsichtig geworden, gerät sie an einem Fluß in ein Pilgerboot, das zu einem Wundergrab übersetzt. Aus der Gruft erscheinen Stimme und Geistgestalt des Kindes, dessen Segen die Mutter heilt. In seine Parabel "Curlew River" hat Britten 1964 Parallelen zwischen No-Theater und mittelalterlichem Mysterienspiel eingearbeitet: ritualisierte Bewegung, einfache instrumentale und szenische Ausstattung, ein reines Männerensemble. Die japanische Quelle nutzte Britten zu einer christlichen Gleichniserzählung: Eine Klerikergruppe betritt singend die Kirche, erzählt und spielt das Stück und tritt singend wieder ab. Der Parabelcharakter des Stücks erfüllt sich nicht allein im Resümee des Abtes: Heil und Heilung als Zeichen göttlicher Gnade. Vielmehr ist William Plomers Libretto voller Symbolbezüge, am auffälligsten wohl im Seelenvogel, dem schnepfenartigen, sichelschnabeligen Brachvogel (Curley) mit seinem melancholisch-heiseren Flötentrillerruf. Olivier Messiaen hat ihm in seinem "Catalogue d'oiseaux" ein Klavier-Denkmal gesetzt, Britten nicht zufällig die Flöte als Leitinstrument Mutter wie Kind zugeordnet. Obwohl Britten im Vorwort zu dem Stück "eine Nachahmung des Altjapanischen" ausdrücklich ausschloß und statt dessen die Entwicklung der ganzen Komposition aus dem rahmenden gregorianischen Kirchenlied "Te lucis ante terminum" hervorhob, sind doch in Handlungsstil, Instrumentation und harmonisch-melodischem Satz fernöstliche Anregungen unverkennbar. Die eindrucksvolle Koproduktion von Oper Frankfurt und Frankfurter Musikhochschule unterstrich diese ostasiatische Traditionslinie: in zeichenhafter Gesichtsbemalung und der Halbmaske der Verrückten sowie im Schnitt von Jacken und weiten Hosen, auch im Bühnenbild mit mehreren Spielebenen und schlicht weißem Guckkastenrahmen. Das erinnert an das No-Theater, aber auch an die rings umschreitbare Shakespeare-Bühne im Zentrum des Zuschauerraums. Moritz Nitsches Ausstattung setzt so Brittens Klangkompendium aus japanischen wie elisabethanischen oder Purcellschen Anregungen aufs anschaulichste um. Mit dieser unaufdringlich sinndeutenden Ausstattung korrespondiert die ebenfalls ostasiatisch inspirierte Inszenierung des jungen Frankfurter Opernspielleiters Axel Weidauer in ihrem stilisierten, zugleich plastisch charakterisierenden Bewegungszeremoniell: Schlichtheit aus Konzentration statt Armut. Ausdrucksstarke Sängerdarsteller trugen dieses Konzept: der britische Tenor John Mark Ainsley beklemmend eindringlich in der Peter- Pears-Rolle der verzweifelten Mutter; das Frankfurter Ensemblemitglied Simon Bailey als baritonal gehörig auftrumpfender Fährmann; Robin Adams als Reisender auf Wohlklangpfad und Soon-Won Kang als majestätischer Abt, umgeben von einem sonoren Mönchssextett aus Frankfurter Musikhochschulstudierenden. Schemenhaft hinter schwarztransparentem Vorhang auf der obersten Bühnenebene wurde auch das siebenköpfige Musikhochschul-Instrumentalensemble zu einem sinnvollen Element des Bühnenbilds - je nach Beleuchtung (Jürgen Koß) verschwommener oder konturierter. Dies entsprach exakt Brittens Musik - bewußt unscharf wie in den Glissandi und Flatterzungeneffekten des Flötenparts, der wie von der heiseren japanischen Shakuhachi-Bambusflöte gespielt klingt; in den Orgelclustern wie von der Mundorgel Sho; oder aber zugespitzt wie im Schlagzeug oder im Horn, das dem Fährmann zugeordnet ist. Den sieben Studierenden gelang unter der Leitung des Opern-Solorepetitors Erik Nielsen ein außerordentlich feingliedriges, weit gestaffeltes Klangbild. Die Spielstätte, ein ehemaliges Straßenbahndepot im Frankfurter Stadtteil Bockenheim, unterstrich mit ihrer nackten Industriearchitektur dieses so reiche "arme" Spiel von Entwurzelten und Verirrten. Sogar Abt und Mönche sind nur flüchtige Gäste im Diesseits. Und selbst der bodenständige Fährmann schwankt in seinem Boot gefährlich auf dem Brachvogelfluß - ein Charon zwischen West- und Ostufer, Tod und Wunderleben. An diesem nachhaltigen Premierenabend erfüllte sich Brittens Wunsch zur ersten seiner drei Kirchenparabeln - "daß sich auf der Bühne und beim Publikum eine ähnliche Intensität und Konzentration einstellt wie bei jenem ursprünglichen (japanischen) Drama". ELLEN KOHLHAAS |
|
Das göttliche Kind VON HANS-KLAUS JUNGHEINRICH Die kleine Schar der Mönche zieht singend ein, kleidet und schminkt sich vor dem Publikum zum Spiel. Der Darsteller der wahnsinnigen Mutter setzt seine Halbmaske mit Perücke etwas später auf, schon ein Stück weit in der Rolle. Mit klaren, knappen Strichen inszenierte Axel Weidauer die Kirchenoper Curlew River (etwa: "Brachvogel-Fluss") als Neuproduktion der Oper Frankfurt im Depot Bockenheim. Das 40 Jahre alte Werk entstammt einem höchst interessanten und innovativen, früher unterschätzten Oeuvrebereich des englischen Komponisten. Das Curlew River-Sujet greift ein japanisches Nô-Spiel auf. Am mythischen Ort des Flusses lässt sich eine Mutter, verrückt vor Schmerz (tenoral intensiv und charaktervoll: John Mark Ainsley), übersetzen auf der Suche nach ihrem verschwundenen zwölfjährigen Sohn. Der Fährmann (wie ein düsterer Schicksalsbote: Simon Bailey) erzählt vom Tod eines von Sklavenjägern geraubten Buben vor einem Jahr an diesem Fluss. Die Mutter erkennt, dass der hier begrabene Junge ihr Sohn ist. Mit den Mitreisenden betet sie und beschwört in immer dringlicherer Sehnsucht die Gegenwart ihres Kindes als "Wunder" herbei. Während die Reisenden die dröhnende, fast niederschmetternde Bitt- und Trauerlitanei absolvieren, erhebt sich aus ihrem finster herausfordernden Gesang eine hohe Knabenstimme (der tragende Kindersopran von Maverick Nawson aus dem Off) wie die Sonne aus einer schweren, dichten Wolkendecke. Diese Epiphanie (in Moritz Nitsches schlichtem Bühnenbild optisch versinnlicht durch die Lichterscheinung eines kleinen Knaben in einem gleichsam vertikal auf den Rückprospekt projizierten Kindergrab) ist die - nicht nur - geistliche Kern- und Schlüsselszene des Stückes. Phantasmatische Wunscherfüllung einer sehnsuchtsvollen Mutter; zugleich auch Wunder des in die Realität hinein leuchtenden göttlichen Kindes analog zu einer seiner zentralen ikonographischen Ausprägungen als christliches Gott-Kind; in einer geheimeren Schicht aber auch für einen Moment die aufscheinende Utopie erotischer Begierde. Eine elementare Musiksprache Es ist also eine sehr komplexe Sakralität, die dieses Werk ausstrahlt (als Produkt der Kunst ähnlich in Distanz zu jeglicher Kirchendienstbarkeit wie Parsifal), und das nicht nur wegen der fernöstlichen Quelle, der auch die Musikalisierung nachhorcht. Man kann diese Musik, erst recht im Abstand von 40 Jahren, nicht genug bewundern. Sie formuliert sich in ihrer Einfachheit gleichsam als bestimmte Negation zur Darmstädter Avantgarde jener Zeit und tritt den Beweis einer Revolution "auf leisen Sohlen" an. Der Rückgriff auf Mönchsgregorianik und Einstimmigkeit veranlasste Britten, hier den approbierten Tonsatz jeglicher Art zu vergessen und eine neue, elementare Musiksprache zu entwickeln. Konkret entsteht sie aus der Weiterspinnung und Ornamentierung einstimmiger Linearität, die sich unakademisch und organisch auswächst zu einem melodischen Wuchern und Blühen, das, auf dem Höhepunkt der Verdichtung und Ausspreizung, in der "Wunderszene", einen Zusammenklang faszinierend parallel geführter Musikströme ergibt. Ebenso wie die intrikate, vielschichtige Bühnenerzählung spiegelt freilich auch diese frei und wie improvisiert mit ihren Materialien umgehende Tonsprache ungeachtet ihrer scheinbaren Simplizität ein sehr modernes Bewusstsein wider. Das andächtige Spiel mit dem Wunderbaren wird als Übung eines (mönchischen) Männerkollektivs evoziert, bietet sich mithin als eine künstliche Veranstaltung dar, eingebettet in einen liturgischen Rahmen. Von der lapidaren Strenge und Stilisiertheit solcher Rituale und asketischen Verrichtungen ist auch die Frankfurter Wiedergabe durchtränkt; sie zeichnet respektvoll die den Abstand zum Geschehen schaffende dramaturgische Rahmung der Bühnenerzählung nach. Aktion wird jeweils nur angedeutet. Der unnaturalistische, gleichnishafte Stil des Nô-Spiels herrscht vor. Doch gibt es Augenblicke, in denen das große Drama aufzureißen und den Rahmen zu sprengen unternimmt. Auf dem Kulminationspunkt des Schmerzes etwa schiebt sich der Mutter-Darsteller die Maske weg, so dass die untere Gesichtshälfte sichtbar wird. Und ganz zum Schluss erscheint die Mutter nochmals, die abgezirkelte spielerische Ordnung verlassend, auf der leeren Bühne, wie auf der Suche nach der nun nicht noch einmal sich vollziehenden Offenbarung. Das Wunderbare in der Musik Als wesentliche Spielfläche dient ein Steg vor dem im Hintergrund erhöht postierten siebenköpfigen Instrumentarium (wie der sechsköpfige kleine "Chor" Studierende der Frankfurter Musikhochschule). Die Solopartien waren ausgewachsenen Opernsängern anvertraut (sonorer Abt: Soon-Won Kang; profilierter Reisender: Robin Adams). Mit nahtlosem Koordinationsvermögen dirigierte der junge Kapellmeister Erik Nielsen die auf sublime Weise schön klingende, niemals auftrumpfende, doch im zart Insistierenden in jeder Facette mitteilsame und farbige Partitur, die es fertigbringt, das "Wunderbare", jene in neuester Musik so selten gewordene Substanz, hörbar und gegenwärtig zu machen. Britten, einer der Größten im musikalisch nicht kleinen 20. Jahrhundert. [ document info ] Dokument erstellt am 10.02.2005 um 16:08:11 Uhr Erscheinungsdatum 11.02.2005 |
|
Benjamin Brittens "Curlew River" im Bockenheimer Depot Szenerie und Musik im intensiven Gleichklang
Als Benjamin Britten in den fünfziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts auf einer Asien-Reise das japanische No-Theater kennen lernte, ließ er sich davon zur ganz reduzierten Ausstattung seiner ersten Kirchenparabel inspirieren: "Curlew River" ("Der Fluss der Möwen") verstand Britten allerdings nicht als Mixtur zwischen traditionell japanischem und europäischem Theater, er wollte dem Regisseur der Uraufführung sogar den Besuch einer No-Aufführung untersagen. Brittens so entstandene Kirchenparabel sollte lediglich die szenische Konzentration ihrer fernöstlichen Inspirationsquelle in sich tragen. Regisseur Axel Weidauer, der "Curlew River" jetzt für die Oper Frankfurt im Bockenheimer Depot inszeniert hat, hat es mit dieser Vorgabe des Komponisten glücklicherweise nicht ganz so genau genommen. Er lässt die ausschließlich männlichen Darsteller sehr wohl auf die spartanische, fast ritualhaft wirkende Gestik des No-Theaters zurückgreifen - Grundlage der über knapp anderthalb Stunden hochkonzentrierten Aufführung. Schließlich beruht der Stoff, den Britten im Stil einer Mysterienaufführung von christlichen Mönchen als Spiel im Spiel darstellen lässt, unmittelbar auf dem um 1430 entstandenen No-Drama "Sumidagawa": Auf der Überfahrt über einen Fluss wird die Mutter eines toten Kindes durch dessen Erscheinung von ihrem Wahnsinn geheilt: Nur schwer ließe sich eine plausiblere szenische Umsetzung als durch diese ganz abstrakte Formensprache denken, die damit zugleich den Parabel-Charakter des Stücks wahrt. Mit der szenischen Intensität paart sich der fast meditative Charakter von Brittens Musik auch in Frankfurt bestens: Auf gerade sieben Musiker - Flöte, Horn, Viola, Kontrabass, Harfe, Schlagzeug und Kammerorgel - ist das kleine, im Bockenheimer Depot hinter einem dunklen Gaze-Vorhang postierte Orchester beschränkt (Ausstattung: Moritz Nitsche). Die Mitglieder des Instrumentalensembles der Frankfurter Hochschule für Musik und Darstellende Kunst musizieren unter der Leitung von Erik Nielsen angemessen suggestiv, verleihen aber gerade auch den wenigen dramatischen Zuspitzungen exakte Konturen. Aus Studierenden der Hochschule besteht auch der ausgewogene Chor der Mönche; in den solistischen Partien fällt besonders der ungemein höhensichere englische Tenor John Mark Ainsley auf, dessen weibliche Rolle der "Verrückten" nur eine dezente Frauenmaske andeutet. Zudem verfügt er wie Simon Bailey (Fährmann) über eine prononcierte Artikulation der englischen (Mutter-)Sprache, tadellos sind auch die kleineren Solo-Partien des Reisenden (Robin Adams), des Abts (Soon-Won Kang) sowie die aus dem Off eingespielte Stimme des Jungen (Maverick Nawson) besetzt. Auffallend starker Beifall! AXEL ZIBULSKI |
|
Bootsfahrt in die Gnade Gottes Von Andreas Bomba Im Jahre 1956 reiste Benjamin Britten nach Japan. Dort sah er zum ersten Mal ein Stück des Nô-Theaters, Männer mit traditionellen Masken und Musik, Spiel und Gesang in archaisch-kargem Stil. Dies reizte Britten, der sich – mit gehörigem Understatement – gerne als Komponisten von Gebrauchsmusik bezeichnete. Britten fielen ähnliche Qualitäten des geistlichen Dramas ein, wie es im englischen Mittelalter gegeben wurde, Mönchsgesang in düsteren Kathedralen, weite, einsame Moorlandschaften im Norden der britischen Insel. Er ließ William Plomer das japanische Stück "Sumidagawa" umformen in eine christliche "Kirchenparabel". Eine Mutter hat über dem Verlust ihres Kindes den Verstand verloren. Sie irrt umher und bittet einen Fährmann, der im Begriff ist, einen Abt und seine Mönche über den "Fluss der Brachvögel" (Curlew River) überzusetzen, sie mitzunehmen. Dabei erzählt sie ihre Geschichte. Am anderen Ufer findet sie das Kind tot auf – und nimmt es als tröstende Erscheinung wahr. Der Abt deutet die Überfahrt als läuternden Schritt der Heilsgeschichte: Heilung einer Irren als Offenbarung der Gnade Gottes. Ein Stück wie geschaffen also für Frankfurts Kulturkathedrale, das Bockenheimer Depot. Aus der dunklen Apsis ziehen die Mönche ein, kraftvoll den gregorianischen Hymnus "Te lucis ante terminum" intonierend. Sie legen leicht japanisierte Kostüme an, kauern und agieren dann hinter einer Art Laufsteg, auf dem der Fährmann mit einer Stange hantiert und bedeutungsschwer sein Boot steuert. Auf einem Podest im Rücken der Spieler sitzen die sieben Instrumentalisten, Studenten der Musikhochschule. Aparte, auch bizarre Kombinationen wie Harfe und Kontrabass oder Viola und Horn changieren mit Klängen von Orgel oder Glöckchen. Die Musik und ihr verknappter Klang- und Tonvorrat unterstreichen, kommentieren, tragen den Text und das langsame, archaisch strenge Bewegungsritual dieses bewusst belehrenden Theaterspiels (Inszenierung: Axel Weidauer). Eingefasst wird die Szene lediglich von einem kastenartigen Gestänge (Bühne: Moritz Nitsche); Beleuchtungseffekte, wie große Schatten an den Wänden, unterstreichen die düstere, konzentrierte Atmosphäre. Zu der – von Erik Nitsche perfekt koordinierten – Musik entfalten die Darsteller ihre Rollen. Simon Bailey etwa den furchterregend vom Schicksal gestählten Fährmann, John Mark Ainsley eindringlich und fesselnd die "Madwoman" – Britten hat, hierin dem Nô-Theater folgend, auch die Frauenrolle männlich besetzt. Nur die Maske verrät, dass hier Theater gespielt wird. Nach dem Ende des Spiels rennt Ainsley ohne Maske noch einmal herein, als wolle er nachsehen, ob alles wirklich wahr ist. Da wird auch der Zuschauer unsicher: Befindet er sich auf Bockenheimer Boden oder nicht doch im weiten, so viele Fragen und Wunder bergenden Moor des englischen Nordens? |
|
Heilung auf dem Fluss Von Axel Zibulski
Als Benjamin Britten in den fünfziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts auf einer Asien-Reise das japanische No-Theater kennen lernte, ließ er sich davon zur ganz reduzierten Ausstattung seiner ersten Kirchenparabel inspirieren: "Curlew River" ("Der Fluss der Möwen") verstand Britten allerdings nicht als Mixtur zwischen traditionell japanischem und europäischem Theater und wollte dem Regisseur der Uraufführung sogar den Besuch einer No-Aufführung untersagen. Brittens so entstandene Kirchenparabel sollte lediglich die szenische Konzentration ihrer fernöstlichen Inspirationsquelle in sich tragen. Regisseur Axel Weidauer, der "Curlew River" jetzt für die Oper Frankfurt im Bockenheimer Depot inszenierte, hat es mit dieser Vorgabe des Komponisten glücklicherweise nicht ganz so genau genommen. Er lässt die ausschließlich männlichen Darsteller sehr wohl auf die spartanische, fast ritualhaft wirkende Gestik des No-Theaters zurückgreifen - Grundlage der über knapp anderthalb Stunden hochkonzentrierten Aufführung. Schließlich beruht der Stoff, den Britten im Stil einer Mysterien-Aufführung von christlichen Mönchen als Spiel im Spiel darstellen lässt, unmittelbar auf dem um 1430 entstandenen No-Drama "Sumidagawa": Auf der Überfahrt über einen Fluss wird die Mutter eines toten Kindes durch die Erscheinung dessen Geistes von ihrem Wahnsinn geheilt: Nur schwer ließe sich eine plausiblere szenische Umsetzung als durch diese ganz abstrakte Formensprache denken, die damit zugleich den Parabel-Charakter des Stücks wahrt. Mit der szenischen Intensität paart sich der fast meditative Charakter von Brittens Musik auch in Frankfurt bestens: Auf gerade sieben Musiker - Flöte, Horn, Viola, Kontrabass, Harfe, Schlagzeug und Kammerorgel - ist das kleine, im Bockenheimer Depot hinter einem dunklen Gaze-Vorhang postierte Orchester beschränkt (Ausstattung: Moritz Nitsche). Die Mitglieder des Instrumentalensembles der Frankfurter Hochschule für Musik und Darstellende Kunst musizieren unter der Leitung von Erik Nielsen angemessen suggestiv, verleihen aber gerade auch den wenigen dramatischen Zuspitzungen exakte Konturen. Aus Studierenden der Hochschule besteht auch der ausgewogene Chor der Mönche; in den solistischen Partien fällt besonders der ungemein höhensichere englische Tenor John Mark Ainsley auf, dessen weibliche Rolle der "Verrückten" nur eine dezente Frauenmaske andeutet. Zudem verfügt er wie Simon Bailey (Fährmann) über eine prononcierte Artikulation der englischen (Mutter-)Sprache. Tadellos sind auch die kleineren Solo-Partien des Reisenden (Robin Adams), des Abts (Soon-Won Kang) sowie die aus dem Off eingespielte Stimme des Jungen (Maverick Nawson) besetzt. Auffallend starker Beifall! |
|
Das Wunder am Grab Von Klaus Trapp FRANKFURT. Eine Brücke von Ost nach West schlägt der Komponist Benjamin Britten in seiner Kirchen-Parabel „Curlew River" (Fluss der Brachvögel), die in einer bewegenden Neuinszenierung der Oper Frankfurt im Bockenheimer Depot zu erleben ist. Britten verbindet in dem 1964 nach einem Libretto von William Plomer entstandenen Werk Elemente des japanischen No-Theaters mit Zügen des mittelalterlichen Mysterienspiels. Es waren gerade die einfachen, aber beredten Gesten beider Kunstformen und ihre musikalischen Gemeinsamkeiten, die ihn interessierten. Einfach ist auch das Bühnenbild, das Moritz Nitsche in die dunkle Weite des Bockenheimer Depots stellte: ein aus weißen Stangen gebildeter Würfel schneidet das Podium für die sieben Instrumentalisten aus dem Raum heraus, davor zieht sich quer ein beleuchteter Laufsteg, der den trennenden Fluss markiert und zugleich als Spielort dient. Der junge Regisseur Axel Weidauer betont die ruhige Feierlichkeit eines durch Mönche zelebrierten Mysterienspiels. Mit gregorianischem Gesang ziehen sie ein – mit dem gleichen Choral verlassen sie am Ende den virtuellen Kirchenraum. Drei Mönche versetzen sich in die tragenden Rollen: eine Mutter, die auf der Suche nach ihrem entführten Sohn dem Wahnsinn verfallen ist; einen Reisenden, der sie begleitet; und den Fährmann, der sie über den Fluss setzt. Die Verrückte findet schließlich das Grab ihres Jungen; dort geschieht das Wunder: Der Geist des Kindes erscheint und segnet die Mutter, die durch göttliche Gnade von ihrem Wahn geheilt wird. Die Inszenierung setzt auf das Gleichnishafte, verzichtet auf realistische Zutaten und steigert gerade so die Wirkung. Der Darsteller der Mutter trägt eine Halbmaske; der Fährmann führt einen Stab mit sich, der zugleich Stütze und Ruder sein kann, die Mönche schminken sich gegenseitig und verbergen so ihre Identität. Brittens Musik, die folgerichtig aus dem Eingangschoral entwickelt ist, wird von einem Instrumentalensemble der Frankfurter Musikhochschule unter Leitung von Erik Nielsen gespielt. Flöte und Horn, Viola und Kontrabass, Harfe und Kammerorgel sowie reich besetztes Schlagzeug sind den Figuren zugeordnet und lassen zugleich den Fluss lebendig werden, wenn die Rufe der Brachvögel eingeblendet werden. Auch die meisten Mönche werden von Studierenden dargestellt, aus ihrer Gruppe heben sich die Protagonisten heraus, allen voran der Tenor John Mark Ainsley in einer intensiven, stimmlich flexiblen Verkörperung der verrückten Mutter und der Bariton Simon Bailey als Fährmann. Das Premierenpublikum verfolgte am Mittwoch fasziniert diese Parabel und applaudierte nach fünfviertel Stunden begeistert. |
|
Der dunkle Ruf Von Gerd Döring Tief beeindruckt kehrte Benjamin Britten 1956 von einer Asien-Reise zurück, überwältigt von Eindrücken, deren Echo sich in vielen Werken der folgenden Jahre nachweisen lässt. So basiert seine Kammeroper "Curlew River" auf Sumida-Gawa, einem Klassiker des japanischen No-Theaters. Die Frankfurter Oper erinnert im Bockenheimer Depot jetzt an das Werk. In Brittens Version der Parabel zieht eine verwirrte Frau durchs Land, sucht ihr von Sklavenhändlern verschlepptes Kind. Sie kommt zum Curlew River, dem Fluss der Brachvögel. Ein Fährmann nimmt die Frau an Bord, und es stellt sich heraus, es ist die Mutter jenes Jungen, der vor genau einem Jahr am gegenüberliegenden Ufer verstarb. Ein kleiner Heiliger, dessen Grab für die Flussbewohner zur Wallfahrtsstätte geworden ist. Die Frau findet Erlösung im gemeinsamen Gebet, ihr Sohn erscheint ihr ein letztes Mal. Wie zu Beginn erklingt Gregorianisches. Mitgedacht hat Britten für sein 1964 uraufgeführtes Werk die Akustik einer alten Pfarrkirche in Sussex, das alte Straßenbahndepot in Frankfurt macht als Rahmen akustisch (aber auch mit seiner strengen Optik) eine gute Figur. Gespielt wird die "Kirchenoper" auf einem schlichten, mehrstufigen Bühnenwürfel. Vor dem Publikum verwandeln sich zehn Mönche in Schauspieler. Kittel mit verschiedenfarbenen Borten teilen die Rollen zu, überdeutlich werden mit Schminke die Augenbrauen nachgezogen, der Abt (nüchtern: Soon-Won Kang) kündigt das klösterliche Spiel an. Simon Bailey gibt dem Fährmann einen stämmigen Bass, nicht ganz der herbe Schiffer, den Britten vorsieht, eher ein bärbeißiger Christophorus mit Flößerstange. Gastsänger Robin Adams ist sein erster Kunde, ein "Reisender" mit warmem Bariton und pantomimischem Talent. Für die Rolle der "Madwoman" hat Britten einen Tenor vorgesehen - auch das eine Reminiszenz an das No-Spiel. In Frankfurt singt der Engländer John Mark Ainsley mit dramatisch weitgespanntem Tenor, das Gesicht versteckt hinter einer weißen Porzellan-Halbmaske und umkränzt von wirren Haaren. Ein grandiose schauspielerische wie sängerische Leistung, die sicher getragen wird vom Chor der Mönche (wie die Instrumentalisten Studenten der Hochschule für Musik). Mit seiner szenischen Umsetzung unterstreicht Axel Weidenauer den sakralen Charakter der Kammeroper. Einen schlichten Würfel hat man ins Bockenheimer Depot gestellt, gespielt wird auf einer schmalen Rampe im Vordergrund, die Handlung scharf kontrastiert von Hell und Dunkel. Das kleine Ensemble - Flöte, Horn, Viola, Kontrabass, Schlagwerk, Harfe und (Kammer-) Orgel - sitzt, verborgen von einem zarten Schleier, im Bühnenhintergrund. Erik Nielsen am Pult hält die so eigenwillig instrumentierte Musik zusammen. Der dunkle Ruf des Brachvogels taucht auch als Motiv im Stück auf (Flöte), mehr noch, ein "Curlew-Sign" gibt es in der Partitur - eine Figur, die Britten eingeführt hat, um das harmonisch ungebundene Spiel zu strukturieren: Geschrieben hat der sanfte Neutöner eine zwar tonal bleibende, aber stark asynchrone Musik, die Gesang und Rezitation mit eigenwilligen Klangfarben untermalt. |