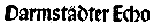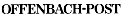|
Verdis „Don Carlo" in Mannheim MANNHEIM. Auch bei Skandal-Regisseuren liegen manchmal die Nerven blank. An der Mannheimer Oper sollte Calixto Bieito Verdis „Don Carlo" inszenieren. Er kam, probte ein paar Stunden – und reiste wieder ab. Man sprach von „persönlichen Gründen". Das war im Januar. Und das Theater stand mit einem fertigen Bühnenbild ziemlich dumm da. Was tun? In Werner Düggelins Zürcher Inszenierung zum Verdi-Jahr 2001 fand Intendant Schwab Ersatz. Düggelin brachte viel guten Willen, aber wenig Personenführung mit. Im arenaartigen Bühnenbild stehen die auf Abstand und Bewegungsarmut verpflichteten Sänger wie Staffagefiguren aus dem Opernfundus herum. Berührende Szenen? Nicht einmal im utopischen Finale, in dem Carlos und Elisabeth nacheinander im Nebel verschwinden. Das war aber im reichen Zürich nicht weiter schlimm, man hatte dort ja die erste Sängergarnitur und mit Franz Welser-Möst einen renommierten Dirigenten im Graben. Auch in Mannheim reüssiert die auf der vieraktigen Fassung (1884) beruhende Aushilfs-Produktion vor allem durch den Einsatz des Ensembles. Die beiden Damen Galina Shesterneva (Elisabeth) und Susan MacLean (Eboli) überzeugen durch gepflegtes Singen und gewandte Gestaltung. Der bassgewaltige Mihail Mihaylov ist ein überlegen disponierender Philipp und der einzige, der einen durchdachten Charakter auf die Szene bringt. Michael Agafonov macht mit viel tenoraler Emphase darauf aufmerksam, dass in Carlos doch mehr stecken könnte als ein depressiver Herumsteher. Indes enttäuscht Enrico Dovicos instabiles, mal schlaffes, mal knallig auftrumpfendes Dirigat. (fee) |
|
Starke Symbole Von Gerd Döring Nach dem kurzfristigen Rückzug von Star-Regisseur Calixto Bieito hat man in Mannheim schnell reagiert und flugs eine gestandene "Don Carlo"-Inszenierung eingekauft. Werner Düggelin hat die Verdi-Oper 2001 in Zürich inszeniert, nun feiert man in Mannheim eben Friedrich Schiller mit seiner Version des "Don Carlos". Düggelin inszeniert das Geschichtsepos mit viel Reduktion, arbeitet mit starken Symbolen, aber nicht mit krassen Bildern. Gewalt ist zwar allgegenwärtig, aber die Realitäten des "achtzigjährigen" Krieges in Flandern, die Greuel der Inquisiton in Spanien bleiben im Hintergrund, er lenkt den Blick auf die Handelnden. Den Bühnenaufbau (Raimund Bauer) der Züricher Inszenierung hat man mit nach Mannheim gebracht. Die Atmosphäre der Szenen bestimmt der Blick auf Landschaften, die durch zwei große Fenster im Hintergrund sichtbar werden. Durch perforierte Flächen, die sich vor die Fenster ziehen lassen, fällt eine symbolträchtiges Punktraster auf die Spielfläche, mal in nüchtern kaltem Blau, dann wieder in glühendem Rot. Und so, zwischen kalter Ratio und heißer Emotion, bewegen sich auch die Handelnden in Verdis Freiheitsdrama um den spanischen Thronerben Don Carlo und seinen Vater. Philipp II., ein grauer Hagestolz, ist längst nicht mehr Herr über seine Handlungen. Die Macht aus dem Händen genommen hat ihm die mächtige Inquisition. In Rodrigo, dem Marquis von Posa, findet er jemanden, dessen unbeugsame Art ihn beeindruckt. Dem eigenen Sohn misstraut er, denn der junge Carlo liebt seine Stiefmutter Elisabetta. Man spielt die Mailänder-Fassung in vier Akten (1864), gesungen wird mithin in Italienisch (mit exakter Übertitelung). Sue Willmington (Kostüme) hat dem schwärmerischen Königssohn eine rote Samthose verpasst, und Düggelins weitschweifiger Zauderer kommt dem wirklichen Don Carlo(s) weit näher, als es Verdi wahr haben will. Auch die übrigen Protagonisten sind eingekleidet nach ihrem Temperament: Philipp in metallen-kalten Farben, Rodrigo erdfarben, die Prinzessin Eboli in flammendes Rot, die brave Elisabetta in gedeckten Farben. Mihail Mihaylov ist ein bärbeißiger Philipp II., ein sonorer Sänger, dessen stimmgewaltiger Bass noch übertroffen wird vom knurrenden Großinquisitor (Tomasz Konieczny). Mikel Deans Rodrigo gibt der ganzen Inszenierung Statur und Sicherheit, ein Bariton mit beachtlichem Stimmumfang. Ein solides Gegengewicht zu dem etwas fahrigen Don Carlo, den Michail Agafonov mit nicht immer stabilem Tenor singt. Umso präziser die beiden Kontrahentinnen am Königshof. Susan Maclean verleiht der Prinzzessin Eboli diabolische Kontur, von böser Scharfzüngigkeit bis zur verschlagenen Reue, Galina Shesterneva ist eine stolze Königin, mit Stärken vor allem in den lyrischen Passagen, ein leuchtender Sporan, eine auch darstellerisch überzeugende Elisabetta. Viel, viel Beifall gibt es in Mannheim für ein bis in die Nebenrollen ausgeglichen besetztes Ensemble, für den soliden Chor (Einstudierung: Bernhard Schneider) und die Gäste. |
|
Ohne Bieito eine brave Inszenierung Katalanischer Skandal-Regisseur hatte die Probenarbeit des Mannheimer "Don Carlo" niedergelegt Manchmal verhindert eine kleine eine größere Katastrophe, auch auf der Bühne. Dem Nationaltheater Mannheim ist vermutlich ein handfester Opernskandal erspart geblieben, weil der katalanische Regisseur Calixto Bieito die Probenarbeit bei der Neuinszenierung von Verdis "Don Carlo" aus persönlichen Gründen, wie es offiziell heißt, niederlegte. Das enfant terrible des Musiktheaters wollte also seine Publikumserregungen jedenfalls nicht in Mannheim fortsetzen, nachdem sie in Hannover ("Don Giovanni", "Il trovatore" und "La traviata" ) und zuletzt in Berlin ("Entführung aus dem Serail" an der Komischen Oper ) zu öffentlich ausgetragenen Theaterkrisen führten. In seiner Not fand das Haus ein Schnäppchen: Eine "Don Carlo"-Inszenierung des Altmeisters Werner Düggelin, vor langen Jahrzehnten auch einmal Regisseur in Darmstadt, am Opernhaus Zürich aus dem Jahre 2001 war im Angebot. Man griff zu und konnte den Premierentermin mit der hauseigenen Sängerbesetzung halten. Natürlich war mit dieser eher betulichen Arbeit keine Sensation zu locken. Düggelin hatte sich für die vieraktige italienische Fassung entschieden, die Giuseppe Verdi nach Umarbeitung seiner fünfaktigen französischen Version für die Pariser Opéra von 1867 in der Mailänder Scala 17 Jahre später herausbrachte: Eine Entscheidung für den Verzicht auf den Fontainebleau-Akt, der die Vorgeschichte des Infanten Don Carlo und der französischen Königstochter Elisabeth von Valois als junge Liebende am französischen Hof erzählt. Sie macht den seelischen neben dem politischen Konflikt verständlich, in den die beiden sich verstrickt finden, wenn sie sich in Spanien als Stiefmutter und -sohn wiederfinden, nachdem Carlos Vater, König Philipp II., dem Sohn die Geliebte weggeheiratet hat. Neben den logischen Handlungsabläufen gibt es gute musikalische Gründe, die ungekürzte Fassung zu wählen. Die Mannheimer Lösung ist dadurch schon im Ansatz etwas altbacken, ohne deshalb uninteressant zu sein. Düggelin verstand es, die ausweglose Tragik der menschlichen Beziehungen in der Verflechtung von Liebesaffäre und Staatsaktion zu zeichnen, konzentriert in einem Einheitsbühnenbild, das, in dennoch lästigen Umbaupausen, Verwandlungen erlaubt, unterstützt von einer bisweilen biederen Lichtregie. Eine ruhige Erzählung, durchpulst vom idealistischen Pathos der Schillerschen Schauspielvorlage, in die sich das Mannheimer Sängerteam gut einfügte. Zu nennen sind vor allem die großartige Susan Maclean als intrigante und reuige Prinzessin Eboli, der die annoncierte Indisposition kaum anzumerken war; Galina Shesterneva als liebende und leidende Elisabeth; der Bassist Mihail Mihaylov als Philipp II., dessen Fülle an Wohllaut leider unter der mitgeteilten Erkältung litt, und Michail Agafonov in der Titelrolle, mit seiner schönen Tenorstimme, die nach anfänglichen Nervositäten aufblühte, der aber durch eine Art rote Strampelhose eher ins unfreiwillig komische Fach der historischen Carlos-Figur verwiesen wurde. Eine Verwechslung von "Infant" mit infantil? Das Orchester unter dem Dirigat des im italienischen Fach erfahrenen Enrico Dovico, bis 2001 am Staatstheater Wiesbaden tätig, begleitete aufmerksam, wenn auch anfänglich knallig auftrumpfend, als wäre eine "banda" des frühen Verdi in der Partitur verordnet. Am Ende, als sich das Bündnis von Thron und Altar wieder einmal bewährt hat und Carlo gefasst seiner Hinrichtung entgegensieht, muss er durch viel Bühnennebel dem Ruf seines längst verblichenen Großvaters Karl V. ins Jenseits folgen. Ein überzogen konventionelles Schluss tableau für eine Inszenierung, die konsequent das "Regietheater" meidet, ihre Meriten hat und sicher ihre zahlreichen Freunde finden wird. EBERHARD MITTWICH |
|
Sterbenslangweilig und unsensibel Von Carsten Neudorf Überall, wo Calixto Bieito inszeniert, hört und liest man von heftigen Reaktionen am Premierenabend, von tumultartigen Szenen im Publikum und erbitterten Auseinandersetzungen in der Presse angesichts seiner am sozialen Alltag orientierten extremen Bilder voller Gewalt und Sexualität (Ortsansässige erinnern sich an das Theater um die angekündigte und dann wegen des öffentlichen Drucks dann doch nicht realisierte Neuinszenierung der Meistersinger von Nürnberg). Und so wird es manchem Opernfreund in Mannheim vermutlich gar nicht unrecht gewesen sein, dass der Spanier die Regie von Verdis Don Carlo aus persönlichen Gründen zurückgeben musste. Guter Rat war teuer, die Zeit drängte, und so war man froh, dem Publikum Werner Düggelins am 20. Januar 2001 in Zürich herausgekommene Inszenierung präsentieren zu können. Den zentralen Eindruck fasste der mit Ende der Spielzeit scheidende Generalintendant Ulrich Schwab während der anschließenden Feier zusammen, als er von einer Produktion sprach, die man sich als Folie für viele Festliche Opernabende vorstellen kann, also jene in Mannheim so beliebte Galaveranstaltungen, bei denen prominente Gäste, die sich häufig im Spätherbst ihrer Karrieren befinden oder kaum das Niveau erreichen, das man angesichts ihrer massiv beworbenen Tonträger erwarten würde, für teures Geld die Rollen von Ensemblemitgliedern übernehmen. Um sich in diesem Don Carlo zurecht zu finden, reicht vermutlich ein kurzes Gespräch mit dem zuständigen Abendspielleiter, denn eigentlich wird kaum mehr erwartet, als sich in Kostümen von Sue Willmington, die sich zwischen historischen Roben und Alltagskleidung unserer Tage nicht hatte entscheiden können, und in dem die meiste Zeit sehr dunklen Szenenbild von Raimund Bauer (mit breitem schwarzen Rahmen, was den Verdacht nahe legt, dass die Schweizer Bühne erheblich schmaler ist als diejenige des Nationaltheaters) in Richtung Rampe zu bewegen und sich auf eigene, die Intensität des Vortrags unterstreichende Gesten zu besinnen. Dass der Ausstatter eine Art Arena, einen Kampfplatz der Liebe gegen die Politik, der Machtauseinandersetzungen, Intrigen und Konventionen, im Sinn hatte, einen Raum, der die Spannung zwischen den beiden Polen der Oper - private Liebesgeschichte und große Staatsaktion - bildlich umsetzte, wusste ich glücklicherweise aus den Presseinformationen. Durch die schwarzen, gleichmäßig durchlöcherten und damit für die unsichtbaren Spitzel der Inquisition durchlässigen Wände, die die mit edlem Parkett ausgelegte, durch ein Paar Stufen unterbrochene und in der Mitte einen Kreis aufweisende Spielfläche wie ein Gefängnis wirken lassen, bricht sich stimmungsvoll ein wenig Licht, die aufgestellten Kerzen und später Kandelaber tun das ihre, ein paar schlampig aufgehängte Prospekte im Bühnenhintergrund skizzieren verschiedene Handlungsorte (wie etwa die sanften Hügel der Extremadura), das von allen Hofdamen bestickte Tuch mit Fontainebleau-Bild reflektiert Elisabeths Sehnsucht nach der Heimat und die Erinnerungen an die kurze Romanze mit Carlos, der der Zuschauer in der vieraktigen Fassung nicht beiwohnt. Zentrum und beherrschendes Handlungsmoment der Oper sollte dem Vernehmen nach das Autodafé als Sinnbild einer Welt voller Gewalt und Zerstörung sein, als Chiffre für den Kampf des Menschen gegen den Menschen - gerade diese Szene aber habe ich selten so konventionell, vordergründig und langweilig gesehen und so grob und oberflächlich musiziert gehört, zumal auch die Einstudierung des Chores, der sicher einiges Potential hat, einmal mehr die nötige Disziplin und Differenzierung vermissen ließ. Besonders ärgerlich fand ich aber die mangelnde Personenführung: Willy Decker etwa hatte sich in der letzten Spielzeit in seiner Neuinszenierung in Amsterdam auch nicht als Bilderstürmer und Anhänger eines hektischen Aktionismus erwiesen, hatte aber die Befindlichkeiten der Figuren und ihr Mit- und Gegeneinander nachvollziehbar bebildert. Bei Walter Düggelin sitzt Carlo völlig unbeteiligt am linken Bühnenrand (hat er wie mancher Zuschauer den lauen Schuss überhört?), während Posa im hinteren Teil der Szene bei schlechtem Licht sein Leben aushaucht, und auch die Idee, Elisabeth am Ende Carlos ins Kloster folgen zu lassen, fand ich kaum abendfüllend, und das nicht nur, weil die Nebelmaschine des Nationaltheaters nicht die beste ist. Über die sterbenslangweilige Inszenierung hätte man wohl hinweggesehen, wäre es um die musikalische Seite besser bestellt gewesen. Enrico Dovico, seit September 2002 immerhin Stellvertretender GMD des Traditionshauses, wurde zwar vom Generalintendanten für seine "italienische" Herangehensweise an das Stück über den grünen Klee gelobt, störte aber in erster Linie durch viel zu häufige, unsinnige Rubati und Fermaten ganz erheblich den Fluss der Musik, verhinderte dadurch jede Spannung und machte zudem den Sängerinnen und Sängern das Leben unnötig schwer, denen die mitunter geradezu knallige Lautstärke auch nicht entgegenkam und die man alle in der Vergangenheit viel besser gehört hat. Besonders Susan Maclean, die am selben Ort als Didon in Les Troyens einen so exzellenten Eindruck hinterlassen hatte, und eigentlich eine Idealbesetzung für die Eboli sein dürfte, hatte unter der Willkür des unflexiblen Dirigenten zu leiden. Die Mezzosopranistin hatte sich vor der Vorstellung ansagen lassen, weil sie sich nach eben überstandener Grippe und anstrengenden Proben (anders als die anderen Rollen war diese als einzige nicht doppelt besetzt) nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte fühlte. Das Maurische Lied bewältigte sie zwar noch mit schlankem, metallischen Ton, erstaunlicher Agilität (was man da sonst mitunter zu hören bekommt, vor allem in der Kadenz!) und auffälliger Textdurchdringung und übertraf die Kollegen auch hinsichtlich des darstellerischen Einsatzes, der Identifikation mit der Rolle und der daraus resultierenden szenischen Präsenz, geriet aber durch die brutal zerdehnten Tempi im "O don fatale" in hörbare vokale Not besonders in der sonst doch so leicht ansprechenden Höhe - ein einfühlsamer Begleiter hätte das Tempo angezogen und das Orchester nicht ausgerechnet hier sehr gedämpft spielen lassen, damit die Sängerin sich hätte schonen können! Dass Galina Shesterneva zuletzt als Leonora in Bonn mehr zu überzeugen wusste als an diesem Abend als Elisabetta, liegt natürlich in erster Linie an der Rolle, die in der vieraktigen italienischen Fassung wenig Möglichkeiten der Profilierung bietet, zumal wenn in der ersten Arie auch noch die zweite Strophe gestrichen wird. Große Leidenschaft entwickelte die Sopranistin allerdings in der Auseinandersetzung mit Philipp im dritten Akt, und im anschließenden Quartett gelangen ihr wie später in der großen Szene einige wirklich berückende Töne, wie man überhaupt angesichts ihres herrlich femininen, nicht zu üppigen Soprans, der für die flammenden Phrasen des letzten Duetts wie geschaffen ist, immer wieder ins Schwärmen kommt. Michail Agafonov, der auch schauspielerisch sensationelle Enée der erwähnten Troyens-Produktion und mit seinem süchtig machenden Timbre inzwischen mehr als ein Geheimtipp für das (vor allem italienische) dramatische Tenorfach, blieb in der Titelpartie überraschend blass, was meinen Eindruck untermauert, dass der Russe einen versierten Regisseur braucht - und sicher keine rote Samthose und ein kurzes schwarzes Oberteil, das trotz verlorener Pfunde nicht eben vorteilhaft wirkt. Und auch die Spitzentöne hatten an anderen Abenden mehr Glanz und wurden mit weniger Kraft erreicht. Mit großer Routine bemühte sich Mikel Dean um die Partie des Posa, wusste auch die Feinheiten auszuführen und beschränkte sich nicht auf kraftvollen Fortegesang, sondern fühlte sich auch im Piano wohl, aber mir fehlte die dunkle Farbe, die südliche Sonne in der Stimme, was natürlich Geschmackssache ist, und spätestens in der langen Sterbeszene kämpfte der Amerikaner dann auch mit kleineren Konditionsproblemen. Mihail Mihaylovs reifem Bass war die angesagte Indisposition kein bisschen anzuhören (man fragt sich grundsätzlich, warum in solchen Fällen nicht der Kollege gefragt wird, der doppelt besetzt ist!), so dass die große Szenen des dritten Aktes ihre Wirkung nicht verfehlten, auch wenn sensible Hörer den veristischen Zugang, einige rhythmische Freiheiten und den Rückgriff auf Sprechgesang beklagen mochten. Großes Potential ließ Fachkollege Tomasz Konieczny mit seiner robusten, ausladenden, üppigen Stimme als Großinquisitor erkennen; der junge Pole sollte allerdings weiter an seiner Diktion arbeiten und darauf achten, nicht alle Vokale als Einheitslaut zu präsentieren. Daneben waren Marina Ivanova ein diskreter Tebaldo, Thomas Jesatko mit klangvollem Material ein prägnanter Mönch (und Karl V. im Finale), während Iris Kupke das rechte flinke, frische Organ für die Himmelsstimme hatte und Souffleur Günther Michelsen auch große Teile des Zuschauerraums zur Mitwirkung reizte. FAZIT |