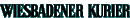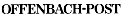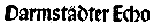|
Tun Sie's in den schwarzen Sack Er stelle die entferntesten Tonarten völlig ungerührt übereinander und kümmere sich nicht darum, ob sie die Ohren beleidigen könnten, sondern verlange von ihnen "Lebendigkeit und nichts als Lebendigkeit", bemerkte Debussy über Richard Strauss. Am radikalsten tat Strauss dies in der "Elektra", deren dissonanzreiche Harmonik immer wieder auf dem Sprung ist, die Grenzen der Tonalität vollends aufzulösen. Kühner noch als in der vorausgehenden "Salome" hat er den musikalischen Ausdruck hier in Extreme getrieben, an die er später nicht mehr rühren mochte: Auf die 1908 vollendete "Elektra" folgte zwei Jahre später die süße Rokoko-Kunstwelt des "Rosenkavaliers". Die "psychische Polyphonie" (Strauss) des "Elektra"-Expressionismus in schrill betonten Dissonanzen und einem kontrastreich zersplitterten Klangbild mit wild gezackter Agogik drastisch auszumalen gehört heute beinahe schon zum guten Ton einer jeden Aufführung, und tatsächlich kann man den Avantgardismus des Werkes auf diese Weise plakativ herausstellen. Doch die Verwandtschaft zum Schönberg der "Erwartung" ist nur eine Seite der janusköpfigen Musiksprache von Strauss. Auf die andere hat wiederum Debussy mit subtiler Ironie angespielt, als er die Physiognomie des Künstlers verglich mit der "freien und bestimmten Haltung jener großen Forscher, die mit einem Lächeln auf den Lippen die Gebiete wilder Völkerschaften durchziehen". Selbst die riskante Expedition, die Strauss in die Abgründe von Elektras schwarzer Seele unternimmt, scheint noch geprägt von dieser unerschütterlichen Miene: Aller Hang zum Amorphen ist hier fundiert durch kindlichen Überschwang, Sensualismus steckt noch in den dissonantesten Klängen, während es kehrseitig dazu gerade die Schönheit mancher unwiderstehlichen harmonischen Süße ist, die zur Entgrenzung tendiert. In der Frankfurter Oper hat Paolo Carignani mit dem sensibel reagierenden Museumsorchester nun die melancholisch-sinnliche Seite der wilden Rachefurie betont, indem er die Anweisung des Komponisten, man solle die "Elektra" dirigieren, "als sei sie von Mendelssohn: Elfenmusik", beim Wort nahm. Zu hören war eine ungewohnt strömende, klanglich homogene und lichtdurchflutete "Elektra", eine Musik, die überfließt vor Sehnsüchten und aus diesem Überfließen ihre Form gewinnt. Deutlich wurde, daß im Straussschen élan vital anderes steckt als eine irrational-vitalistische Feier des Lebens: Zielt er doch unmittelbar in die Utopie sinnlicher Erfüllung und ist von seinem Gegenbild, jenen Phasen der Auflösung, in denen Adorno Momente einer "unauslöschlichen Erfahrung im Zerfall" sah, nicht zu trennen. Diesen verlieh das Orchester nun - etwa im flüchtigen Herumwirbeln verstreuter Motivreste am Ende der Mägdeszene - eine fast impressionistische Duftigkeit und Naturnähe, statt Disparatheit und Zersplittertheit des Klangbildes zu unterstreichen. Wie aus versunkenen Urzeiten tönt das Agamemnon-Motiv in der folgenden Szene herauf, traumschwer, dunkel und verheißungvoll auch in der eher zärtlichen denn herrischen Anrufung des toten Vaters durch die Tochter. Denn in idealer Harmonie mit Carignanis differenzierter Deutung formt auch die fabelhafte Susan Bullock aus der Titelpartie kein kreischendes Mannsweib, sondern eine in ihrer Trauer gefangene, von unendlich unerfülltem Verlangen getriebene und umgetriebene Frau. Sie tut dies mit warm flutendem, vollem Soprantimbre, großer Nuancierungskraft und vorbildlicher Textverständlichkeit. In dieser Elektra pulsiert die Leidenschaft keine Spur weniger als in der ängstlich ihrem ersehnten "Weiberschicksal" entgegenfiebernden Chrysothemis der wohlklingend und artikuliert singenden Ann-Marie Backlund. Auch den weiteren Partien wird musikalisch erfreuliche Vielschichtigkeit abgewonnen: Ingrid Tobiasson singt die Klytämnestra, Peteris Eglitis den Orest, Hans-Jürgen Lazar den Ägisth. Von den Überlegungen, die in der musikalischen Interpretation spürbar werden, macht die Inszenierung Falk Richters kaum etwas sichtbar. Im Bühnenbild von Alex Harb, einer Art Gefängnishof in üblicher Gerüst-Optik, bleibt von der Suggestivität des Mythos und vom Raffinement der Hofmannsthalschen Dichtung (von den Finessen der Partitur ganz zu schweigen) nichts mehr übrig - allem großzügig vergossenen Bühnenblut zum Trotze. Hilflos hangelt sich der Regisseur an den unbestreitbaren Tatsachen der Handlung entlang und entwirft ein unspezifisches Allerweltsszenario der Gewalt und der Unterdrückung. Zahllose Statisten müssen her, um dieses zeitgemäß zu illustrieren. So wird der Hof Mykenes bevölkert von Gefangenen, deren Köpfe in schwarzen Säcken stecken, bloß weil das auf den amerikanischen Folterbildern auch so war: "must-have" einer sich progressiv gebärdenden Regie, die belanglos bleiben muß, da sie die Dinge in penetranter Eindimensionalität vorbuchstabiert: Ägisth ist ein Depp, der bei seinem Auftritt sogleich stolpert, Chrysothemis bieder, Elektra blutrünstig, und der arme Orest sieht aus wie einer, der Taxifahrer überfällt. Die Furien dürften an ihm aber wohl kaum ein Interesse haben. JULIA SPINOLA |
|
Das Blut, so rot, so schön VON HANS-KLAUS JUNGHEINRICH Sie kommen von hinten und schütten eimerweise das Blut aus, es ergießt sich durch den Rost des Steges und bleibt unterhalb in Lachen stehen. Das ist erst der Anfang. Später, wenn in Falk Richters Frankfurter Neuinszenierung der Elektra von Strauss und Hofmannsthal das große Blutbad anhebt mit der Tötung Klytemnästras, Ägisths und ihrer Parteigänger, fließt noch mehr von dem schönen roten Blut, das den Boden tränkt und die Rache kühlt. Viel muss es sein, denn die Rache ist groß. Der seit 1908 so klotzig in der Operngeschichte dastehende Einakter ist mit seinem Zug ins Gewaltige und Gewaltsame wohl auch so etwas wie das musikdramatische Eingangsportal in ein Zeitalter der Extreme. Falk Richter, Schauspielregisseur und Dramatiker, begnügt sich freilich nicht mit einem schäumenden Blutmysterium aus der Naturgeschichte des Menschen oder einer (wie Hofmannsthal es meinte) vom verbürgerlichten Humanismus abgerückten Antikensicht. Er avisiert politisches Theater. Und zeigt mit beklemmender Treffsicherheit, wie einfach das Stück Elektra sich in diesem Sinne aktualisieren lässt. Schreckensszenarien Mit Guantánamo und den Folterkammern Bagdads gibt es nun neue, die unmittelbare Gegenwart tangierende Schreckensszenarien, die ins Bewusstsein der ganzen Welt eindrangen und dabei als Chiffren des hautnah größtmöglichen Horrors die Erinnerung an nationalsozialistische Konzentrationslager zu verdecken drohen. Während diese, wie die Berufung auf das Monstrum Hitler und die Nazi-Embleme, leicht etwas Exotisch-Pittoreskes, mit unserer alltäglichen Realität kaum noch glaubwürdig Vermittelbares annehmen (so dass sich der geoutete Neonazismus gesellschaftlich unschwer ausgrenzen lässt), bedeutet das humane Desaster von heute die Hinfälligkeit christlicher Zivilisierung, einen perversen Triumph der Hofmannsthalschen Antikenvorstellung. Elektra in Guantánamo, zwei Tragödien in einer. Der aktuelle Schuldzusammenhang, in den der Westen sich verstrickte, so (scheinbar) unausweichlich wie derjenige der mörderischen Atriden. Elektra in Guantánamo. Falk Richter erzählt diese Geschichte im nüchtern-kahlen Gefängnisbühnenbild von Alex Harb mit schlichter Folgerichtigkeit, lässt den Großteil des Geschehens zudem auf der finster gehaltenen Vorderbühne spielen. Nur manchmal öffnet sich ein großes Tor und gibt den Blick auf einen Hof frei. Von da hat Klytemnästra ihren spektakulären Auftritt, flankiert von Schergen und Opfern, letztere anonymisiert mit in Säcke gesteckten Köpfen. Am Schluss werden massenhaft Getötete in Leichensäcken hereingetragen und am Laufsteg aufgereiht, zwei schauerliche Kadaver baumeln nackt an Fleischerhaken. Die geschlachteten Soldaten Klytemnästras werden von der nun zur Siegerpartei gehörenden Elektra in ihren Säcken dithyrambisch gezerrt und getreten. Elektras finale Tanz-Apotheose, bestialischer Triumph des erfüllten Willens, kann hier gar nichts anderes sein als eine monumentale Schändung. Die Oper beginnt mit dem erregten, streitsüchtigen Gespräch der fünf Mägde und ihrer Aufseherin, einem sprachmusikalisch genial ins Melodramatisch-Exaltierte ausgreifenden Entrée. Georg Solti (um bei Frankfurter Dirigentenbeispielen zu bleiben) dirigierte es in bedrohlicher Nervosität, markierte Höchstspannung vom ersten Takt an. Christoph von Dohnányi blieb fester, sozusagen angesteifter in seiner vehement trockenen preußischen Brillanz. Deutlich anders nun der jetzige Frankfurter GMD Paolo Carignani, der sich zunächst noch schlenkernd und schlendernd locker anschickte, auch dem nachfolgenden Elektra-Monolog durch Neigung zum Temponachgeben noch wenig eherne Faktur gab. Strauss' Selkbstkommentar "Operette mit tödlichem Ausgang" mochte für ihn Richtschnur sein, zuerst mehr "Operette", den tödlichen Ausgang sparte sich Carignani für später. Dem fulminanten Sog der Musik folgten er und das exzellent disponierte Orchester nach und nach, auch durch die lyrischen Ausbuchtungen der Erkennungsszene Elektra/Orest, und mit dynamischem und expressiven Surplus in den immer turbulenteren, frenetisch die Düsternis aufreißenden und anders, nämlich triumphalistisch, katastrophischen Schlussphasen. So war auch dies, zumal in ihrem pfleglichen Eingehen auf die Sängerdiktion, eine sehr persönliche und überzeugende Wiedergabehaltung. Militärisch angehaucht Die Sängerdarsteller zeigten sich den Ansprüchen gewachsen. Susan Bullock war eine vom Timbre her auffallend helle, mitunter etwas flach intonierende, aber unermüdet präsente Elektra, eine permament von Unruhe getriebene Mänade im Kampfanzug. Militärisch angehaucht immerhin auch das olivgrüne Kostüm der Chrysothemis von Ann-Marie Backlund, deren betont frauliche Ausstrahlung (von der Sängerin in weiträumigen kantablen Bögen realisiert) durch tüttelige Bewegungen und Trippelschritte leicht übertrieben anmutete. Phänomenal die Figur der äußerst körperbewusst agierenden Klytemnästra in flammendrot engem Kleid (Kostüme: Martin Kraemer) und bis zu den Füßen reichender Glitzerkette. Ingrid Tobiasson sang die fatal-effektvolle Partie mit differenziertem, vom Süßlichen bis zum Schrillen (aber unoutriert) reichenden Duktus. Gespannte Ruhe und baritonaler Wohllaut beim Orest von Peteris Eglitis. Ein Kabinettstückchen für sich der mit grellen tenoralen Spitzen wohlüberlegt umgehende Ägisth von Hans-Jürgen Lazar. Einhelliger Premierenjubel. Oper Frankfurt: 7., 9., 14., 16., 20., 23., 28., 31. Oktober. [ document info ]Copyright © Frankfurter Rundschau online 2004 Dokument erstellt am 03.10.2004 um 17:20:25 Uhr Erscheinungsdatum 04.10.2004 |
|
Rasender Hass: Susan Bullock als Elektra. Aumüller Terror im Schlachthaus Von Volker Milch Die Formen der Gewalt polarisieren sich: Auf der einen Seite die vollelektronische Kriegsführung, auf der anderen Seite die vermeintlich atavistische Handarbeit, deren blutrünstige Exzesse wiederum nur durch die Massenmedien und das Internet an ihr Ziel kommen. Es liegt viel Angst und Blut in der Luft, und diese Stimmung der Bedrohung greift der Regisseur Falk Richter in seiner Frankfurter Inszenierung der "Elektra" von Richard Strauss sehr konkret auf: Der Mythos legt auch noch den letzten Rest des Faltenwurfs ab, und das Blut wird von den Mägden gleich Eimerweise in den Ausguss eines modernen Schlachthauses gekippt. Da sieht man dann, wie es unter dem Laufsteg des Grauens fließt und fließt und die Handlung der Tragödie grundiert, in der ja oft genug vom Schlachten die Rede ist. Es mag ein bisschen dick aufgetragen erscheinen, wie Elektra in Frankfurt das Beil schwingt oder Kadaver an den Haken genommen werden: Aber omnipräsente Bild-Fragmente der Wirklichkeit zwischen Leichensäcken, Guantanamo-Overalls und Bombenopfern werden von Falk Richter und Bühnenbildner Alex Harb so montiert, dass sie unter die Haut gehen, vielmehr vom Klang der Angst unter die Haut getrieben werden: "Begeistert" lässt sich der starke Applaus in der Oper Frankfurt irgendwie nicht nennen. Die Gewalttätigkeit selbst schien auf ihn abgefärbt zu haben, so heftig wurden da Handflächen aneinandergeschlagen. Der Einakter von Hofmannsthal und Strauss passt wohl zeitlos gut in Endzeitstimmungen - und verfehlt auch bei einer an sich konventionellen, zur Bilderwelt manchmal kontrastierenden Personenführung, in der gerne frontal an der Rampe gesungen wird, seine Wirkung nicht. Allerdings steht in Frankfurt auch ein potentes Ensemble und ein von Generalmusikdirektor Paolo Carignani vehement durch den düsteren Klangraum getriebenes Orchester zur Verfügung: Susan Bullock ist eine kraftvolle, sich im Verlauf des Abends auch noch steigernde Elektra. Die Selbstauflösung im Hass betreibt sie mit hoher Intensität und erfährt dabei vom Orest des Peteris Eglitis wuchtige, terroristische Unterstützung: Sein Umgang mit Pistole und Schalldämpfer lässt darauf schließen, dass ihm das Handwerk vertraut ist. Stimmlich blendend die Chrysothemis der Ann-Marie Backlund, Ingrid Tobiassons vor Angst schlotternde Klytämnestra und Hans-Jürgen Lazar als jämmerlicher Ägisth: Es ist Schlachttag. Im solchermaßen globalisierten Atriden-Drama wird es wohl kaum ein Ende geben. |
|
Opern-Szenario wie im Horrorfilm "Wir schlachten, schlachten, schlachten Opfer. Überall in den Höfen liegen Tote. Alle, die leben, sind mit Blut bespritzt." Das klingt nach Horrorfilm oder Gruselroman. Tatsächlich aber sind es Exzerpte aus Hofmannsthals Libretto zu Richard Strauss’ Musikdrama "Elektra". Selten ist einem das hohe Potenzial an Gewalt in diesem Einakter so drastisch vor Augen geführt worden wie jetzt in der ersten, von Falk Richter inszenierten Spielzeit-Premiere der Oper Frankfurt. "Gepresster Atem und Röcheln von Erwürgten, nichts Andres gibt’s in diesen Mauern": Bevor überhaupt Maestro Paolo Carignani den ersten Einsatz gibt, versetzen uns diese Schlagzeilen vom roten Leuchtschrift-Band in ein Spektakel, das mehr an Doktor Caligaris Schauerkabinett erinnert als an den antiken Mythos um Vater- und Muttermord. Dabei ist streng genommen nur das modernisierte Setting samt einer Vielzahl von Hinzurichtenden und Todesopfern das eigentlich Neue. Richters Personenführung in den entscheidenden Dialogen wirkt in ihrer teilweisen Statik etwas schwach, kaum anders als andere, vermeintlich konventionellere Inszenierungen. Psychologisch gewinnt er aus dem Drama keine neuen Erkenntnisse. Alex Harbs Bühne ist ein kalter Bunker mit stählernem Boden und einer Art Blutwanne darunter. Vor dunklen Mauern und Türen, die sich erst beim Auftritt der von ihrem schlechten Gewissen und Alpträumen geplagten Mutter zu beiden Seiten in einen gleißenden Hinterraum öffnen, schmiedet die um ihren toten Vater trauernde Elektra Rachepläne. Sie hat nicht nur das Beil versteckt, mit dem sie Agamemnons Tod sühnen will, sondern auch den Mantel des Vaters, den sie wie eine Schutzhülle hütet. Doch "Elektra" ist bei Falk Richter nicht allein ein Familiendrama. Am Hof der Monarchin wird allenthalben gemordet. Schon zu den ersten schrillen Orchesterklängen schütten Mägde eimerweise Blut aus. Noch deutlicher wird dies bei Klytämnestras großem Auftritt. "Und suche, wer bluten muss, damit ich wieder schlafe". Die monströse Monarchin im blutroten Kleid (Kostüme: Martin Kraemer) begleitet nicht nur ihr Gefolge, vielmehr eine kopflose gespenstische Masse von Todeskandidaten mit schwarzen Henkersmützen. Solche Szenarien müssten doch eigentlich schockieren, beklemmen oder aufrütteln. Dass einen das alles seltsamer Weise eher kalt ließ, mag an der Künstlichkeit einer Inszenierung liegen, die haarscharf an der Geschmacklosigkeit vorbeischrammt. War es letztlich die Intention Falk Richters, die Abgestumpftheit angesichts nahezu alltäglich gewordener Bilder der Gewalt zu dokumentieren? Die Frage blieb offen. Einig dagegen war sich das Premierenpublikum über die großartigen musikalischen Leistungen: Susan Bullock verfügt über einen strapazierfähigen Sopran mit großer Durchschlagskraft. Und doch ist sie, durchaus glaubwürdig, schon rein äußerlich eine ganz andere, mädchenhaftere, weniger brachiale Elektra als berühmte Vorgängerinnen. Eine große Entdeckung ist auch Ingrid Tobiasson als Klytämnestra, ein wunderschön timbrierter kraftvoller Mezzo. Ann-Marie Backlund besitzt zwar im Damentrio die kleinste Stimme, ist aber bestens prädestiniert für die zartere, noch lyrischere Chrysothemis. Hans-Jürgen Lazar (Ägisth) und Peteris Eglitis (Orest) komplettieren das hochwertige Ensemble. Auch das Museumsorchester zeigte sich bestens disponiert. KIRSTEN LIESE |
|
Großer Jubel zur Premiere: Falk Richter hat Richard Strauss’ "Elektra" für die Oper Frankfurt fesselnd in Szene gesetzt. Von Michael Dellith Es sind die täglichen Fernsehbilder aus Afghanistan, dem Irak und aus Israel, die dieser Abend im Kopf hervorrief: Eindrücke von Gewalt und Terror, Angst und Krieg, Grauen und Entsetzen. Dabei hat sich der vor allem als Schauspielregisseur und Theaterautor ("Gott ist ein DJ") etablierte Falk Richter nicht dazu verleiten lassen, solche Bilder auf eine Videoleinwand zu projizieren, wie das manche Kollegen tun. Die Assoziationen stellten sich zwangsläufig ein, weil es dem Regieteam mit Bühnenausstatter Alex Harb und Kostümbildner Martin Kraemer gelungen ist, ganz auf die Kraft des Hofmannsthal’schen Textes und der Strauss’schen Musik zu vertrauen. Der Versuchung, die archaische, bis ins Extrem gehende Sprache noch durch eine zusätzliche Bilderflut toppen zu wollen, erlag Richter nicht – das Ausleeren der Bluteimer zu Beginn und die aufgehängten Leichen über den mit Menschenopfern gesäumten Laufsteg am Ende waren die provokantesten Bilder dieser Inszenierung. Vielmehr stellte Richter die zeitlose Aktualität dieses Stoffs heraus, verknüpfte Fin de Siècle mit moderner Endzeitstimmung. Denn – so die Botschaft des Regisseurs – die Blutspur aus Gewalt und Gegengewalt, aus Verzweiflung und Hass führt wie in einem Teufelskreis aus der Vergangenheit über die Gegenwart in die Zukunft und wieder zurück. Natürlich steht auch bei Richter die Rache der Elektra am ungesühnten Mord des Vaters durch ihre Mutter Klytämnestra und dessen Liebhaber Ägisth im Zentrum des Geschehens. Es geht dem Regisseur aber auch um die gesellschaftliche Komponente dieser Tragödie. Beides sinnfällig miteinander zu verschränken, ist ihm geglückt. Beklemmend gestaltet sich das Bühnenbild mit einer schwarzen Torwand und einem Stahlgitterboden, der über den Orchestergraben ragt. Arbeitslager? Frauengefängnis? Hochsicherheitstrakt? Guantanamo Bay? Hier muss Elektra, die Ausgestoßene, wie ein Tier vor sich hinvegetieren, traumatisiert durch den Tod des abgöttisch geliebten Vaters, zerrissen zwischen selbstzerstörerischer Trauer und aggressivem Rachewahn. Die englische Sopranistin Susan Bullock verkörperte die Titelfigur nicht nur stimmlich, sondern auch gestisch mit faszinierendem dramatischen Furor. Als lichte Gegengestalt zur Elektra hat Strauss die sich nach Mutterglück sehnende Schwester Chrysothemis entworfen – eine kaum weniger anspruchsvolle Partie, die das Frankfurter Ensemblemitglied Ann-Marie Backlund mit Bravour meisterte. Starke Bühnenpräsenz verlieh die Schwedin Ingrid Tobiasson der blutrot gewandeten und mit überdimensionierter Glitzerkette geschmückten Klytämnestra. Doch der Stolz und das Machtgehabe dieser Frau stehen auf wackeligem Boden. Zu sehr wird sie von ihren Gewissensbissen gepeinigt. Männlich markant füllten Peteris Eglitis als Orest und Hans-Jürgen Lazar (Ägisth) ihre Partien aus. Dass die durchweg mit hoher Intensität agierenden Solisten auf der Bühne meist gut verstanden werden konnten und nie vom Orchester übertönt wurden, ist nicht zuletzt ein Verdienst von Paolo Carignani. Er hatte das Museumsorchester auf die Klippen der Strauss’schen Partitur bestens vorbereitet. Seine dynamische Feinabstimmung zeugte von einer klugen Gesamtdisposition dieses immerhin 100-minütigen Klangkontinuums, dessen Höhepunkte wohl kalkuliert waren. Noch größeres Lob gebührt Carignani aber dafür, dass er die dissonanten Härten und die schrillen Klangkonstellationen dieser kühnen Musik nicht über Gebühr zuspitzte, sondern es beim ohnehin schon starken naturalistischen Ausdruck beließ. Das Publikum zeigte sich begeistert. |
|
Blutig und brutal Oper: Trojanische Kriege heute: Falk Richter inszeniert in Frankfurt „Elektra" von Strauss Von Albrecht Schmidt FRANKFURT. Eine derart einmütig begeisterte Zustimmung für Musik und Szene wie bei der Premiere von Richard Strauss’ „Elektra" gibt es selten. Der junge Regisseur Falk Richter nutzt sein Frankfurter Debüt zu einer Inszenierung, die keine Rätsel aufgibt, sondern mit brutalem Realismus aufwartet. Nicht Kenntnisse der antiken Mythologie werden vermittelt, sondern das, was aus heutiger Sicht aus den Archetypen geworden ist. Der Königspalast von Mykene ist ein gefängnisartiger Herrschaftsbunker (Bühne: Alex Harb). Schwere Eisentüren schieben sich über ein Laufgitter, das bis über den Orchestergraben gebaut ist und den Sängern einen vorteilhaften Rampenplatz bietet. Diese „Elektra" von Strauss und Hugo von Hofmannsthal ist ein Stück, in dem Morden neues Morden erzeugt. Richter zeigt, dass die Spirale der Gewalt nicht nur ein Phänomen des Trojanischen Krieges ist, sondern zu unserem Alltag gehört, wie die Ereignisse in Afghanistan, Tschetschenien, Zentralafrika, Kosovo, Gazastreifen oder Falludscha belegen. Eimerweise schütten die Mägde das Blut gemordeter Regimegegner durch das Metallgitter in die Ablaufrinne. Im Verlauf von Klytämnestras Auftritt werden die nächsten Opfer – mit orangefarbenen Overalls (Kostüme: Martin Kraemer), vermummten Köpfen und gefesselten Händen wie die Häftlinge in Guantanamo-Bay – zur Exekution hereingeführt und zu Dutzenden entlang des Laufstegs aufgereiht. Orest erscheint als Guerilla-Krieger und liebkost in der packend inszenierten Erkennungsszene seine Schnellfeuerwaffe inniger als seine Schwester Elektra. Das Ende wird zum Fanal: Orests blutbespritzte Brigade schleppt in Folie verpackte Mordopfer wie Schweinehälften herein. Die verkohlten Überreste von Klytämnestra und Ägisth baumeln an Fleischerhaken, und Elektra stolpert, ihr Rache-Beil schwingend, in einem makabren Tanz über die Leichen zu Tode. Paolo Carignani am Dirigentenpult lockt die passenden Töne zu diesem grellen Katastrophenszenario aus der Partitur. Paukenschläge knattern wie Gewehrsalven, schrille Akkorde schneiden durch das Klangbild des Riesenorchesters wie scharfe Schlachtermesser. Umso eindrucksvoller ist Carignanis Fähigkeit des Abdämpfens, des Herausarbeitens feinster kammermusikalischer Details, die den Sängern zugute kommen. Susan Bullocks Elektra lässt neben kraftvollen Spitzenattacken auch fragile Töne hören. |
|
DER TAGESSPIEGEL Schockierende Siegestänze Von Sybill Mahlke Leichen säumen Elektras Triumph. Das ist das Ende, wenn die Toten in schwarzen Säcken gereiht werden oder verstümmelt an Haken baumeln. Eine Konsequenz des alltäglichen Grauens. Zunächst empfängt den Zuschauer in roter Leuchtschrift über unbehauster Bühne eine Folge von Textpassagen aus „Elektra". Er wird auf die Extreme der Dichtung Hofmannsthals gestoßen, noch ehe ein Ton der Partitur erklingt. Zum Beispiel: „Und über Leichen hin werd ich das Knie hochheben Schritt für Schritt." Über Leichen? Die Stelle im Eröffnungsmonolog der Titelheldin wird gern vom Gefühl überschwemmt, weil die Musik von der bedingungslosen Treue Elektras zu ihrem ermordeten Vater Agamemnon singt, von ihrer Menschlichkeit gegen die Unmenschlichkeit der Mutter Klytämnestra, von der Liebe der Agamemnonskinder Elektra und Orest. Dieses Hören verdankt sich dem Komponisten Richard Strauss, der gleichzeitig mit seinem revolutionären Vorstoß ins 20. Jahrhundert, seiner Nervenkontrapunktik, seinem Hass-Motiv, seiner dramatischen Wucht den Wegweiser zum „Rosenkavalier" aufstellt. Selbst die Melodik der Elektra gerät in den Sog der lyrischen Weichheit, wo es um die Sehnsucht der Schwester Chrysothemis geht, Kinder zu haben und ein „Weiberschicksal". Und welches musikalische Ohr könnte sich dem süßen Thema der Agamennonskinder verschließen, das den gewaltigen Elektra-Stoff aus der griechischen Antike an unser Herz legt? Aber auch das Glitschen des Mordblutes hat seine Akkordkette und die Schöpfung Hofmannsthals aus feiner Wortkunst ihre Schreckensvision, die ins 21. Jahrhundert weist. An der Oper Frankfurt ist Regisseur Falk Richter, bisher meist für die Berliner Schaubühne tätig, so frei, die beängstigende Zukunftsvorstellung beim Wort zu nehmen: Über Leichen hin. Dem Folterstaat der Klytämnestra, der operettig verfremdet ist, aber doch die Gefängnissignale von Abu Ghureib trägt, folgt der Unrechtsstaat der Sieger, mindestens dessen Vision. „Überall, in allen Höfen, liegen Tote", sagt Chrysothemis, um in ihren gewaltigen Jubel über die Befreiungstat des Orest auszubrechen: „Und doch strahlen alle." Richters Deutung geht davon aus, dass die Musik der Läuterung und des Lichts täuscht. Die Notwendigkeit, den Mord zu wollen, hat mit Terrorismus zu tun. Richter ist in der Personenführung auf der Opernbühne ein Naturtalent, dem nur wenige Schnitzer unterlaufen. Wie aber ein Botenbericht über die Szene fliegt, wie die Schwestern mit starken Armen kämpfen, wie Mutter und Tochter mit hinterhältigem Interesse kaschieren, dass sie sich zutiefst nicht leiden können, wie die Ältere in jugendlichem Machtwahn über ihren Laufsteg (Bühne: Alex Harb) tänzelt, wie der Kriegermantel des toten Agamemnon wechselnde Zeichen setzt, wie das Beil als Waffe durch die Pistole Orests ad absurdum geführt wird – das sind große Momente. Zu einer funktionierenden Wiedergabe des Werkes gehört die Textdeutlichkeit, wie sie unvergesslich der Dirigent Karl Böhm bei der Probenarbeit zu seiner späten „Elektra"-Aufnahme eingefordert hat. Paolo Carignani, GMD in Frankfurt am Main, bleibt dieser Forderung treu und hält sich bei aller Härte an die dynamischen Vorschriften, um den Sängern zu dienen. In der Partitur klingen bei Carignani Kammermusik und alle Schönheiten auf, die das Museumsorchester faszinierend und ohne Sentimentalität verteidigt. Susan Bullock ist eine überwältigende Elektra, gesungene Ekstase und zurückgenommene Dialogpartnerin der leisen Klytämnestra Ingrid Tobiassons. Dafür röhrt Peteris Eglitis als Orest, während Ann-Marie Backlund die zweite Sensation bietet: eine Chrysothemis von grenzenloser Emphase. „Königliche Siegestänze" – was ist das? Falk Richter will, dass sie schockieren. |
|
Apotheose des Tanzes Es ist Zeit für Richard Strauss. Sah sich der italienische Dirigent Giuseppe Sinopoli vor einigen Jahren noch mit ungläubigem Staunen konfrontiert, als er anlässlich einer Wiener Neuproduktion der "Frau ohne Schatten" behauptete, nicht Schönberg, sondern Strauss sei der wahrhaft Moderne unter den deutschen Komponisten zu Beginn des 20. Jahrhunderts, so wirkt Sinopolis provokante These heute rückblickend wie die Initialzündung zu einer Revision des vordem gängigen Strauss-Bildes vom letzten Romantiker, der in seiner Musik die Umbrüche der Moderne leugnete. Flächendeckend sind in den letzten Jahren vor allem die späten Bühnenwerke entdeckt worden, haben Regisseure wie Peter Konwitschny und Kirsten Harms gezeigt, dass die üppig antikisierenden Faltenwürfe von "Daphne" und "Danae" nichts anderes als blendende Tarnungen sind, unter denen der alte Strauss seine gesellschaftspolitischen Reflexionen verbarg. Ein neuer Blick auch auf die Erfolgsopern der Kaiserzeit, auf "Salome", "Elektra" und "Rosenkavalier" war somit überfällig, und erst vor zwei Wochen hat Kölns neuer Generalmusikdirektor Markus Stenz eine "Salome" aus dezidiert antiromantischer Perspektive dirigiert: Als Psychogramm einer Epoche, die in selbstbespiegelndem Ästhetizismus jede Kraft zur Veränderung verloren hat und die sich erst aus dem Untergang heraus wieder erneuern kann. Alles nur gespielt Auch in Frankfurt ist es ein junger, in räumlicher wie geistiger Distanz zur deutschen Kapellmeistertradition aufgewachsener Dirigent, der jetzt die "Elektra" von allem nachromantischen Klangschutt freiräumt: Paolo Carignani, seit fünf Jahren Chefdirigent des Opernhauses, dirigiert den bislang als Gipfelpunkt der Entfaltung Strauss"scher Orchestergewalt geltenden Einakter als eine Apotheose des Tanzes, nimmt die meist scherzhaft verstandene Bemerkung des Komponisten, seine Werke seien "wie Elfenmusik" zu spielen, tatsächlich ernst. Carignani enthüllt einen grandiosen Jugendstil-Fries à la Klimt, ordnet die scheinbare Überfülle der solistisch geführten Stimmen als filigrane Ornamentik um die jeweils im Zentrum stehenden, wiegenden Tanzrhythmen an: Nicht nur in der "Salome", auch in der "Elektra" tanzt man sich zu Tode, hat der orgiastische Ausbruch von Elektras explizit wie andeutungsweise immer wieder durch die Partitur irrlichterndem Opfertanz-Motiv letale Folgen. Wie Stenz nimmt auch Carignani Strauss" Musik nicht für bare romantische Münze: Statt dem mykenischen Drama durch massierte Klänge und klotzig hingestellte Akkorde archaische Wucht zu verleihen, entzieht Carignani ihm sozusagen den Boden, führt einen Reigen an, nimmt die schwereren Taktteile als federnde Energieimpulse. Das will sagen: All dies ist nur gespielt, der Muttermord nichts weiter als eine dekadente Show für ein Publikum, das den Glauben an die Wahrhaftigkeit des Dargestellten längst verloren hat und selbst am Rand des Abgrunds steht. Mit dem fabelhaft disponierten Frankfurter Museumsorchester ist diese Lesart freilich nicht nur überaus schlüssig und verführerisch, sondern besitzt auch einen ganz praktischen Vorteil. Indem Carignani für absolute Transparenz und Leichtigkeit im Orchestersatz sorgt, gibt er zugleich den Sängern Raum, mit einer ähnlich ausgefeilten Diktion zu reagieren. Ingrid Tobiasson etwa agiert als Klytämnestra mit einem extrem verfeinertem Piano: keine bluttriefende Megäre, sondern eher eine Grande Dame der Jahrhundertwende, die einen Migräneanfall simuliert. Denn auch von Sängerseite ist in dieser "Elektra" alles nur gespielt: Ann-Marie Backlund kehrt als Chrysothemis mit Trippelschritten, Ohrclips und treuherzig strahlendem Elsa-Sopran die Blondine heraus, Peteris Eglitis spielt als Orest nicht nur seine breitbeinige Statur, sondern auch einen unerschütterlich satten Bassbariton aus. Die Regie für diese erste Saisonpremiere hatte Frankfurts Intendant Bernd Loebe einem erfolgreichen Schauspielregisseur anvertraut - eine Praxis, mit der man in Frankfurt bereits gute Erfahrungen gemacht hat. Und Falk Richter, dessen Erfahrung mit dem Musiktheater sich bislang auf die Inszenierung der Uraufführung von Jörg Widmanns "Das Gesicht im Spiegel" im vergangenen Juni an der Bayerischen Staatsoper beschränkt, rechtfertigt bei seiner ersten klassischen Opernregie dieses Vertrauen. Einerseits weiß er um die hochgradige Stilisierung sowohl von Hofmannsthals Dramentext wie von Strauss" Musik und animiert seine Darsteller zu theatralischer Überzeichnung - die zugbrückenartige Rampe, die ihm sein Bühnenbildner Axel Harb über den Orchestergraben gebaut hat, wird ausgiebig genutzt, um den Showcharakter der großen Szenen zu demonstrieren. Andererseits sorgt Richter jedoch dafür, dass neben dem outrierten Spiel die reale, nüchterne Gewalt gegenwärtig bleibt, deren finaler Ausbruch ja auch die Essenz der Straussschen Gesellschaftsprognose ist. Zu Seiten der Gangway beispielsweise, auf der Klytämnestra durch einen kargweißen, neonbeleuchteten Flur nach vorn schreitet, knien Gefangene in orangefarbenen Overalls mit schwarzen Kapuzen (Kostüme: Martin Kraemer) - dass diese Opfer später ihre Peiniger abschlachten, darf durchaus als diskreter Hinweis auf eine Analogie zwischen der Fin-de-siècle-Gesellschaft und den westlichen Demokratien gedeutet werden. Doch: Wo bleibt Elektra? Auch mit der Besetzung der Titelrolle hat Frankfurt Außergewöhnliches, ja Sensationelles zu bieten. Wie Carignani am Pult, steht die britische Sopranistin auf der Bühne für einen Generationswechsel in Sachen Strauss: An die Stelle der "Hochdramatischen" mit stählernen Stimmbändern vom Schlage einer Deborah Polaski und Grabriele Schnaut tritt nun eine Sängerin, die die hochartifizielle stilistische Faktur dieser Rolle auf bislang vermutlich unerhörte Weise reflektiert. Auch Bullock besitzt den hochdramatischen, durchschlagenden Trompetenton, doch sie setzt ihn kaum je ein, färbt statt dessen schon ihren Eingangsmonolog teils mit melancholischen Marschallinnen-Tönen, geriert sich gegenüber Aegisth mit einer keck gespielten Mariandl-Mentalität, erkennt ihren Bruder Orest mit makellosem hingebungsvoll schmelzendem Piano. Bullock hat das Zeug, die tonangebende Elektra dieses Jahrzehnts zu werden - sofern sie auf Dirigenten trifft, die in Strauss" Partituren mehr sehen als die Entfesselung einer imposanten Orchestermaschinerie. Die Tiefe, sagte übrigens Hofmannsthal, müsse man verstecken. Und zwar an der Oberfläche. JÖRG KÖNIGSDORF |
|
Mykene liegt in Abu Ghraib von Manuel Brug Agamemnon - ein Mantel. Als Totem und Tabu hängt er geisterhaft angestrahlt in einer Nische. Daneben das Falk-Richter-Übliche, auch wenn ihm erstmals Alex Harb die Bühne gebaut hat: kahle Stahlwände, Eisenstege, Suchscheinwerfer, ein Schriftband, auf dem in blutroten Digitallettern Schlüsselsätze vorüberlaufen. Die Mägde, Maoblaue Arbeitsbienen, lassen gleich eimerweise Blut (oder doch nur Färbefarbe?) über eine Schütte schwappen. Paolo Carignani fächert die Anfangsakkorde wie Aufschnitt aufs Orchestersilbertablett: hauchdünn, präzise, um dann sehr beweglich vor allem mit den Holzbläsern weiter zu wieseln. Die Elektra der im ersten Monolog noch etwas flach und pauschal klingenden Susan Bullock sprintet im Overall und mit verfilzten Dreadlocks durch diesen Frauenknast. Doch Falk Richter, der hier an der mit elf szenischen Premieren bienenfleißigen Frankfurter Oper mit dem rachelüsternen Gruselschocker von Strauss/Hofmannsthal zum dritten Mal Oper inszeniert, hat nicht umsonst seinen Ruf als mitunter salonhaft kühler Vertreter des politischen Betroffenheits-Theaters zu verteidigen. Der Attacker vom Thespiskarren hat sich freilich weiterentwickelt. CNN liefert weiter die Vorlagen, doch dem freudianischen Antikegemetzel führen sie diesmal intellektuell frisches Blut zu. Wobei Richter ganz unideologisch die Chiffren der täglichen Nachrichtenbilder als Passepartout über das musiktheatralische Beziehungsgeflecht legt. Spätestens wenn sich zum Klytämnestra-Auftritt, den die famos orgelnde wie straßfunkelnde Ingrid Tobiasson von einer Rampe aus als Mischung aus Imelda Marcos und Elvira Bach hinlegt, die Stahltore öffnen, ist klar: hier, zwischen Neonröhren, aseptisch weißen Wänden und unter schwarzen Säcken verborgenen Gefangenen in orangefarbenen Overalls ist Elektra nicht nur die RTL-Gefängnislesbe Katy Karrenbauer, sondern gleichzeitig auch die Folterfee Private Lindy England aus dem Kerker Abu Ghraib. Mykene liegt plötzlich im Irak. Elektra ist eben keine herrlich singende Hochdramatische - obwohl ihr Richter in der Erkennungsszene mit Orest in weichem Licht fast das Weiberschicksal ihrer Schwester Chrysothemis (sopranstrahlend in oliver Armeeuniform: Anne-Marie Backlund) gönnt. Sondern eine Halbwahnsinnige, die sich in ihre Rachefantasien verbeißt, die die Gewaltspirale weiter dreht, auch wenn sie letztlich Unschuldige trifft. Deshalb kommt nun Orest (weich gerundet, voll dunkler Kraft: Peteris Eglitis) mit Hängehemd und Adidas-Hosen wie ein fanatischer Gotteskrieger daher und schraubt den Schalldämpfer auf die Pistole. Die Geschwister berühren sich nie, Fanatismus flackert in ihren Augen. Der unrechtmäßige König Ägisth (Hans-Jürgen Lazar), ein weizenblonder Jeansträger im US-Bomberblazer, sucht letzte Machtreste aus dem Agamemnon-Mantel zu saugen. Dann ist das Gefängnis nur noch Schlachthaus. Blut läuft die Rampe herab, Leichensäcke pflastern Elektras Weg, der die grandios sich steigernde Susan Bullock in den Verzückungstod führt, während Orest unter den verbrannten Körpern seiner Mutter und ihres Gatten das nächste Unrechtsregime ausruft. Nicht nur Paolo Carignani und sein verzückt spielendes Orchester erhöhen die Lautstärke und Qualitäts-Dezibel mit wie gemeißelten Klangwogen. Diese fantastisch besetzte Aufführung macht Gänsehaut. Und Falk Richter, der jüngst in Salzburg mit der "Möwe" seinen ersten Klassiker inszeniert hat und jetzt sogar in schwarzem Anzug samt Lederschuhen statt der üblichen Slacker-Kluft die Ovationen entgegen nimmt, ist an soviel Frauenpower ein ganzes Stück gereift. |
|
Falk Richters Inszenierung von "Elektra" in Frankfurt Seit den späten 90er Jahren gilt Falk Richter in der Schauspielszene als eine der großen Zukunftshoffnungen. Zunächst als Interpret bekannt geworden, rückte zuletzt auch verstärkt der Autor Falk Richter in den Blick. Zum Erfolgsstück etwa avancierte Richters "Gott ist ein DJ". VON SUSANNE BENDA An der Frankfurter Oper wandte sich der auf vielfältige Weise Theaterbesessene jetzt wieder einmal der Oper zu - und bekam es dabei gleich mit einem Extremfall zu tun: Richard Strauss" "Elektra", die erste Frucht der Zusammenarbeit mit dem Dichter Hugo von Hofmannsthal, ist ein (harmonisch, sängerisch, orchestral) grenzwertiges Stück, weil es durch und durch dramatisch ist. Dieser unbeirrbare Hang zum Theater, er hätte Strauss und Falk Richter eigentlich zusammenbringen müssen. Leider jedoch war meistens das Gegenteil der Fall: Auf der Bühne, die Alex Harb mit Liebe zu farblichen und räumlichen Symmetrien um einen langen Laufsteg herum eher spärlich ausgestattet hatte, regierten auf weiten Strecken darstellerische Statik und Konvention. So kauert sich Elektra in bekannter Manier in die Ecke, Klytämnestra ringt die Hände, und Ägisth schleicht ängstlich einher: ein Tenor, der sich nicht traut. Für ein wenig Widerständiges sollen wohl die Leichensäcke sorgen, aus denen es noch rötlich tröpfelt und die man im Schlussbild in langer, schwarzer Reihe auf der Bühne drappiert. Einen von ihnen schnappt sich Elektra, die wahnsinnig Gewordene, tanzt mit ihm im Dreivierteltakt, während von der Decke verkohlte Tote baumeln. Doch auch dieses blutumsäumte Szenario kann das blasse Bild, das diese Inszenierung vermittelt, nicht farbiger wirken lassen. Und es lässt vor allem nicht vergessen, dass der Regisseur in entscheidenden Momenten der Musik nicht traut: Wenn Orests Tod verkündet wird, führt Richter seine Figurten naiv weiter - als künde das Orchester nicht von einer ganz anderen Wahrheit und Wirklichkeit. Frankfurts Generalmusikdirektor Paolo Carignani am Pult des Frankfurter Museumsorchesters formuliert diese in ihrer ganzen extremen Ausdrucksbreite aus, führt seine Musiker von härtestem Fortissimo bis hin zu feinstem kammermusikalischem Tun. Er hätte, weil er sich selbst inmitten hoch dramatischer Passagen noch ausdrücklich als Begleiter der Sänger versteht, am allerwenigsten jene Teilprojektionen des Textes nötig gehabt, die immer wieder blendend rot wie Werbetexte auf einer Tafel über der Bühne vorüberziehen. Und Fetzen des Librettos in den Raum stellen, die wirken wie eine Zustandsbeschreibung des Fin de Siècle und der "Elektra"-Musik selbst: "Kann man zerfallen, wenn man gar nicht krank ist?" Am Ende gab es viel Applaus von einem Publikum, das die guten Sängerleistungen hörbar goutiert hatte: Ann-Marie Backlunds feine Chrysothemis, die mit messerscharfer Prägnanz artikulierende Ingrid Tobiasson als Klytämnestra, den derb-stämmigen, auf der Bühne ebenso wie in der stimmlichen Höhe etwas verloren wirkenden Peteris Eglitis als Orest und natürlich vor allem die ausdrucksstarke Susan Bullock als Elektra. Zwar neigt diese in der Höhe zu Verengungen und kann ihr hoch gespanntes Singen nicht immer durch ein stabiles Fundament in der Tiefe absichern - doch bewegte sie sich ohne Einbrüche durch die dramatische Partie, und das ist schon eine Leistung. Fazit: Für Gesangsbegeisterte ist die Frankfurter "Elektra" eine Opernreise wert; nette Bilder zum Ansehen bekommen sie als Amuse-Gueule dazu. |
|
Die Axt aus dem Bauhaus Falk Richter inszeniert in Frankfurt Richard Strauss" "Elektra" Von Gerd Döring Den alten Militärmantel, der verloren in einer Nische hängt, hat die Besucherin sofort erspäht, sie seufzt und sagt: "Da weiß man ja, was kommt . . ." Es kommt so: Orest dringt ein in die Königsburg und rächt den Vatermord an seiner Mutter Klytämnestra und deren Liebhaber Ägisth, und vor dem grausigen Ende rangeln zwei abgerissene Gestalten auf der Bühne um eine Pistole. Orest, Sohn des Agamemnon, umarmt schließlich seine Schwester Elektra. Der Totgeglaubte taucht verkleidet im Hinterhof der Königsburg Mykene auf, wo Elektra lange Jahre gewartet hat auf den Bruder, dem Wahnsinn nahe. Um die psychologische Tiefe des Dramas wissen Dramatiker, Schauspieler und Regiseure - der antike Mythos wurde in die Moderne transportiert von O"Neill und Hauptmann und von Richard Strauss und seinem Librettisten Hugo von Hoffmannsthal zu einer Oper im Zeichen der Psychoanalyse gestaltet. In Frankfurt wird diese 1909 uraufgeführte "Tragödie in einem Akt" inszeniert von dem Schauspielregisseur Falk Richter, der in erster Linie der Musik vertraut, sich aber den Zeigefinger auf die Allgegenwart militärischer Gewalt nicht verkneifen kann - sein Schlussbild gibt dem Publikum ein grausiges Tableau mit auf den Heimweg. Die fast leere Bühne wird beherrscht wird von einer kahlen Metallkonstruktion: Ein Laufsteg ragt in der Mitte weit hinaus über den Orchestergraben. Fünf Mägde leeren Eimer um Eimer auf den Gitterboden, und wir werden in den nächsten neunzig Minuten immer das im Blick haben, was unter dem Rost über eine Schräge herabfließt und sich in einer Rinne über den Köpfen der Musiker sammelt. Von solcher Drastik sind die Ingredienzen, die Richter dem antiken Drama beimengt. Hoffmannsthals Zeilen für die Mägde, die "mit immerfrischem Wasser das ewige Blut des Mordes von der Diele abspülen", nimmt er ebenso wörtlich wie Elektras Tanz mit der Axt, die ihren Vater getötet hat - eigens hierfür hat er ein funkelndes Werkzeug im Baumarkt besorgt. Das Bühnenbild (Alex Harb) und die Fantasieuniformen der Darsteller (Kostüme: Martin Kraemer) gehen durchaus konform mit den szenischen Vorstellungen Hoffmannsthals, der sich keinesfalls "jene antikisierenden Banalitäten" wünschte, mit denen man den Elektra-Mythos gerne bebilderte. Falk Richter und sein Team haben mit ihrer kühlen und kantigen Ausstattung die Erzählung in die Moderne geholt. Eine blendend helle Vorhalle wird sichtbar, wenn die grauen Palasttore sich öffnen, der weit in den Bühnenhintergrund verlängerte Metallsteg wird gleißende Bühne für den Aufmarsch der von Vasallen begleiteten Klytemnästra, einer in blutiges Rot gekleideten Herrscherin. Im Dunkel liegt der Hinterhof, in dem Elektra leidet. Hier, im Rücken der Macht, hängt die verzweifelte Königstochter ihren Rachefantasien nach. Mit dieser effektvollen Lichtregie (Olaf Winter) stellt sich uns Mykene dar als Domizil einer effektiven Militärmacht - zugegeben, nicht ganz die Bühne für Hofmannsthals ganz im Zeichen von Freud stehende Interpretation, aber durchaus eine Bebilderung, die der Geschichte nicht zuwiderläuft. Susan Bollock ist eine starke Elektra und vor allem stimmlich der Rolle gewachsen. Laut in der Verzweiflung, aber mit klarem Ton und lyrischem Belcanto, wenn sie mit heuchlerischem Zungenschlag Ägisth (Hans-Jürgen Lazar als Zauderer) in den Tod schickt. Ingrid Tobiasson (Klytämnestra) überzeugt mit superbem Gesang, Ann-Marie Backlund gibt der Schwester Chrysothemis etwas hausbackene Züge - aber was für eine Stimme! Den Orest spielt Peteris Eglitis behäbig, erweist sich aber bei seinem Frankfurt-Debüt als klangvoll sonorer Bariton. Und alle, alle sind sie zu verstehen. Ganz wie von Strauss und Hofmannsthal gedacht, fallen in Frankfurt Text und Musik, Gesang und Orchester aufs Subtilste in eins. Paolo Carignani nimmt die Partitur in flottem Tempo, das groß besetzte Frankfurter Museumsorchester ist agil, oft kräftig und ehern, doch zuweilen auch federleicht und lyrisch. Die romantischen Zitate löst Carignani genüsslich heraus, kreiert beeindruckende Momente der Düsternis - und das in perfekter Abstimmung mit den Darstellern. Mit dem letzten Ton setzten Beifall und nicht enden wollende Bravos ein. |
|
Im Schlachthaus von Guantanamo Falk Richter inszeniert in Frankfurt Richard Strauss' „Elektra" Von Frank Pommer Manchmal geschehen innerhalb kürzester Zeit wundersame Dinge mit Sängerinnen und Sängern. Sicher, ihre Isolde in der vergangenen Saison oder auch ihre Els (in Schrekers „Schatzgräber") in der Spielzeit zuvor waren durchaus solide, beachtliche Leistungen. Doch was die englische Sängerin Susan Bullock nun in der Titelpartie der „Elektra" von Richard Strauss an der Frankfurter Oper zeigte, war schlichtweg sensationell. Und ein begeistertes Publikum wusste sehr wohl, dass es Zeuge einer fantastischen Leistung war, feierte Susan Bullock minutenlang mit stehendem Applaus. Dabei hatte sie den Abend zu Beginn ihres ersten Monologs eher verhalten, viel mehr lyrisch denn hochdramatisch begonnen. Immer jedoch lag sie wie von Zauberhand getragen auch im Piano über dem Orchester und unterstrich spätestens mit den emphatischen Agamemnon-Rufen eindrucksvoll, dass dies ihr Abend werden sollte. Und als sie dann auf dem Höhepunkt der Szene mit der von Ingrid Tobiasson gesungenen Klytämnestra über fast drei Takte hinweg fast mühelos, ohne hörbare Anstrengung ein strahlendes hohes C ansetzte, dann hörte man neben der Elektra alle großen Strauss- und Wagner-Partien bereits mit, die wir von dieser Sängerin noch erwarten dürfen. Neben Bullock gab es aber noch einen weiteren Triumphator an diesem Abend: Frankfurts Generalmusikdirektor Paolo Carignani am Pult des Museumsorchesters. Er gestattete seinen Musikern alles, was das Herz des Strauss-Liebhabers erfreut, ließ in den Erinnerungs-Passagen Elektras ebenso wie in den Auftritten ihrer Schwester Chrysothemis (Ann-Marie Backlund) seine Musiker geradezu hemmungslos in den Kantilenen schwelgen, um im nächsten Augenblick, etwa beim ersten Auftritt der Klytämnestra, einem geradezu bedrohlichen musikalischen Naturalismus zu frönen. Einem Naturalismus, der das Seelenleben der Figuren hörbar wie sichtbar machte – und wir blickten nicht nur im Falle der Klytämnestra in einen fürchterlichen Abgrund. Wenn sich dann zum Blutrausch des Geschehens auf der Bühne der Klangrausch des Strauss-Orchesters gesellte, dann wurde der Opernabend fast schon zur Grenzerfahrung. Von Beginn an hatte der junge Regisseur und Autor Falk Richter zusammen mit seinen Ausstattern Alex Harb (Bühne) und Martin Kraemer (Kostüme) auf die übermächtige Blutsymbolik der Handlung gesetzt: Die Mägde in der ersten Szene leeren vor dem Hintergrund einer schwarzen Mauer (der Außenwand des Palastes) eimerweise dickflüssiges Blut in einen Rost. Während sich das Regieteam einerseits sehr eng an Regieanweisungen Hofmannsthals hält (Beleuchtung oder auch das blutrote Kleid der Klytämnestra samt Perlenkette), versucht es andererseits eine Aktualisierung, einen konkreten Zeitbezug umzusetzen,. Klytämnestra ist in Falk Richters Lesart die grausame Herrin eines Gefangenenlagers, dessen Insassen in ihren orangenen Overalls und mit schwarzen Säcken über den Köpfen an misshandelte Häftlinge im Irak oder auch an das US-Lager in Guantanamo-Bay erinnern. Trotzdem gelingen Richter mitunter suggestive Bilder von teilweise verstörender Wirkung: So hat sich der grell ausgeleuchtete Innenraum des Klytämnestra-Palastes im Finale regelrecht in ein Schlachthaus verwandelt, die ehemaligen Häftlinge stapeln die in schwarze Säcke verpackten Leichen auf- und nebeneinander. Zwei verstümmelte und verkohlte Tote werden zudem wie Schweinehälften aufgehängt, auf dass sich der triumphierende Orest (Peteris Eglistis) im Schlussbild genau unter dieses erschütternde Mahnmal seiner Sendung postieren kann. Da ist denn auch Elektra längst tot. Nachdem der Bruder ihren Lebensauftrag erfüllt, ihren Durst nach Rache gestillt, gibt es keinen Grund mehr für sie, weiterzuleben. Denn ein menschliches Leben führte sie ohnehin nicht mehr, war nur noch animalisches Wesen, allein von der Gier nach Rache am Leben erhalten. |
|
FINANCIAL TIMES Elektra, Frankfurt Opera By Shirley Apthorp "Everywhere, in all the courts, there are dead bodies, all who are alive are smeared with blood, yet all are smiling," sings Chrysothemis. Former prisoners pile oozing body-bags along the floor. Two charred and bloodied corpses, minus a limb or two, are hoisted on meat-hooks. Klytämnestra and Aegisth don't look well. Atrocities are nothing new. For an explanation of the human penchant for slaughter and tyranny, you could do worse than to look to Sophocles. Hofmannsthal and Strauss did, creating an Elektra both rooted in antiquity and very much of its time. For his new Frankfurt production, director Falk Richter has politicised the piece to within an inch of its life. The action plays between the stark steel walls of a giant prison, run by sadistic guards. The orange-clad inmates have sacks over their heads. Red neon text tracks across the top of the stage, more CNN news ticker than surtitles. The house of Atreus has relocated to Guantanamo Bay. Or Abu Graib. "We got him!" say the titles, just as Klytämnestra's confidante comes with the whispered news of Orest's purported death. The mother chortles in obscene delight. Orest, when he does appear, wears an Arab shirt, a skull-cap, a military vest and the dreamy expression of a fanatic. He screws the silencer on to his pistol with an air of weary routine. It's scary. And so it should be. Richter's staging is a cautionary tale about terrorism, both sides wading in blood. Yet it's surprisingly straight by German standards. The story is updated but not altered. Characters are directed with breathtaking attention to detail. Never have these four dysfunctional adults looked more like a family, mirroring each other's gestures and expressions unconsciously, inextricably linked, doomed to perpetuate the cycle of violence. Susan Bullock's Elektra is a ghastly triumph. She is strong, tormented, lyrical and obsessive. It's a performance of unflagging power and incredible courage. Peteris Eglitis makes a blood-curdling Orest, calm and dangerous; Ann-Marie Backlund as Chrysothemis is subtle and complex, Ingrid Tobiasson delivers a disturbed diva of a mother. Paolo Carignani drives the excellent Frankfurt Museum Orchestra hard and fast, with moments of delicacy. Devastating. |