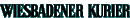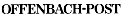|
Der Mord in der Spiegelreflexkamera Er besitze eine besondere Gabe, die Größe menschlichen Leidens auszudrücken, sagte der amerikanische Komponist Roger Sessions über seinen Lehrer Ernest Bloch. Tatsächlich gewinnt die Musik in Blochs 1904 bis 1909 komponierter Oper "Macbeth" ihre größte Intensität in der eindringlichen und differenzierten Gestaltung jener großen Palette seelischer Qualen, die durch das mörderische Königspaar aufgerissen wird. Die innere Ödnis Macbeths nach dem ersten Mord, das markdurchdringende Wehklagen des Volkes, die uferlose Trauer, in der Macbeth zu ertrinken droht, bis er sich durch einen wilden Macht- und Blutrausch gewaltsam aus ihr zu befreien versucht, Schmerz mit größerem Schmerz betäubend, das quälende Gewissen und - in immer neuen klanglichen Facetten - die stets präsente, übergroße und erdrückende Schuld: all das wird plastisch in Blochs eng an Shakespeare orientierter Vertonung des Librettos von Edmond Fleg, der es - anders als in Verdis Frühwerk - weniger um die Dramatik der Ereignisse geht als um "den Seelenzustand der Personen" (Bloch). In fieberhaften Nächten hat Bloch an seinem mit vierundzwanzig Jahren begonnenen Werk komponiert, während er tagsüber im Genfer Uhrengeschäft seines Vaters arbeitete. Nach der vom Publikum gelobten, von der Kritik überwiegend gerügten Uraufführung an der Pariser Opéra comique im Jahr 1910 war Blochs Opus summum lange Zeit vergessen. In Deutschland war es überhaupt erst vor sechs Jahren zum ersten Mal zu hören, in einer Inszenierung von John Dew am Dortmunder Opernhaus. Bloch, der 1880 in der Schweiz geboren wurde, 1916 erstmals in die Vereinigten Staaten reiste, wo er bald reüssierte, 1924 die amerikanische Staatsbürgerschaft annahm und bis zu seinem Tod 1959 seinen Lebensschwerpunkt behielt, kennt man hierzulande allenfalls als Komponist von Werken jüdischer Thematik, die er nach dem "Macbeth" zu komponieren begann: als Verfasser der "Schelomo"-Rhapsodie für Cello und Orchester, der "Trois Poèmes juifs" oder der "Israel"-Symphonie. An der "journalistischen Usance, in Ernest Bloch den führenden Repräsentanten einer modernen jüdischen Musik zu sehen" hat allerdings schon Max Brod in den siebziger Jahren scharfe Kritik geübt, indem er etwas überpointiert bemerkte: "Bloch wollte jüdische Musik schreiben; es ist ihm nicht gelungen. Mahler wollte nichtjüdische Musik schreiben; es ist ihm nicht gelungen." In Frankfurt, wo Bloch am Hoch'schen Konservatorium bei Iwan Knorr Komposition studiert hat, bot eine Koproduktion der Oper mit dem Wiener KlangBogen-Festival nun Gelegenheit, den ambitionierten Opernwurf kennenzulernen, in einer englischen Fassung, die Bloch zusammen mit Alex Cohen erstellt hat, und die das Werk noch näher an die Verse Shakespeares zurückband. Es dirigierte Sian Edwards, Keith Warner führte Regie. Vielfältigste Einflüsse hat Bloch in den sieben Szenen und den Zwischenmusiken seines "Drame lyrique" zu einer ersten großen Synthese gebracht. Seine Musiksprache zeugt von einer durch Debussy und Mussorgsky geläuterten Wagnerrezeption mit quartenreicher Harmonik, deklamatorisch-sprachnaher Melodik, einem Netz charakterisierender Motive, drastischen Orchesterfarben und einer großen Spannbreite vokaler Ausdrucksformen. An Mussorgsky, speziell dessen Oper "Boris Godunow", die Bloch schon früh kennengelernt hatte und bewunderte, erinnern nicht nur die dramatische Wucht des inhaltlich verwandten Sujets und die überwiegend dunklen Farben im spätromantischen Riesenorchester, sondern auch der Gebrauch modaler Skalen. Dennoch, das machte das engagiert und prägnant musizierende Museumsorchester unter Edwards deutlich, hat Bloch einen unverkennbar eigenen Stil entwickelt. Seine eruptive, metrisch in vielen Takt- und Tempowechseln "schwebende" musikalische Prosa, läßt zwar mancherorts Komplexität und symphonische Durchgestaltung vermissen, erreicht jedoch mit ihrer schroffen Direktheit, in ostinat repetierten oder sequenzierten Motivfloskeln, bisweilen eine bohrende Intensität. Edwards entlockte ihr große Suggestivität, Ernst und charakteristische Farbe, ohne den Ausdruck plakativ zu forcieren. Fabelhaft auch der von Alessandro Zuppardo vorbereitete Chor, den Bloch sich aus musikdramatischen Erwägungen, sicherlich inspiriert von "Boris Godunow", hinzudichten ließ. Passend zu Blochs psychologisierendem Blick auf Shakespeare hat Warner das Drama in raschen, filmartigen Schnitten auf die zunehmend verzerrte Wahrnehmung des Titelhelden fokussiert. In einem raffiniert mit Spiegeleffekten und perspektivischen Täuschungen spielenden Bühnenbild von Es Devlin erscheint Macbeth als ein Mann gewaltiger Visionen, nicht aber der Taten: Er steht abseits vom Geschehen, als Beobachter hinter einer altmodischen Kamera, deren Gehäuse als dunkler Kubus mit verhängten Kammern und flexiblen Spiegelwänden in riesiger Vergrößerung auch die Mitte der Drehbühne beherrscht. In diesem Zauberkasten sind die Schloßgemächer angesiedelt, hier wird der König ermordet, werden die vermeintlich schuldigen Knechte demonstrativ abgeschlachtet und die Großen zum Bankett geladen. Hier erstarrt auch die prächtig singende und hochdramatisch agierende Louise Winter als Lady Macbeth unter den Berührungen ihres Mannes zu Stein, wird Macbeth von seinen Schuldvisionen gejagt und kämpft schließlich einen verzweifelten Kampf gegen seine ins Riesenhafte anwachsenden Schatten - suggestives Bild einer zerstörerischen Größenphantasie, dem Daniel Sumegi in der Titelpartie mit mächtigem, aber melodiös-geschmeidigem Baß-Bariton und fulminantem darstellerischen Einsatz große Eindringlichkeit verleiht. Nur durch den Spiegeleffekt wird aus Macbeths Bett überhaupt ein Ehebett, wie insgesamt Macbeth und seine Lady als zwei arbeitsteilige Hälften einer gespaltenen Persönlichkeit erscheinen, als Repräsentanten von Vision und Tat, deren unreflektierte Verbindung eine ganze Tötungsmaschinerie in Gang setzt. Banalisierend erscheint in diesem Zusammenhang hingegen Warners Einfall, die Hexen als Vertreter einer gewissenlosen Presse darzustellen, deren aus Zeitungsschnipseln angemischter Gerüchteküchenbrei dem mörderischen Paar die Nahrung liefert. Mit fortschreitendem Machtrausch verstrickt sich Macbeth immer tiefer im Inneren des Kamerakastens, dessen verspiegelte Wände sich inzwischen zu Schenkeln geöffnet haben, die den Herrscher am Ende tödlich in die Zange nehmen. Das Publikum bejubelte eine packende Aufführung, zu deren Gelingen die fabelhaften sängerischen und darstellerischen Leistungen, auch in nahezu sämtlichen Nebenpartien, erheblich beitrugen. JULIA SPINOLA |
|
Powerplay VON STEFAN SCHICKHAUS Diese magic box hätte auch in einer Zaubershow in Las Vegas Anerkennung hervorgerufen. Geformt wie ein Schuhkarton, aber groß wie fast die ganze Drehbühne der Oper Frankfurt steht sie und dreht sich im Zentrum von Ernest Blochs Oper Macbeth. Und macht großartige Dinge möglich. Denn die Box ist diagonal durch einen Spiegel derart geschickt geteilt, dass sie in ihren beiden offenen Seiten jeweils etwas völlig anderes zeigt - der Spiegel ergänzt dem Auge den Rest zum Eindruck eines kompletten Raumes. Nicht neu ist dieser Taschenspielertrick, aber er bringt Zauber in die Oper: Wenn sich die Bühne etwa bei der Bankett-Szene weiterdreht ohne Macbeth und nach einer halben Drehung die gleiche, jetzt verwaiste Festtafel ins Bild kommt mit dem Geist Banquos als einzigem Gast, dann muss Macbeths Wahnsinn nicht pure Pantomimenkunst bleiben. Zweimal Macbeth hat die Oper Frankfurt in ihrem Saisonprogramm: Einmal den bekannten von Giuseppe Verdi aus dem Jahr 1847, zuvor jetzt den völlig unbekannten, wie er 1910 als erste und einzige Oper des Schweizer Komponisten Ernest Bloch in Paris uraufgeführt wurde. Genauer gesagt: In Frankfurt spielt man eine noch exotischere Version. Anstatt für das Französisch des Originals entschied sich das britische Realisierungsteam - Dirigentin Sian Edwards, Regisseur Keith Warner und Ausstatterin Es Devlin - für das Englisch der Shakespearschen Vorlage. Bloch selbst hatte 1930 den Sprachwechsel vollzogen für eine Schüleraufführung; 1950 gab es in Wien dann eine professionelle englische Produktion, jetzt nach langer Pause in Frankfurt eine nächste. Und eine erfolgreiche zudem. Dunkel wie die Nacht Ernest Bloch kommt schnell zur Sache, er komponierte sein Frühwerk mit der Zielstrebigkeit der Jugend. Nach nur zwölf Minuten, Orchestervorspiel inklusive, haben die Hexen bereits die Weichen gestellt, Macbeth ist zum Thane of Cawdor ernannt und spekuliert mit der Königskrone. Dazu die genialische Drehbühne von Es Devlin, die stets für Bewegung sorgt, es geht voran. Bloch hielt sich nicht auf mit epischen Verweilmomenten, auch nicht damit, Arioses zu erfinden, das im Ohr bleiben könnte. Bloch komponierte am Wort entlang, sehr ansprechend allerdings, wenn auch wenig greifbar. Das Orchester dazu, das Sian Edwards zumindest in den beiden Rahmenakten im wie natürlich wirkenden Fluss halten konnte, ist reine Farbe. Düstere Farbe allerdings, mit viel dunklem Holzbläserklang, nervösen Synkopen, friedloser Unruhe. Es ist ein Debussy-Klang mit einigen majestätischen, dem Königsdrama geschuldeten Blechfanfaren im Wagner-Gewand, doch über weiteste Strecken so dunkel wie die Nacht, in der alles spielt. Leicht für die Sänger ist Blochs Stil nicht. Gerade im ersten Akt, dem alles in allem dennoch gelungensten, überzeugten alleine die beiden Zentralgestalten so ganz: Louise Winter als Lady Macbeth und Daniel Sumegi als ihr zwischen devot und wahnsinnig pendelnder Gemahl. Andere Parts dagegen, etwa der des senilen Königs Duncan (Hans-Jürgen Lazar), waren wenig vorteilhaft angelegt, klangen wie ungewollt ins Groteske verzerrt. Mit den Akten zwei und drei wurden die Sängerleistungen dann ausgewogener, vor allem der Tenor Carsten Süß als Malcolm und der Bariton Anders Larsson als Macduff etablierten sich als stimmliche Gegenkräfte zum mörderischen Titelpaar. Schlecht beraten war Bloch allerdings mit der Idee, jeden Akt mit einem Chor schließen zu lassen. Musikalisch wie inszenatorisch stellte er sich damit böse Fallen, in Frankfurt konnte man nicht alle umgehen. Über weite Strecken siegte ohnehin das Optische über das Akustische, die Musik gab vor allem Farbe und Untergrund für ein Powerplay der Theatermittel. Keith Warners Inszenierung in Es Devlins Bühne und mit Wolfgang Göbbels Lichtdesign bestimmten die Szene, viel gab es zu sehen. Auch Details, nur kurz im Bild, bevor sich die Bühne wieder wegdreht: Der langlockige Duncan in seinem Gemach zum Beispiel, wie er sich von seinen buddhistischen Mönchsknechten salben lässt, als wäre er Gottes Sohn. Nicht alles zündet dabei gleich gut. Etwa Warners Idee, von den Hexen die Zukunft nicht aus einem Kessel mit Molchaugen und Froschzehen lesen zu lassen, sondern aus Zeitungsseiten, die sie in Handarbeit selbst erstellen. Die schwärzeste Kunst ist die der Lettern, schon wahr, und soweit auch schön. Doch dass sich diese Zeitungen in James-Bond-Manier dann von alleine entzünden, ist zuviel des Effekts. Vor allem, wenn das Feuerchen nicht mehr als ein kleines Loch ins Blatt zu brennen versteht. Die wirklichen Wirkungskräfte dieser Opernproduktion haben anderes Format. Zum Schlussapplaus, sämtlichen Beteiligten ohne Einschränkung gespendet, standen sie alle auf der Bühne, die Mörder und die Ermordeten - dazwischen gibt es ja nichts -, die weiße Kleidung schwarz befleckt, die schwarze weiß besudelt. Einziges Farbsignal waren hier die roten Haare der Dirigentin Sian Edwards, die Großes geleistet hat: Sie hat bis auf leichte Ermüdungserscheinungen vor allem im zweiten Akt eine unerwartet ergiebige Partitur so reanimiert, dass der Wert nicht alleine einer für die Raritätenstatistik ist. [ document info ] Dokument erstellt am 08.11.2004 um 16:32:12 Uhr Erscheinungsdatum 09.11.2004 |
|
Im Spiegelkabinett der Seele Von Michael Dellith Viel zu lachen hat man im Opernhaus der Stadt zurzeit nicht. Zum Saisonstart zog Falk Richter eine Blutspur der Rache durch die Strauss’sche "Elektra". Jetzt, bei der zweiten Premiere der neuen Spielzeit, hat der renommierte britische Regisseur Keith Warner die nicht minder blutrünstige Story des berühmten Königsmörders Macbeth in Szene gesetzt, und zwar in der erstmals in Frankfurt gezeigten musikalischen Fassung des in der Schweiz geborenen Amerikaners Ernest Bloch, der sich – im Gegensatz zu Verdi – recht eng an die Vorlage Shakespeares hält. Gleich zu Beginn zeigt die Bühne ein Schlachtfeld, auf dem sich Leichen türmen. Doch Warner, der vor allem mit seiner konzentrierten Sichtweise auf die Dallapiccola-Einakter an der Frankfurter Oper Furore gemacht hat, ist ein zu intelligenter Theatermann, als dass er sich zu vordergründigen Bildern verleiten ließe. Vielmehr verfolgt er mit seiner Inszenierung sehr genau die Intention Blochs. Er versucht, der Titelfigur gleichsam in den Kopf hineinzuschauen, das Psychogramm eines Mörders zu erstellen. So zitiert die aufwendige Ausstattung der britischen Theaterdesignerin Es Devlin in Bühnenbild und Kostümen die Entstehungszeit der Bloch-Oper: Jahrhundertwende, das Dräuen des Ersten Weltkriegs, aber auch den Geist der modernen Psychoanalyse von Sigmund Freud und die Blütezeit der Fotografie. Inspiration zur Bühnengestaltung gaben alte Kameras, und so kreist eine überdimensionierte Dunkelkammer unablässig auf der Drehbühne, gibt immer wieder neue Einblicke in die Gedankenwelt der Protagonisten preis, dazu kommen Spiegel und vielfältige Projektionen (Lichtdesign: Wolfgang Göbbel) auf Vorhänge und Wände. Das bis an die Grenzen der Reizüberflutung reichende Spiel der Visionen gleicht einem Blick ins Spiegelkabinett der Seele, ins Labyrinth der menschlichen Vorstellungen, Gedanken, Wünsche und Sehnsüchte. Niemand weiß mehr, was Realität, was Fiktion ist. Alles überlagert sich. Die musikalische Entsprechung findet sich in Blochs Partitur, einem Netz aus Leitmotiven und rhythmischen Verschränkungen. Rezitativisches Fortschreiten bestimmt den Verlauf, und so erinnert Blochs Tonsprache neben ihren Anklängen an Debussy, Wagner und auch Mussorgski in ihrer "begleitenden" Funktion manchmal an Filmmusik, was der Komplexität der Partitur freilich nicht gerecht wird. Die britische Dirigentin Sian Edwards, die vor drei Jahren mit Brittens "Peter Grimes" ihren glänzenden Einstand in Frankfurt gegeben hatte, kehrte ans Pult des Museumsorchesters zurück und hellte die Düsternis der Klangfarben durch eine äußerst transparente Gestaltung auf, ohne die Kulminationspunkte in ihrer dramatischen Kraft zu schwächen – ein großer Vorteil für die Sänger. Hier sind vor allem die beiden tragenden Rollen von Macbeth und seiner ehrgeizigen Ehefrau zu nennen: Der Bass-Bariton Daniel Sumegi überzeugte in der Titelpartie mit einem kernig-kraftvollen Timbre, das sich dennoch sehr gut lyrisch einfärben lässt. Seine Wandlung vom loyalen Feldherrn zum mordenden Monster vollzog sich in vielerlei Facetten. Ihm zur Seite gab Louise Winter eine somnambule Lady Macbeth, die ihren Mezzosopran besonders in der Verführungsszene mit beeindruckender Variabilität im Ausdruck einsetzte. Neben der ansprechend agierenden Herren-Riege waren es die drei Hexen (Taina Piira, Michaela Friedrich und Enikö Boros), die, ihre Prophezeiungen aus der Zeitung lesend, eine starke Bühnenpräsenz hatten – nicht zu vergessen der Aurelius-Sängerknabe Jens Albrecht als "Son of Macduff". Beim fulminanten Finale entfaltete der von Alessandro Zuppardo einstudierte Chor all seine Klangmacht. Der Applaus war zunächst zögerlich, doch dann von herzlicher Intensität. Blochs "Macbeth" – eine lohnende Entdeckung! |
|
Vom Salon zum Schlachtfeld Oper Frankfurt: Ernest Blochs "Macbeth" in der Inszenierung von Keith Warner Von Volker Milch
Schatten der Macht: Daniel Sumegi als Macbeth in Frankfurt. Rittershaus Und wieder wird in Frankfurts Oper auf hohem Niveau gemordet: Nach dem Saisonstart mit "Elektra" im Oktober lässt nun "Macbeth" das Blut in Strömen fließen. Nein, es handelt sich nicht um Verdis Geniestreich, auf den Frankfurts Opernpublikum noch bis zum 22. Mai nächsten Jahres warten muss. Dann hat Calixto Bieitos Inszenierung der Shakespeare-Oper Premiere. Im Sinne einer klugen und engagierten, unbekannte Werke beleuchtenden, Querbezüge und Vergleiche ermöglichenden Programm-Dramaturgie hat die Frankfurter Oper Ernest Blochs unbekannte Version des Shakespeare-Dramas vorgeschaltet. Der 1880 in Genf geborene, 1916 in die USA ausgewanderte und dort 1959 in Portland gestorbene Komponist ist vor allem als Schöpfer von Musik bekannt, die jüdische Themen umkreist: "Schelomo", die "hebräische Rhapsodie" für Cello und Orchester, ist wohl das bekannteste Werk in einer dürftigen Rezeptionsgeschichte. Und "Macbeth", Blochs einzige vollendete Oper, die in Frankfurt in der englischen Fassung gegeben wurde, hatte schon im Kontext der Pariser Uraufführung im Jahr 1910 mit antisemitischen Ressentiments zu kämpfen. Gemeinsam mit dem Librettisten, dem Dichter-Freund Edmond Fleg, bewegt sich Bloch nahe an Shakespeares Original. Die Faszination des Verbrechens, das Drama des Gewissens und die Umkreisung der "Seelenzustände" lassen das Werk freilich auch an den charakteristischen Dekadenz-Motiven der Jahrhundertwende teilhaben - "Elektra" lässt grüßen. Musikalisch ist - bei aller Deutlichkeit der Einflüsse von Debussy oder Wagner (auch in der leitmotivischen Arbeit) - ein starker eigener Ton unverkennbar. Bloch bedient sich plastischer, eindringlicher Melodik und instrumentiert sehr farbenreich. Man kann das Werk, das auch vokal Süffiges zu bieten hat, durchaus "dankbar" nennen. Dabei lässt Bloch bösen, grotesken Humor musikalisch durchblitzen: Wenn Macbeth gute Miene zum bösen Spiel macht und staatstragend lügt, trumpft das Orchester entsprechend plakativ auf. An Kraft, aber auch an Feinschliff lässt es das Museumsorchester unter der Leitung der britischen Dirigentin Sian Edwards dabei nicht fehlen: Das Publikum reagierte mit Begeisterung. Sian Edwards hatte sich in Frankfurt bereits 2001 mit "Peter Grimes" vorgestellt. Ähnlich schwer wie bei Verdi dürfte bei Ernest Bloch die Besetzung der tragenden Partien sein: Louise Winter als Lady Macbeth und Daniel Sumegi in der Titelpartie leisten neben dem Macduff von Anders Larsson, Dietrich Volles Banquo und den drei Hexen schier Unglaubliches an musiktheatralischer Präsenz. Mit bassbaritonaler Wucht zaudert und mordet Macbeth, getrieben von seiner böse funkelnden Lady. Mit dem britischen Regisseur Keith Warner hat man einem Spezialisten fürs Düstere die Inszenierung anvertraut. Erst im Juni hatte er in Frankfurt zwei Einakter Luigi Dallapiccolas eindrucksvoll in Szene gesetzt. Die Dunkelheit der Szene (Bühnenbild und Kostüme: Es Devlin) bringt auch Keith Warners Bayreuther "Lohengrin"-Inszenierung von 1999 in Erinnerung. Nur ist der Frankfurter "Macbeth", eine Koproduktion mit dem KlangBogen-Festival Wien und dort bereits 2003 zu sehen, ungleich stringenter und fesselnder geraten. Offenbar befindet man sich, wie die Kostüme nahe legen, in der auf Gewalt zutreibenden Vorkriegs-Gesellschaft der Entstehungszeit der Oper: Kurze Wege führen vom Salon zum Schlachtfeld. Die Hexen sind zu Zeitungsleuten mutiert und brauen ein aus Wahrheit und Lüge gemixtes Süppchen: Fauler Zauber. Symbol für die neue, die Menschen steuernde Macht der Medien ist eine auf der Bühne omnipräsente Kamera. Und immer wieder verkünden Zeitungen Krieg, Mord und Totschlag. Die Geister lässt Warner aber auch theaterwirksam als Projektionen über der Bühne tanzen und bedient sich gemeinsam mit der Bühnenbildnerin Es Devlin und dem Licht-Designer Wolfgang Göbbels suggestiv aus der Trick-Kiste. Düster nebelt es im Hintergrund, während die Drehbühne mit ihrem großen, verspiegelten Kasten als Bühne auf der Bühne schnelle Verwandlungen ermöglicht. Die optischen Irritationen und Überraschungs-Effekte spiegeln die Schräglagen der Protagonisten-Psyche und sorgen mit einer nach dem ersten Akt immer stärker werdenden musikalischen Sogwirkung für einen ganz außerordentlichen Opernabend. |
|
Innenansichten einer mörderischen Seele Es sind düster grundierte Bühnenwelten, in die Keith Warner seine Inszenierungen gerne hüllt: Sein Bayreuther "Lohengrin" - ein Nachtstück; dunkel auch der Grundton seiner Regie in zwei Einaktern von Luigi Dallapiccola, die vergangene Spielzeit Premiere an der Oper Frankfurt hatten, kurz bevor Warner dort sogar Rossinis heitere "Cenerentola" ins Bühnen-Schwarz hüllte. Doch zu kaum einem Stück dürfte diese Ästhetik so treffend passen wie zu der selten gespielten Oper "Macbeth" des aus der Schweiz stammenden Komponisten Ernest Bloch: Keith Warner hat den Dreiakter nach Shakespeare vergangenes Jahr beim Klangbogen-Festival im Theater an der Wien inszeniert; jetzt feierte seine Inszenierung Premiere an der koproduzierenden Oper Frankfurt. Diese einzige Oper von Ernest Bloch (nicht zu verwechseln mit dem fast gleichnamigen Philosophen Ernst Bloch) wird in Frankfurt seit der Pariser Uraufführung 1910 überhaupt erst zum 16. Mal aufgeführt, nur einmal, 1999 in Dortmund, war das Werk bisher in Deutschland zu erleben. Frankfurt spielt die englische (und deutsch übertitelte) Zweitfassung des ursprünglich französischsprachigen Werks. Fokussiert ist der gut drei Stunden dauernde "Macbeth" ganz und gar auf die Titelfigur, die Innenschau auf ihre mörderische Seele hält: Die Erkenntnisse eines Sigmund Freud aus der Entstehungszeit der Oper (1904-1909) sind mit Händen greifbar. Keith Warner findet für dieses Geschehen, diese Innenhandlung starke Bilder: Macbeth schaut häufig durch eine Stativkamera, und auch der verspiegelte, sich permanent drehende Bühnenkasten lässt an das Innere einer Kamera denken. Hier kann sich Macbeth nicht mehr entkommen, gleich mehrfach muss er sich in den Spiegeln erkennen, die sich erst bei seinem Tod verschließen. Und so ist es auch konsequent, dass im Bühnenbild von Es Devlin (auch für die Kostüme verantwortlich) weitgehend farblose Hell-Dunkel-Kontraste herrschen: Selbst das Blut auf den Gewändern der Mörder und Ermordeten ist schwarz, und schwarz auf weiß prangen Schlagworte wie "Mord" oder "Krieg" vielsprachig auf den herumgereichten Zeitungsseiten, deren Druckvorlagen die drei Hexen als Orakel des Geschehens frühzeitig vor sich hertragen. So wie die Inszenierung immer mehr in den Bann des reflektierten Bösen zieht, so suggestiv nimmt auch Blochs Musik für sich ein: Sie bildet eine vielfarbige, vorwiegend lichte Grundierung, klanglich von Debussy und Mahler, formal von Wagners Leitmotiv-Technik geprägt, eine kommentierende Seelenmusik zudem in den zahlreichen Orchesterzwischenspielen; der Einsatz des Chors bleibt jeweils auf die Aktschlüsse beschränkt. Dass all die Valeurs, die Zwischentöne von Blochs Partitur in Frankfurt bestens zur Geltung kommen, ist dem Museumsorchester sowie der Dirigentin Sian Edwards zu danken. Und stark besetzt ist auch die Riesen-Partie des Macbeth, die der australische Bass-Bariton Daniel Sumegi bei großer dämonischer Bühnenpräsenz mit schier unglaublicher Kondition und herbem Timbre grandios ausgestaltet. Nicht weniger stark: die dynamisch hoch präsente, furiose Lady Macbeth von Louise Winter. Bereits ihre Partie wird bei Bloch neben der zentralen Titelgestalt fast schon zu einer Nebenrolle, und so geht es in der Oper erst recht allen weiteren Figuren, wenngleich sie in Frankfurt auf überwiegend hohem Niveau gegeben werden. Zu nennen sind etwa der noble Tenor von Carsten Süß (Malcolm), Dietrich Volles Banquo, Anders Larssons Macduff, aber auch der sichere Knabensopran von Jens Albrecht (Macduffs Sohn) sowie das ausgewogene Hexen-Terzett mit Taina Piira, Michaela Friedrich und Enikö Boros. Nach eher verhaltenem Zwischenapplaus zur Pause reagiert das Premierenpublikum am Ende mit starker, ungebrochener Zustimmung. AXEL ZIBULSKI |
|
Hexenmacht mit Druckerschwärze Von Siegfried Kienzle
Wie lassen sich die Hexen in "Macbeth" aus heutiger Sicht überzeugend darstellen? Mit bösen Einflüsterungen verderben sie Macbeth. Heute sind es eher Journalisten, die mit derartigen Zukunftsprognosen Entscheidungen manipulieren. So ist es plausibel, wenn es für den Regisseur Keith Warner die Medien sind, die den Ehrgeiz des Emporkömmlings anstacheln und ihn immer weiter treiben von Mord zu Mord. Mit dieser überzeugenden Vergegenwärtigung gelingt es der Regie aus Shakespeares mythischer Tragödie eine packende Zeitoper zu entwickeln. Die drei Hexen (Taina Piira, Michaela Friedrich, Enikö Boros) sind Zeitungsredakteure in weißen, von Druckerschwärze bekleckerten Kitteln. Aus Zeitungspapier reißen sie die Umrisse der Krone, womit sie in Macbeth den Plan entfachen, König Duncan aus den Weg zu räumen. Nach den Morden sind die Täter nicht mit Blut, sondern mit Druckerschwärze besudelt. Immer wieder hält Macbeth mit einer Stativkamera die Szenen fest. Nicht die Macht, sondern das Bild von der Macht, das er in der Medienwelt anstrebt, treibt ihn an und macht ihn zur Tötungsmaschine. Warner hat dieses Regiekonzept bereits im Sommer 2003 für das KlangBogen Festival in Wien erarbeitet und als Co-Projekt mit der Oper Frankfurt nun erneuert. Es wird zur Neubewertung des vergessenen Komponisten Ernest Bloch(1880-1959). In Genf geboren hat er auch in Frankfurt am Hochschen Konservatorium studiert und lebte seit 1916 in den USA, wo er auch 1924 die Staatsbürgerschaft erhielt. Seine einzige Oper "Macbeth" ist ein Jugendwerk. Bloch schrieb sie 1904 bis 1910, während er noch Uhren im Laden seines Vaters in Genf verkaufte. Uraufgeführt wurde sie französisch, in Frankfurt spielt man eine englischsprachige Fassung. Die Figuren agieren in dramatischem Sprechgesang, das Orchester vermittelt eindrucksvoll die Emotionen zwischen opulenter Klanggewalt und Leichtigkeit. Dieser Reichtum an Nuancen erinnert an Debussy, Chausson, Fauré und wird von der Dirigentin Sian Edwards faszinierend ausgeleuchtet. Es Devlin hat einen Guckkasten aus Spiegelwänden errichtet. Der Raum dreht sich, erzeugt immer neue Durchblicke und Verdopplungen eines Traumspiels. Wie schon bei Verdi ist auch bei Bloch die Lady Macbeth eine fulminante Charakterrolle. Der Mezzosopran Louise Winter zeichnet grandios zwischen Flüstern, Schrei und ariosen Aufschwüngen eine dämonische Psychostudie bis hin zur Wahnsinnsszene. Daniel Sumegi zeigt Macbeth als Zeitgenossen des Komponisten: ein Haudegen mit Gewehr und Ledermantel, dann ein Diktator im Smoking. Mit mächtigem Bariton vermittelt er Terror, Wut, Verzweiflung. Prachtvoll gelingen die Chorszenen in der Klage um Duncans Tod (Hans-Jürgen Lazar als glitzernder Märchenkönig) und im Volksaufstand unter Macduff (Anders Larsson). Ein komödiantisches Kabinettsstück liefert der Bass Jacques Does als Pförtner, der hier den Oberkellner mit Schlagseite mimt. Dietrich Volle (Banquo), Barbara Zechmeister als Lady Macduff, Carsten Süß als Thronerbe Malcolm formen eine Ensembleleistung, die, mit Ovationen bedacht, den hohen Rang des Frankfurter Musiktheaters bestätigt. Noch in dieser Spielzeit wird mit Verdis "Macbeth" ein reizvoller Kontrast möglich sein. |
|
Sämtliche Facetten des Wahnsinns HEXEN, ZAUBER, MORD und Totschlag: Shakespeares „Macbeth" ist ein gefundenes Fressen für Theatermacher und Opernkomponisten aller Epochen. Frankfurter Theatergänger können vergleichen: Mit Salvatore Sciarrinos „Macbeth" war im vergangenen Jahr die jüngste Veroperung zu erleben, Giuseppe Verdis wohlbekannte Fassung wird von Mai 2005 an gezeigt. Die dritte Version ist eine Rarität. Seit Sonntag steht Ernest Blochs „Macbeth" auf dem Frankfurter Opernspielplan.Mit seiner Konzentration auf die Titelfigur ist Blochs „Macbeth" weit näher am Shakespeare’schen Original als Verdis Dauerbrenner, noch dazu wird in Frankfurt die englische Fassung von 1930 gespielt, die gegenüber der französischen Erstversion den Vorteil des über weite Strecken originalen Texts bietet. Ein kräftiges Shakespeare-Englisch, dem Regisseur Keith Warner eine entsprechende Inszenierung zur Seite stellt: Der Brite verpflanzt das tragische Nachtstück in eine ungefähre spätviktorianische Zeit (Bühne und Kostüme: Es Devlin) rund um die Entstehung der Massenmedien Zeitung, Film und Foto. Der Druck der Fleisch gewordenen öffentlichen Meinung – seine drei Hexen sind anzugtragende Medienmacher en travestie – dokumentiert in Extrablättern mit erschütternden Tatortfotos das Drama, das die Hexen prophezeit und mit ihren Veröffentlichungen in Gang gesetzt haben. Ein Mord ergibt zwangsläufig den anderen – nichts für schwache Nerven, obwohl das Bühnenblut an diesem Abend nur Druckerschwärze ist. Die Handlung konzentriert sich in einem atemberaubend wirksamen Einheitsbühnenbild, das den Titel „Drehbühne des Jahres" verdient: In einem engen, schwarzen Häuschen werden von fleißigen Technikerhänden die zahlreichen Spielorte zwischen Festbankett und Königsmord aufgebaut, Spiegelwände erlauben geschickte Geistererscheinungen. Wer den Komponisten Ernest Bloch (1880–1959) nicht oder nur über seine Kammermusik kennt, sollte seiner einzigen Oper „Macbeth" eine Chance geben: Der Vergleich mit hervorragender Filmmusik ist nicht zu weit hergeholt. Kein Belcanto, kein Arienfestival – aber viele teils an Debussy, dann wieder an Wagner erinnernde Strukturen und Spannungsbögen. Wann immer der Chor als anklagende Masse dazu stößt, kommen auch Freunde von Bombast-Musicals wie „Les Miserables" auf ihre Kosten. Dass der dreistündige Abend gewisse Längen der Komposition gekonnt überwindet, liegt am Pult des gut aufgelegten Frankfurter Museumsorchesters in den Händen von Sian Edwards: Die junge Dirigentin feierte mit ihrer leidenschaftlichen Interpretation einen großen Premierenerfolg. Die zahlreichen Solopartien sind durch die Bank hervorragend besetzt: Bariton Daniel Sumegi in der umfangreichen Titelpartie und Mezzosopranistin Louise Winter (Lady Macbeth) finden alle Zwischentöne von lüsternem Triumph bis zu den Facetten des Wahnsinns. Claus Ambrosius |
|
Dräuende Nebel, aufreißendes Licht Die Oper Frankfurt gräbt mit großem Erfolg Ernest Blochs "Macbeth" nach Shakespeare aus - Keith Warner inszeniert eine Psychostory Von Gerd Döring Wütenden Blicks steht er dort, Spiegelwände beiderseits vervielfachen den abgerissenen König, der all seine Macht verloren hat. Unerbittlich erfüllt sich die Prophezeiung: gegen Macbeth ins Feld zieht der Wald von Birnam - jeder der feindlichen Soldaten trägt einen Zweig zur Tarnung, und es sind deren viele, die hinaufziehen gegen Dunsinane Castle. Verlacht hat der König den seltsamen Hexenspruch, nach dem seine Herrschaft endet, wenn die Bäume "wandern". Keith Warner hat für seine Frankfurter "Macbeth"-Inszenierung faszinierende Tableaus entworfen und Bilder voller Poesie gefunden, für die Visualisierung eines wandernden Waldes indes sind dem einfallsreichen Briten die Ideen ausgeblieben. Hinter den Spiegelwänden erahnen wir schüttere Bäumlein, bevor die beiden Seiten zusammenklappen und den finsteren König verschlucken. Mit der Ausarbeitung seiner einzigen Oper hat Ernest Bloch im Jahr 1903 begonnen, und lange hat es gedauert bis zur Ur- aufführung in Paris 1910. Wer heute an den in der Schweiz geborenen Komponisten denkt, der meint seine hebräisch inspirierten Werke, die Rhapsodie "Schelomo". Die Oper dagegen steht in anderer Tradition, zieht ihre Inspirationen aus der Stilvielfalt des Fin de Siècle, bedient sich bei Wagner und Strauss, Debussy und Mussorgski. Die in den dreißiger Jahren entstandene englische Fassung er- lebte nur wenige Aufführungen an kleinen Bühnen, bevor Keith Warner sie 2003 für das Klangbogen-Festival in Wien realisierte. Keine Frage, die Sprache tut dem Werk wohl, schon mit den Anfangstakten ist man in Schottland, das shakespearesche Englisch passt trefflich zur Musik Blochs. Der hat, ganz Kind seiner Zeit, seinen Schwerpunkt gelegt auf die Psyche seiner Protagonisten. Analog zur düsteren Handlung organisiert er ein dunkel grundiertes, rhythmisch vertracktes Tongeflecht, gibt jedem Charakter ein Leitmotiv. Quasi eine Filmpartitur, wie die Dirigentin Sian Edwards im Programmheft anmerkt, Filmmusik mit orchestralem Breitwandklang, lange bevor sie in Hollywood komponiert wurde. Mit viel Fingerspitzengefühl dirigiert Edwards, das famos aufspielende Frankfurter Museumsorchester bietet Sängern und Chor einen nie zu lauten, bemerkenswert geschmeidigen Handlungsstrang. Faszinierend die Visualisierung, die sich orientiert an Stilmitteln der Stummfilmära: dramatisch die Gesten, dräuende Nebel werden effektvoll ausgeleuchtet (Lichtdesign: Wolfgang Göbbel). Die Darsteller und der Chor stecken in Kostümen der viktorianischen Zeit, - Uniformen,Fotografien und Zeitungen bezeugen den Erfolg des machtgierigen Macbeth (Bühne und Kostüme: Es Devlin). Den drängt es zur Macht, er plant mit seiner Frau den Mord an seinem König, beiden zum Verhängnis werden aber ihre Schuldgefühle. Immer tiefer verstricken sie sich in Mord und Verrat bis hin zum eigenen schmachvollen Ende. Was bei Shakespeare Einfluss der bösen Hexen ist - zur Zeit König Jakobs des Ersten brannten überall in England die Scheiterhaufen -, erhält in Warners Inszenierung einen Dreh ins Heute. Seine Hexen tragen Krawatten und weiße Kittel, deren Säume blutbespritzt sind. Das trägt dem Ansinnen Blochs Rechnung, nimmt aber den Hexen Shakespeares viel von ihrem Zauber. Warner lässt die Oper spielen in den Jahren, in denen Bloch an ihr gearbeitet hat, seine Bilder zitieren die Schlachtfelder des Ersten Weltkriegs. Eine arge Unruhe indes entsteht durch den exzessiven Einsatz der Drehbühne. Rotierend zeigt sie Bankettsaal und Schlafzimmer, Traumlandschaft und Schlachtfeld. Daniel Sumegi als Macbeth ist zu Beginn ein wenig soldatisch-steif, gewinnt aber an Statur und Schwung. Vollends in der langen Arie, mit der Macbeth sich in sein Schicksal ergibt, zeigt der Bassbariton seine Qualitäten. Louise Winter ist eine arge Lady Macbeth, die ihm einflüstert, ihn mit verführerischer Stimme lockt (und mit sicherem Sopran gefällt, mal weich und biegsam, dann wieder fordernd und schneidend). Später wird sie - eine große Szene - dem Wahn verfallen. Für die fehlende Plausibilität kann sie nichts, die gibt das Stück nicht her. Deutlich hinter ihre Leistung zurück fallen darstellerisch und stimmlich die schottischen Edelmänner, ob Banquo, Macduff, Lennox oder Malcolm. Am Ende eines jeden Aktes darf der Opernchor zeigen, was er mit Alessandro Zuppardo einstudiert hat: vortrefflich einstudierte Massenszenen und vielfarbig funkelnder Gesang. Hans-Jürgen Lazar gibt den Duncan würdevoll und stimmstark, hat dazu den bemerkenswertesten Auftritt: ein weißer Vorhang schießt ins Bühnendunkel, leuchtet auf, und hinter diesem Schleier verkündet Duncan die Thronfolge und spricht sich so sein Schicksal - noch in derselben Nacht beschließt man im Hause Macbeth seinen Tod. |
|
Farbenzauber, Espressivo Ernest Bloch hat nie am langfristigen Erfolg seiner einzigen, zwischen 1904 und 1909 entstandenen Oper gezweifelt. Obwohl die Pariser Uraufführung (1910) von einem antisemitisch aufgestachelten Publikum feindselig aufgenommen wurde und bis zur zweiten Aufführung in Neapel nicht weniger als 28 Jahre vergehen mussten, war er sich doch sicher, "dass ‹Macbeth› warten kann". Heute scheint es so, als sollte er Recht behalten. Nach der deutschen Erstaufführung in Dortmund 1998 hat sich nun die Oper Frankfurt in Kooperation mit dem Festival Klang-Bogen in Wien der englischen Fassung angenommen - und Blochs "drama lyrique" nach Shakespeare dabei so eindrucksvoll rehabilitiert, dass man es gerne dauerhaft im Repertoire verankert wüsste. Unumstrittene Hauptperson des Abends und massgeblicher Grund für den einhellig gefeierten Erfolg ist dabei die Musik selbst. Bloch findet hier zu einer betörenden, zwischen hitziger Expressivität und impressionistischem Farbenzauber oszillierenden Klangsprache, die vom Frankfurter Museumsorchester unter der Leitung von Sian Edwards ebenso sinnlich wie feinnervig dargeboten wird. Doch läuft das dreistündige Stück niemals Gefahr, sich selbstvergessen im eigenen Raffinement zu verlieren, sondern zeugt von einem bemerkenswerten Gespür für die dramatische Situation: Wie pointiert der - damals noch nicht einmal dreissigjährige - Genfer Komponist die Seelenzustände und -abgründe der Figuren mit düsteren Holzbläsersynkopen, gedämpftem Blech und tiefem Streichergemurmel nachzuzeichnen weiss, wie er den ersten Akt nach einer buffonesken Einlage plötzlich in einem atemberaubenden Accelerando zum chorgesättigten Ende führt, das ist schon erstaunlich. Diesem opulenten musikalischen Farbenreichtum begegnet der britische Regisseur Keith Warner mit einer streng stilisierten Schwarzweiss- Optik der Kostüme und der Bühne (Es Devlin), die von einem mächtigen, nach hinten sich verjüngenden Schaukasten beherrscht wird: ein überlebensgrosses Abbild jener antiquierten Kamera, in die der medienfixierte und -gesteuerte Macbeth immer wieder hineinschaut. Das verspiegelte Innere zeigt ihm schon während des Prologs Ausschnitte seiner düsteren Zukunft; auf die Vorderfront werden später seine Wahnbilder projiziert (Lichtdesign: Wolfgang Göbbel). Mit Hilfe der häufig eingesetzten Drehbühne generiert Warner daraus eine zweite Bewegungsebene und ergänzt das Rampengeschehen so um eine weitere Dimension. Wie in Zeitlupe lässt der Kasten im Hintergrund statische Momentaufnahmen an uns vorüberziehen, ist er eheliches Liebesnest oder verhüllter Tatort des Mordes an König Duncan und wird er am Ende selbst aktiver Teil der Handlung, wenn seine Wände Macbeth den Fluchtweg abschneiden. Ein immenser technischer und choreografischer Aufwand, der freilich nicht ganz ohne Pannen vonstatten geht. Dass die suggestive, meist in fotokammer- dunkle Beleuchtung getauchte Bildsprache der Inszenierung mitunter auch die eine oder andere Schwäche in der Personenführung übertüncht, wird insbesondere dann deutlich, wenn Daniel Sumegi auf der Bühne erscheint. Der hünenhafte kanadische Bariton meistert zwar die wahrhaft mörderische Titelpartie mit beeindruckender (wenngleich etwas hohl klingender) stimmlicher Potenz, wirkt jedoch in der Darstellung gelegentlich ein wenig schablonenhaft. Ganz anders sein weiblicher Gegenpart. Louise Winter verlässt sich nicht allein auf ihr dramatisches und gleichzeitig bronzefarben-warm tönendes Timbre, sondern durchlebt eine packende Rollenstudie der Lady Macbeth: eine von wütendem Ehrgeiz zerfressene, letztlich aber bemitleidenswerte Frau, die ihren schwachen Mann als halbe Domina gefügig macht. Wie sich die Britin in der Wahnsinns- Szene des dritten Aktes förmlich die Seele aus dem Leib singt und spielt, gehört zu den ganz grossen Momenten des Abends. Sein vor allem musikalisch überzeugender Gesamteindruck wird schliesslich durch die homogene Leistung des restlichen Ensembles abgerundet, aus dem die drei Hexen (Taina Piira, Michaela Friedrich und Enikö Boros) sowie Dietrich Volles Banquo sängerisch herausragen. MARCUS STÄBLER |