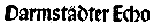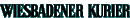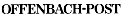|
World Weib Web VON BERNHARD USKE Einen kernigen Opernabend verspricht das Staatstheater Darmstadt mit der Neuinszenierung von Brecht/Weills Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny, die im Kleinen Haus der zurzeit umgebauten Betonschachtel an der Ludwigshöhe geboten wird. Famos ist die Akustik der normalerweise dem Sprechtheater vorbehaltenen Spielstätte, und das Kernige des Abends war mit den ersten Takten der von Raoul Grüneis dirigierten Musik offenkundig. Mit exzellenten, homogenen Artikulationen brillierte das Orchester des Staatstheaters und bot teilweise regelrecht veristischen Elan. Genauso prägnant erging man sich in nüchterner Trockenheit und punktgenauer rhythmischer Akkuratesse, wo ironisch und kritisch gemeinte Brechungen des operalen Glanzstoffs angesagt waren. Eine "epische Oper" haben Brecht und Weill 1929 geschrieben und damit eine Art schwarzen Schimmel gezeugt, denn spätestens wenn die Sänger den Mund zu mehr als bloß einem Bänkelsong oder einem Kampflied aufmachen, hängt an jeder ariosen Vokalfigur genau der emotionale Speichelfaden, dessentwegen man sich die krause Mischung aus bunten und meist etwas einfältigen Bühnenturbulenzen, gepaart mit meist vollständig unverständlichem Text, so gerne antut. Strahlender Kern Der Stoff, der das "Kraftwerk der Gefühle" versorgt, wie Alexander Kluge die Oper nannte, kommt aus den Gräben der Orchester und den Kehlen der Sänger, und so gesehen, war das, was man in Darmstadt geboten bekam, eine richtige Oper. In ihr vermochten die Vokalisten, allen voran Kor-Jan Dusseljee als Hauptfigur Jim Makoney, die operale Energie hemmungslos auszuspielen. Einen exzellenten, für jede Puccini- und Verdiaufgabe prädestinierten mühelosen Tenor bringt der Sänger mit und ist im Ensemble seiner Kollegen der strahlende Kern des Ganzen. Dreieinigkeitsmoses Hans-Joachim Porcher oder der Fatty von Jeffrey Treganza waren ebenso wie die Mahagonny-Wirtin Begbick von Elisabeth Hornung und die Jenny Hill von Anja Vinken qualifizierte Partner, und erst recht war es der Chor des Hauses, der den Tutti-Szenen durchschlagende Kraft verlieh. Aber das Konzept von der Oper als einem großen linksveristischen Erlebnis ging nicht auf, denn zur Besonderheit der Mahagonny-Tat gehört in erster Linie die Geist und Gemüt bewegende Dialektik des Textes - und den versteht man in Darmstadt überhaupt nicht. Allein auf die sprachlose Musik verwiesen, ist dann doch sehr schnell der Klang der epischen Oper zu kurzatmig, der Wechsel der ariosen Bruchstücke etwas holprig und die orchestrale Decke über den dürren Melodiekörpern der Partitur fadenscheinig. Unverständlich, warum man sich des zentralen Brecht-Mittels für eine intelligente Oper nicht stärker annahm und die mittlerweile bis herunter zur letzten Operette segensreich eingesetzte Overstage-Projektion lediglich für die wenigen Szenentitel des Librettos nutzte. So war man auf der Suche nach dem blitzenden und blinzelnden Raffinement des Mahagonny-Stoffs auf die Szene verwiesen, die sich im Bühnenbild von Thomas Gruber ganz zeitgemäß technoid und kühl-erratisch gab. Die frisch zu Geld gekommenen Goldfische im mit kostenpflichtigen Vergnügungen aufwartenden Haifischbecken der Profitmaximierung führen gemäß der Proklamation der neuen Mahagonny-Weltordnung des "Du darfst!" eine Art Tanz um das Goldenen Kalb auf, bevor die große Depression den Fall der Stadt ankündigt. Ob Mahagonny noch zeitgemäß sei, hatte sich das Team um Regisseur Philipp Kochbein gefragt und die "Netzestadt Mahagonny", wie sie bei Brecht heißt, als hellsichtige Vision einer weltweiten Webtechnik gesehen, die 75 Jahre nach der Uraufführung der Oper elektronisch die Menschen bestrickt. Auf der Bühne sah man aber nicht etwa die Konsumenten als Pornos herunterladende, im fun-shopping aktive oder im Snuff- und Splatterangebot sich bedienende Web-Nutzer, sondern, wie gehabt, als manifeste Flachklopfer des knappstbekleideten leichten Damenfleischs. "www.darmstadt-mahagonny.de" war also das wohlvertraute world weib web und als solches der die Operngläser in die Höhe tragende optische Hauptgewinn. Mit "www. georgebush. com" auf einem Werbetransparent zur Verkündigung der neuen "Du darfst"-Weltordnung war man höchst aktuell und hatte auch flugs God's own country als den eigentlichen Dreh- und Angelpunkt der Achse des Bösen ausgeguckt. Wie gut, dass auf Guantanamo die Häftlinge in orangefarbene Overalls gesteckt werden. So ergab sich mit der Inhaftierung und entsprechenden Einkleidung von Jim Mahoney, der natürlich auch gleich fürs Folterfotoalbum abgelichtete wurde, ein hübscher Farbtupfer vor den knallgelb und mit großdimensioniertem Millimeterpapiermuster gestalteten Bühnenwänden. [ document info ]Copyright © Frankfurter Rundschau online 2004 Dokument erstellt am 24.10.2004 um 17:08:37 Uhr Erscheinungsdatum 25.10.2004 |
|
Menschen auf der Schlachtbank Musiktheater: Philipp Kochheim deutet in Darmstadt „Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny" als satirische Zeitrevue Von Johannes Breckner DARMSTADT. Ein Gaunertrio landet in der Wüste. Die Polizei sitzt im Nacken, das Auto ist futsch – wie soll man da eine Stadt gründen? Die Oper „Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny" ist ein Dreivierteljahrhundert alt, und inzwischen gibt es technisch ausgefuchste Lösungen für dieses Plausibilitätsproblem. Fatty und Dreieinigkeitsmoses tragen Videobrillen und steuern den Entwurf der Megacity mit Cyberhandschuhen, als handele es sich um ein besonders raffiniertes Computerspiel. Witwe Begbick ist ihre Chefin in der Planungsfirma, und dass man irgendeine Strafverfolgung fürchtet, passt auch ins Bild. Wer solche Geschäfte macht, muss wohl eine gewisse kriminelle Energie mitbringen. Mit diesem Bild eröffnet Philipp Kochheim, der neue Oberspielleiter der Darmstädter Oper, seine Inszenierung des Stückes von Weill und Brecht. Es ist eine Geschichte, die an plakativer Botschaft kaum zu überbieten ist, aber das gehört zu der starken Wirkung, die diese Oper seit ihrer Uraufführung entfaltet. Ein paar Kriminelle gründen eine Stadt. Sie knüpfen ein Netz, um Menschen mit Geld zu fangen. Sie versprechen das Paradies und handeln mit dem Glück. Und weil das Glück nur käuflich zu erwerben ist, speit diese Gesellschaft die Ausgepressten aus. Das Angebot, alles zu dürfen, ist doch bloß eine Beschönigung für das nackte Recht des Stärkeren. Derlei kann man in allen Zeiten aktuell finden. Und es wäre falsch, allzu großen Hintersinn auf die Interpretation zu verschwenden. Man kann das Stück jeder Zeit entkleiden und so seine Parabelhaftigkeit deutlich machen. Kochheim entscheidet sich indes dafür, die ausgedeutete Parabel auf die Bühne zu bringen. Alles ist so aktuell, dass eine Inszenierung, die ja mehrere Monate auf dem Spielplan steht, vorzeitig zu altern droht. Am 2. November wählen die USA ihren Präsidenten – vielleicht ist danach Kochheims Wahlkampf-Parodie ein Stück von gestern. Wenn nämlich Jim Mahoney seine Rede hält, die in dem absoluten „Du darfst es" gipfelt, ein Manifest kapitalistischer Rücksichtslosigkeit, dann wird der Zuschauer in den amerikanischen Wahlkampf versetzt, und sogar der filmende Bush-Verfolger Michael Moore schleicht mit der Kamera über die Bühne. Ansonsten zeigt dieses Mahagonny das satirisch verzerrte Spiegelbild einer aktuellen Gesellschaft. Ständig wird am Handy herumgefummelt und mit dem Laptop hantiert, die Menschen werden vermessen und in Schönheitsoperationen perfektioniert, man schnupft Kokain und wedelt mit der Kreditkarte, man vergnügt sich beim Spiel, tanzende Teenager abzuknallen, der Fitnesswahn trabt über die Bühne, und vor allem in der ersten Hälfte der zweieinhalbstündigen Aufführung ist mehr los, als man erfassen kann. Einerseits missachtet dieses Arrangement alle notwendige Ökonomie der szenischen Wirkung, andererseits persifliert es die Reizüberflutung der Medienwelt. Der Zuschauer muss mit dem Auge zappen zwischen den Ereignissen. Am Anfang wirkt dieses Treiben auf Thomas Grubers vielseitiger Bühne eher dekorativ gedacht als inhaltlich durchdrungen, und die Oper schaut aus wie ein Stück Edel-Agitprop. Als Zuschauer möchte man oft rufen: Jaja, wir haben schon verstanden! Aber das würde die Musik stören, und die ist weniger gealtert als die Geschichte. Unter der Leitung von Raoul Grüneis entwickelt das Orchester, das ziemlich tief sitzt im Graben des Kleinen Hauses, eine ebenso klangsinnliche wie rhythmisch akzentuierte Wiedergabe dieser Partitur, wenn auch nicht alles makellos gelingt am Premierenabend. Vor allem die großen Ensemble-Finales und die eindringlichen Chorszenen (Einstudierung: André Weiss) verfehlen ihre kalkulierte dramatische Wirkung nicht. Und auch Kochheims Inszenierung gewinnt im Laufe des Abends an Überzeugungskraft. Zwar scheint der große szenischen Aufwand gerade die feineren Textdetails zu überdecken, und die Personenregie bringt selten mehr als stereotype Bewegungen zustande. Die Zeichnung der großen Rollen hingegen ist angemessen scharf: Elisabeth Hornung stattet den Managertyp ihrer Leokadja Begbick mit markanter Stimme aus. Unter ihren Gehilfen ist Jeffrey Treganza als Fatty der Mann fürs Grobe, Hans-Joachim Porcher als Dreieinigkeitsmoses liefert eine abgründige Studie des sanft-intellektuellen Gewaltmenschen. Jims Gefährten sind Jordi Molina Davila, Werner Volker Meyer und Andreas Daum scharf umrissene Charaktere. Jim selbst ist der unangepasste Glückssucher, dem Kor-Jan Dusseljee eine vor allem in hohen Lagen strahlend starke Tenorstimme mitgibt und auch das Talent, sie in der expressiven Abschiedsarie vor der Hinrichtung geschickt zu schattieren. Dass es sich bei seiner Beziehung zu Jenny um Liebe handelt und um Verrat, wird in dieser Inszenierung höchstens angedeutet. Aber das liegt vielleicht auch an der begrenzten Ausstrahlung Anja Vinckens, deren Jenny eine eher schöngefärbte als große Stimme mitbringt. In weiteren Vorstellungen wird sie sich mit Mary Anne Kruger abwechseln. Das Ensemble folgt Kochheim engagiert auf dem Weg der satirischen Zeitrevue, die sich allmählich ins Dunkle wendet. Immer ist die Aufführung hart am Rande der Überdeutlichkeit. Muss man Paragrafen an die Wand hängen, wenn das Gericht gegen Jim verhandelt? Ist es notwendig, durch Sponsorenwimpel auf der Richterrobe die Korrumpierbarkeit dieser Justiz zu zeigen? Sind, wenn Jim im Gefängnis sitzt, die Anspielungen auf die Erniedrigung von Häftlingen durch amerikanische Soldaten gerechtfertigt? Diese Oper ist eben nicht der Ort für differenzierte politische Debatten, sondern für kräftige Bilder. Und die gelingen Kochheim, je mehr sich seine Satire ins Dunkle wendet. Wenn der Hurrikan droht, bringt Jim ganz einfach und grundlos ein Kind um, als wolle er Brechts Botschaft illustrieren, dass der Mensch ja keinen Hurrikan braucht, weil er sich selbst genug Schaden zufügen kann. Die Schlussszene, in der keine Parolen mehr spazierengetragen werden wie noch von Brecht geplant, treibt das auf die Spitze. Wir sehen eine blutbesudelte Gesellschaft, in der die Metzger schon die Messer wetzen, und plötzlich hat dieser bunte Abend seinen bitteren Ernst gefunden, wenn er den Menschen auf seiner eigenen Schlachtbank zeigt. |
|
Kor-Jan Dusseljee (Mitte vorn) als Jimmy und Anja Vincken (rechts daneben) in Mahagonny. Foto: Aumüller Schauplatz Amerika Premiere in Darmstadt: "Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny" Von Axel Zibulski Eine fast sterile Kühle strahlt die Bühne aus. Millimeterpapier-Muster an den Wänden, kaltes Licht und anfangs ein kühner Aufriss der "Netzestadt" Mahagonny. Bertolt Brecht und Kurt Weills "Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny" hatte jetzt am Staatstheater Darmstadt Premiere, in dem derzeit nur das Kleine Haus für Opernproduktionen zur Verfügung steht. Dafür eignet sich Brecht/Weills Stück bereits wegen der überschaubaren Orchesterbesetzung bestens. Doch wie die Parabel von der Stadt, in der alles erlaubt ist, wenn man nur Geld hat, heute aufführen? Als aktuelles Stück, natürlich, daran lässt auch die Regie von Philipp Kochheim, seit dieser Saison Oberspielleiter in Darmstadt, keinen Zweifel. So fehlt in der modernen Stadt natürlich der Computer im Bühnenbild von Thomas Gruber nicht. Völlerei erfolgt zeitgemäß mit einem Fast-Food-Gelage. Dabei verlegt Kochheim sein Mahagonny mehr ins Heute als ins Hier, es bleibt in Amerika, wo sogar ein Plakat für "vier weitere Jahre" George Bush wirbt, kontrapunktiert von einem Kamera schwenkenden Michael-Moore-Double. Selbstredend trägt man als Häftling Guantánamo-Orange: Damit punktet die Regie im alten Europa natürlich. Allein von dem, was bei Brecht/Weill verhandelt wird, führt es eher weg. Auch Brecht/Weill wollten mit ihrer Parabel ja alles andere, als Geschichten aus der fernen Neuen Welt zu erzählen. Immerhin eignen sich solche Einfälle Kochheims zum revuehaften Amüsement, auch wenn gerade der erste Teil manche Durststrecke durchläuft. In der zweiten Hälfte wird das Geschehen auf der Bühne dichter. Und die Übertitelungsanlage spricht unmittelbar das Publikum an und erklärt, dass man uns die Darstellung der Hinrichtung auf dem elektrischen Stuhl nicht ersparen könne. Hübsche, weil werkdienliche Idee. Man hätte sich noch mehr davon gewünscht. Durchweg überzeugen kann bei der Premiere allerdings das Darmstädter Orchester, über dessen Wandlungsfähigkeit sich staunen lässt. Hörte man es zuletzt bei der Premiere von Monteverdis "L´Orfeo" noch als exzellentes Alte-Musik-Ensemble, so schlüpft es nun unter der Leitung von Raoul Grüneis ebenso leicht in die Rolle des federnden, süffigen Weill-Protagonisten. Mit Elisabeth Hornung ist eine spröde Witwe Begbick nahe der Hosenrolle, mit Anja Vincken eine kühle Jenny Hill zu erleben. Und Kor-Jan Dusseljee als Jim Mahoney, vor allem aber Hans-Joachim Porcher als Dreieinigkeitsmoses gelingt es tadellos, den Duktus zwischen Sprechen, Singen und Sprechgesang treffend zu variieren. |
|
Hinten wartet der Schönheits-Chirurg "Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny" von Brecht/Weill im Kleinen Haus in Darmstadt Von Jens Frederiksen Strahlende Chöre, wonnige Arien, mit Schmelz und viel Gefühl in den siebten Sopranhimmel bugsiert. Von Textverständlichkeit freilich ist da keine Spur - und von dem maliziösen Witz erst recht nicht, der zwischen süffigem Singsang und schonungslos realistischem Text nistet. Philipp Kochheims Darmstädter Inszenierung von Bertolt Brechts und Kurt Weills kapitalismuskritischer Oper "Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny" unter der musikalischen Leitung von Raoul Grüneis versinkt in Wohlklang und vergisst darüber die Kratzbürstigkeit. Dabei gibt es szenische Details, die durchaus als Provokation genommen werden können. Die Geschichte der "Netzestadt" Mahagonny, in der alles erlaubt ist und alles aufgeboten wird, damit der Holzfäller Jimmy Mahoney und seine Kumpane ihre Barschaft verschleudern, in der mit dem Spaß aber radikal Schluss ist, wenn den Kunden das Geld ausgeht - diese Geschichte voller zigarrenrauchender Machos und geldgieriger Halbweltdamen wird in Darmstadt bevölkert von Holzfällern in börsengeeigneten Nadelstreifen-Anzügen und von Hurenvolk, das je nach Rang innerhalb der Halbwelt-Hierarchie in Hollywood-Flitter oder in Sexshop-Peinlichkeiten aufmarschiert. Und mitten im Trubel sind auch der Jogger von nebenan, der "Man in Black" von der Kinoleinwand und der Allerwelts-Clown mit den Boxhandschuhen unterwegs, während im Hintergrund ein Chirurgen-Team unter Schnüren und Ösen eine Schönheits-OP zum vertraglich vereinbarten Ende zu bringen versucht. So weit, so gut. Doch die Fabel, in die all das eingehängt ist, bleibt eigenartig unscharf. Elisabeth Hornung als Leokadja Begbick, die Erfinderin der Amüsierstadt Mahagonny, kommt zwar mit Mae-West-Aplomb an die Rampe gerauscht, tiriliert dann aber so zahnlos schubertsch ins Ungefähre, dass sich ihr Sinnen und Trachten niemandem erschließt. Kor-Jan Dusseljees Jimmy ist von saturierter Wohlgenährtheit, sein Tenor unterstreicht auch die forcierte Eleganz seiner Erscheinung, doch der Artikulation fehlen die Ecken und Kanten. Und Anja Vincken als seine Gespielin Jenny hat zwar die Sentimentalität, nicht aber die fiese Aggressivität in der Stimme, die zu dieser Rolle gehört. So kommt nur derjenige, der in der Musik schwelgen will, in Darmstadt auf seine Kosten. Es gibt ein schön swingendes "Wie man sich bettet, so liegt man" und einen strahlenden, mit stampfenden Pauken und Trompeten versetzten Schlusschoral, zu dem der zum Tode verurteilte Jimmy Mahoney lässig wie ein auf seinen nächsten Einsatz wartender Entertainer an der Rampe posiert, während das übrige Stückpersonal an den Bühnenrändern nochmals das Gestenrepertoire der abgelaufenen Szenen ins Gedächtnis zurück bringt. Ein schönes Bild - aber keines, nach dem man klüger wäre als zuvor. Die Musik freilich klingt noch endlos lange nach - und so hätte man die Songs gerade in dieser Darmstädter Version furchtbar gern auf Platte oder CD. Auch wenn sie nur bedingt aufführungstauglich sind. |
|
"Mahagonny"-Premiere in Darmstadt
Guantánamo und Fast Food: Philipp Kochheim hat die Oper von Kurt Weill und Bertolt Brecht ins heutige Amerika verlegt. Eine fast sterile Kühle strahlt die Bühne aus. Millimeterpapier-Muster an den Wänden, kaltes Licht und anfangs ein kühner Aufriss der "Netzestadt" Mahagonny. Bertolt Brecht und Kurt Weills "Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny" hatte jetzt am Staatstheater Darmstadt Premiere, in dem derzeit nur das Kleine Haus für Opernproduktionen zur Verfügung steht. Dafür eignet sich Brecht/Weills Stück bereits wegen der überschaubaren Orchesterbesetzung bestens. Doch wie die Parabel von der Stadt, in der alles erlaubt ist, wenn man nur Geld hat, heute aufführen? Als aktuelles Stück, natürlich, daran lässt auch die Regie von Philipp Kochheim, seit dieser Saison Oberspielleiter in Darmstadt, keinen Zweifel. So fehlt in der modernen Netzestadt natürlich der Computer im Bühnenbild von Thomas Gruber nicht. Völlerei erfolgt zeitgemäß mit einem Fast-Food-Gelage, der Fitnesswahn trabt in Gestalt dreier Jogger über die Bühne. Dabei verlegt Kochheim sein Mahagonny mehr ins Heute als ins Hier, es bleibt in Amerika, wo sogar ein Plakat für "vier weitere Jahre" George Bush wirbt, kontrapunktiert von einem Kamera schwenkenden Michael-Moore-Double. Selbstredend trägt man als Häftling Guantánamo-Orange: Damit punktet die Regie im alten Europa natürlich, das soll auch gut sein so. Allein von dem, was bei Brecht/Weill verhandelt wird, führt es eher weg, wenn man den Fingerzeig so deutlich ins heutige Amerika ablenkt. Auch Brecht/Weill wollten mit ihrer Parabel ja alles andere, als Geschichten aus der fernen Neuen Welt zu erzählen. Immerhin eignen sich solche Einfälle Kochheims zum revuehaften Amüsement, auch wenn gerade der erste Teil seiner Inszenierung manche Durststrecke szenischen Leerlaufs nicht auslässt. In der zweiten Hälfte wird das Geschehen auf der Bühne dichter. Und die Übertitelungsanlage spricht, ganz im Sinne Brechtscher Verfremdung, unmittelbar das Publikum an und erklärt, dass man uns die Darstellung der Hinrichtung auf dem elektrischen Stuhl nicht ersparen könne. Hübsche, weil werkdienliche Idee. Man hätte sich noch mehr davon gewünscht. Durchweg überzeugen kann bei der Premiere allerdings das Darmstädter Orchester, über dessen Wandlungsfähigkeit sich staunen lässt. Hörte man es zuletzt bei der Premiere von Monteverdis "L’Orfeo" noch als exzellentes Alte-Musik-Ensemble, so schlüpft es nun unter der Leitung von Raoul Grüneis ebenso leicht in die Rolle des federnden, süffigen Weill-Protagonisten. Mit Elisabeth Hornung ist eine spröde Witwe Begbick nahe der Hosenrolle (Kostüme: Bernhard Hülfenhaus), mit Anja Vincken eine kühle Jenny Hill zu erleben. Und Kor-Jan Dusseljee als Jim Mahoney, vor allem aber Hans-Joachim Porcher als Dreieinigkeitsmoses gelingt es tadellos, den Duktus zwischen Sprechen, Singen und Sprechgesang treffend zu variieren. AXEL ZIBULSKI |
|
... Wir sind alle Gefangene der Konsumsucht, rücksichtsloser Gier und Lust. So behauptet es Regisseur Philipp Kochheim ... im Staatstheater Darmstadt und siedelt Brechts verkommene "Netzestadt" Mahagonny im Innern eines Computers an- oder vielmehr im World Wide Web. Die Wände bestehen aus den grünen Gittern und Punkten einer Matrix. Dem gleichnamigen Kinofilm entsprungen scheinen die Gangster Fatty und Dreieinigkeitsmoses in schwarzen Mänteln, die ihrer Anführerin Leokadja Begbick mit Cyberbrille und -handschuh ein virtuell reales Mahagonny erschaffen, ein dekadentes "Männerparadies" ... Im Kontrast dazu lässt Bühnenbildner Thomas Gruber griechische Tempelsäulen aufsteigen, die mit Büchern bestückt sind: Bildungssäulen der Menschheit-auch ein Computer wird aus Informationen programmiert. Jim Mahoney kann in Mahagonny aber keine Bildung, geschweige denn Gesetze brauchen. Der schmierige James- Cagney-Verschnitt, dem Gastsänger Kor-Jan Dusseljee allem Gangster-Gehabe zum Trotz seidenweich heldentenorale Töne entlockt, will Spaß. Also verbrennt er die Bücher und tritt mit dem Motto "Du darfst alles, solange du Geld hast" die Wahl an ... Begbick, die Kostümbildner Bernhard Hülfenhaus mal in Männeranzüge oder in schulterfreie Abendkleider und riesige Hüte steckt, beherrscht Mahagonny als gewiefte Mannfrau ebenso wie ihre Stimme, unterwirft sich Jims Ideen zunächst, um ihm am Ende als Richterin doch noch den Garaus zu machen, setzt ihren Mezzosopran dabei mit scharf vibrierender Höhe, schmeichlerisch runder Mittellage und mannsartigem Brustton der Vernichtung ein. Denn Jim ist prompt in die Grube gefallen, die er sich mit seinem Wahlslogan selbst gegraben hat: Weil er "Whisky und Storestange" nicht mehr bezahlen kann, wird er zum Tode verurteilt ... Unterhalten wird man an diesem Abend aber trotzdem-auch dank des Orchesters des Staatstheaters, das seinen engagierten Dirigenten Raoul Grüneis mit präzisen Streicherläufen, fast immer sauber intonierten Holz- und Blechbläserakkorden und schwülem Saxophonsäuseln entlohnt. URSULA BÖHMER |
|
Im Staatstheater Darmstadt hat Philipp Kochheim das Brecht-Stück vom "Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny" inszeniert. Von Matthias Gerhart Rechtzeitig zum amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf also diese fundamentale Kritik an der Macht des Geldes, dem Kapitalismus und der Zügellosigkeit. Regisseur Philipp Kochheim hätte sich deshalb erst gar nicht die Mühe machen müssen, die Internet-Adresse von George Walker Bush einzublenden. Damit landete er allerdings einen der wenigen zündenden Regieeinfälle einer ansonsten etwas flachen Angelegenheit. Besonders ärgerlich in der Darmstädter Premiere war die Tatsache, dass man kaum etwas von Bertolt Brechts Wort- und Reimgewandtheit verstand. Ohne die inhaltlichen Zusammenhänge freilich bleiben die Melodien von Kurt Weill blass, die Handlung unverständlich. Nun gibt es ja einige, von den Männern der Stadt Mahagonny besonders bevorzugte Beschäftigungen, die auch ohne spezielle inhaltliche Erläuterungen erkennbar sind. Damit wären wir bei der – natürlich käuflichen – Weiblichkeit dieser Retortenstadt im Wilden Westen angelangt, die in Darmstadt vor allem von Anja Vincken in der Rolle der Jenny verkörpert wird. Aber auch Elisabeth Hornung gefiel in der schauspielerisch und sängerisch anspruchsvollen Rolle der Begbick, wenngleich der leicht polnische Akzent ihrer Aussprache zuweilen auch etwas untypisch klang. Die in dieser Inszenierung fast völlig fehlende individuelle Charakterzeichnung der wichtigsten Darsteller konnte auch mit den stimmlichen Qualitäten ihrer Darsteller nicht ausgeglichen werden. Immerhin konnte man sich an den guten und tragfähigen Stimmen von Jeffrey Treganza (Fatty), Hans-Joachim Porcher (Dreieinigkeitsmoses) und vor allem Kor-Jan Dusseljee in der Rolle des Jim Mahoney erfreuen. Er, in dessen Namen ja das Wort "Money" steckt, ist am Ende der Ärmste von allen. Weil er kein Money hat, um die Zeche zu zahlen, wird er zum Tode verurteilt. Und statt ihm finanziell aus der Patsche zu helfen, vergießen die anderen nur dicke Krokodilstränen über ein angeblich zu hartes Urteil. In dieser Untergangsstimmung musizierte das von Raoul Grüneis geleitete Orchester des Staatstheaters ausgesprochen zuversichtlich. Es hat während der Umbauphase ja nunmehr ausreichend Gelegenheiten, sich in kleineren Formationen zu produzieren. Insofern zeigten sich die baulichen Fährnisse des Hauses wieder als Herausforderung für alle Beteiligten. Schon deshalb war der herzliche Schlussbeifall verdient. |