|
Zickige Damen treffen bockige Herren VON HANS-KLAUS JUNGHEINRICH
Der Literaturprofessor Volker Klotz kennt einen verborgenen Schatz von hundert und mehr musikalischen Theaterstücken, der gehoben werden könnte und sollte: den immensen Fundus der goldenen, silbernen oder wie auch immer kostbar-köstlichen Operette, ein verdorbenes, vernachlässigtes, trampelhaft bedientes Genre, erst recht verscheucht durch das zumeist gröblichere Musical und überhaupt die für das Unterhaltsame zuständige Popmusik. Als Intendant eines speziell der Operette dienenden Theaters wäre Klotz nicht verlegen, ein Dutzend Spielzeiten mit je einem Dutzend lohnender Werkausgrabungen lohnend und spritzig zu bestreiten. Startschuss zum Durchbruch Ganz so forsch geht Darmstadts neuer Theaterleiter John Dew diese Angelegenheit nicht an; indem er aber jetzt Emmerich Kálmáns einst zum Kernrepertoire der heiteren Bühnenmuse gehörende Gräfin Mariza zur Chefsache machte und ihr als Regisseur die Liebe und Aufmerksamkeit angedeihen ließ, die einem großen Kunstwerk gebührt, gab er vielleicht so etwas wie den Startschuss zu einem Durchbruch. Zur künstlerischen Nobilitierung des kitschverdächtigen Genres. Dessen phantasievolle, nichtvulgäre Präsentation löst sicher kein populäres Massenecho aus, zeigt aber dem Opernpublikum, wie reizvoll sich auch ein dem Leichten zugewandter Ernst auswirkt. Es geht dabei um hübsch bis glanzvoll polierte Oberflächen. Eine besondere Interpretation der Handlung scheint nicht vonnöten. Deren klischeehafter Schnickschnack um ehrpusselige Gefühle adliger Protagonisten, einst Traum- und Leitbildern für die operettensüchtigen Ladenmädchen und -schwengel, kann getrost vernachlässigt werden. Aktuell und ewig aber nach wie vor der Adel einer effektvollen Gutangezogenheit auf der Bühne (Kostüme: José Manuel Vásquez). Und mit den "Gefühlen" haben zweieinhalb Stunden Aufführungsdauer ihr Auslangen an: zickig (Damen) und bockig (Herren). Damit lässt sich's schon trefflich ausrichten. Und der virtuose Zauberer John Dew ist keinen Moment verlegen ums dekorative Arrangement und einen prickelnden, bestgewürzten Spielablauf. Wohlgelaunt und gutmütig und mit der "gedächtnislosen" Klugheit, die einer Scharade von exquisiten Schau- und Hör-Nummern gebührt, schafft er Trubel und Wirbel auf der Szene, und keinen Gag lässt er zu, der schwer und dröhnend die Eleganz des Spiels vergewaltigen würde. Es herrscht also ein wunderbares Gespür für die Untiefe und Unbeladenheit einer Form, die sich im Vollzug schöner Nichtigkeiten erfüllt und damit doch auch gewissermaßen eine philosophische Dimension offenbart: die freundliche Seite von "Vanitas", das Versöhnliche an den Eitelkeiten des Lebens und der Kunst. Der zum Rutengänger des Schönen gewandelte John Dew (er schickt sich an, alternativ zu seinem ehemaligen szenographischen Dekonstruktivismus tatsächlich eine "zweite" Handschrift zu entwickeln) bleibt gleichwohl sensibel für die Gefahren von Glätte und den Dégout des allzu Routinierten. Thomas Grubers betont kühles Bühnenbild wirkt denn auch mit seinem dominierenden Schwarzweiß als ein angenehm modernisierter Schauplatz. Statt von einer antiquierten notorischen Operettentreppe tritt die strahlende Titelfigur inmitten eines Blütenkelches aus ihr zu Füßen liegenden, ihre weißen Handschuhe anbetend ihr entgegenstreckenden Smokingträgern auf. Und typisch für die geschmackvoll-dezente Musikalität der Spielführung ist der akkurat zur musikalischen Fermate platzierte Handkuss. Zum genialsten Augenblick wird ein "Striptease" der beiden Hauptfiguren auf weit voneinander entfernten Couchelementen - ein Inbild selbstverliebter, gleichwohl ans scheinbar unbeachtete Gegenüber adressierter erotischer Verzückung. Statt illusorischer Handlungs-Stringenz mithin ein sanft taumelnder Reigen von sorgfältig ausziselierten szenischen Medaillons, mit umwerfendem Witz und entfesselter Körpersprachlichkeit. Ausnahmslos alle Rollen waren entsprechend perfekt besetzt und bravourös realisiert. Als Mariza gesanglich zart insistent, figürlich von unfehlbarer Ausstrahlung: Nicola Beller Carbone, selbstverständlich auch gewandte Trägerin ansehnlicher Gewänder. Als tänzerisch animierter lustiger Springteufel: Jeffrey Treganzas Zsupan. Seine mädchenhafte Partnerin Lisa: Stephanie Maria Ott. Und, damit das Ganze nicht zu glatt geriet: Wolfgang Schwaninger als seriöser Liebhaber Tassilo, mehr zerknirscht und waldschrathaft widerborstig als verbummelt, eben kein konventioneller Operettentenor, dabei stimmlich differenziert und, wenn nötig, auch mit Spitzentönen "siegreich". Auch musikalisch war's Chefsache: Stefan Blunier zauberte die - gerade durch längeren Nichtgebrauch wieder frische - ungarisch-wienerische Musik mit Verve, aber ohne Drücker, ohne aufgesetzten Schmiss, und bewies mit dem hervorragend disponierten Chor und Orchester, dass Melodieseligkeit (da reiht sich ein ingeniöser Einfall an den andern) ein legitimer Kunstwert sein kann. Die Partitur, hier ein Füllhorn liebenswerter Preziosen. Operettenfex Volker Klotz kann aufatmen: die Operette lebt. [ document info ] Dokument erstellt am 23.01.2005 um 17:28:06 Uhr Erscheinungsdatum 24.01.2005 |
|
Operette wie aus dem Bilderbuch Premiere: John Dew inszeniert Emmerich Kálmáns „Gräfin Mariza" im Staatstheater Darmstadt – Stefan Blunier dirigiert Von Heinz Zietsch DARMSTADT. „Trotzkopf – Dickschädel" giften sich Gräfin Mariza und Graf Tassilo gegenseitig an. Sie können so rasch nicht zusammenfinden, weil sie beide zu stolz sind. Die Gräfin, weil sie glaubt, Tassilo sei auch einer dieser dahergelaufenen Mitgiftjäger, und ihr männlicher Widerpart, weil er als verarmter Adliger sich für nicht ebenbürtig hält. Dabei lieben sich beide von Anfang an. Sie wollen ihre Liebe vor lauter Stolz nur nicht zulassen. Würden sie es, dann wäre die Operette „Gräfin Mariza" von Emmerich Kálmán gleich vorbei; doch so braucht diese einfache Geschichte mitsamt Pause im Kleinen Haus des Staatstheaters Darmstadt dann doch ihre knapp zweieinhalb Stunden. Und dem Publikum wurde eine Operette wie aus dem Bilderbuch aufgetischt. Dafür applaudierte es am Ende lange, begeistert und heftig. Eine derart lebendige, geschmack- wie niveauvolle Operetteninszenierung hat man in Darmstadt schon lange nicht mehr erlebt. Regisseur John Dew nimmt das Stück ernst und entwickelt dabei wunderschöne Szenen, als seien sie für ein Musterbuch der Operettenregie gestellt. Er inszeniert ganz konventionell am Stück entlang und serviert dennoch immer wieder neue Überraschungen. Gleich der Beginn ist eine solche: Manja, die wahrsagende Zigeunerin, kommt hinter dem noch geschlossenen Vorhang während des Vorspiels hervor, geht durch die erste Parkettreihe und liest einem Zuschauer aus der Hand: „Sie werden noch viele schöne Theaterstunden erleben". Die erlebt der Zuschauer dann tatsächlich, und auf der Bühne wird Manja (Elisabeth Hornung mit fülliger, üppiger Stimme) Mariza ihren künftigen Liebhaber prophezeien. Sobald die Gräfin erscheint, werfen sich die Männer ihr buchstäblich zu Füßen, umschwirren sie wie Motten das Licht. Dazu werden nur die weißen Handschuhe der am Boden liegenden Männer angestrahlt. Überhaupt entwickelt im ganzen Stück eine genau kalkulierte Lichtregie zauberhafte Wirkungen. Ähnlich formieren sich zu Beginn des zweiten Aktes Tennis spielende Damen, derweil Tassilo zum Foxtrott pikant-frivol sein Liedlein trällert: „Pardon, ich komme schon, ich will die Damen gern bedienen". Wolfgang Schwaninger singt seine Partie des Grafen mit Schmelz in der präzisen Stimme, hat viel Fundament in der Tiefe, das ihm in der Höhe etwas fehlt. Doch über allen anderen brilliert Nicola Beller Carbone in der Titelpartie. Großartig, wie sie die Tiefen ausschöpft und in den Höhen noch robusten Stimmenglanz zeigt. Eine erstklassige Sängerdarstellerin, in jeder Phase souverän und durchweg die ideale Verkörperung der Mariza. Andreas Daum versteht als sehr von sich überzeugter Fürst Populescú wunderbar zu sächseln, doch er weiß auch faszinierend zu steppen. Und Jeffrey Treganza als Schweinezüchter Zsupán bringt bewundernswerten tänzerischen wie sportiven Schwung in das Ganze und verleiht dennoch seiner ebenso gewandten Tenorstimme genügend Raum. Die ideale Ergänzung zu der eher verhalten wirkenden Lisa der Stephanie Maria Ott. Klar, dass der verarmte Tassilo noch finanzielle Hilfe braucht, um der Gräfin ebenbürtig zu sein. Die kommt in Gestalt der Fürstin Cuddenstein (herrlich gespielt von Ulrike Leithner) daher, die noch ein kauziges Faktotum namens Penizek im Schlepptau hat, das fast sämtliche berühmten Theaterstücke rauf- und runterzitieren kann, darunter auch den „Datterich", worüber sich die Darmstädter natürlich besonders freuen. Zum Lachen komisch und behende spielt ihn Stefan Umhey (im richtigen Leben Musiktheater-Souffleur). Doch ohne die Hilfe seines großartigen Regieteams hätte Dew wohl keine derart fantasie- wie schwungvolle Inszenierung auf die Bühne bringen können. Allen voran die fantastische Choreografie von Anthoula Papadakis, die dafür sorgt, dass das Stück tänzerisch durchgestaltet wird. Das raffinierte Bühnenbild in Form eines klassizistischen Säulenpavillons lässt die Bühne größer erscheinen, als sie ist. Die Pflanzenkulissen im Hintergrund könnten Gustav Klimts jugendstilartigen Ziergewächsen entsprungen sein. Das alles hat Thomas Gruber entworfen und führt den Zuschauer damit in die Zeit der alten k.u.k-Herrlichkeit. José Manuel Vázquez darf ein veritables Kostümfest entfachen, bis hin zu folkloristisch-ungarischen Färbungen fürs Finale dieser Operette. Hinzu kommt ein von der Regie und Einstudierung (André Weiss) her glänzend geführter Chor. Doch den letzten Schliff bringt das Orchester des Staatstheaters unter der Leitung von Generalmusikdirektor Stefan Blunier. Wann hat es das jemals hier gegeben, dass ein Regie führender Intendant und ein Generalmusikdirektor sich mit einer Operette befassen und sich so ideal ergänzen? Blunier fächert die Partitur einerseits wunderbar durchsichtig auf, bis hin zu den leisesten Stellen, und packt andererseits massiv zu, dass der Klang geradezu süffig ausgespielt wird und dennoch leicht, elegant und beschwingt daherkommt. Durch die Lautstärke des Orchesters, das sich akustisch im Kleinen Haus vehementer bemerkbar macht als im Großen, wird allerdings die Verstehbarkeit des Textes oft beeinträchtigt. Dew ist mit „Gräfin Mariza" ein weiterer beachtlicher Wurf gelungen. Alles greift hier derart ineinander, dass daraus eine geschlossene, gut ausbalancierte, Auge und Ohr erfreuende Inszenierung geworden ist. Jetzt wartet man hier nur noch auf ein Musical, das Dew hoffentlich ebenso faszinierend in Szene setzen wird. Versprochen hat er’s ja. |
|
Gräfin bittet zum Tennismatch Von Matthias Gerhart Die vielseitige und gute Tradition, die Darmstadt mit der Aufführung von Operetten begründet hat, wird auch in der Amtszeit von John Dew fortgeführt. Der neue Intendant setzte dafür mit einer eigenen "Gräfin-Mariza"-Inszenierung ein markantes Zeichen. Wenn nur alle Operetteninszenierungen landauf, landab ein solches künstlerisches Niveau aufbieten würden; manch farbloses Musical-Spektakel wäre bald überflüssig. Der Erfolg von Emmerich Kálmáns Operette hing aber nicht nur an den sängerisch durchweg beachtlichen Leistungen des Ensembles sowie einem bemerkenswert spritzig und agil musizierenden Orchester unter der Leitung des sorgfältigen Generalmusikdirektors Stefan Blunier. In Darmstadt versteht man es auch, sich tänzerisch in Szene zu setzen. Und so wirkte das vertrackte Geschehen um die Gräfin Mariza (Nicola Beller Carbone) und den Inkognito-Grafen und Verehrer Populescu (Andreas Daum) endlich einmal nicht so steif und starr, wie man es aus mancher Tingel-Tangel-Tourneeaufführung kennt. Freilich fesseln an dieser Operette altbekannte Melodien wie "Komm, Zigan" oder "Komm mit nach Varasdin". Die Bekanntheit der Musik und auch manch gute sängerische Leistung wird aber geschmälert, wenn die Akteure gelangweilt an der Rampe stehen. Aber davon war in Darmstadt nichts zu spüren. Schon der Auftritt des Barons Zsupán war diesbezüglich eine Meisterleistung. Die Beweglichkeit, die Jeffrey Treganza mit seiner Stimme demonstrierte, schien sich auf seinen gesamten Körper auszubreiten. Wen wundert es, dass dieser Pfiffikus den Frauen am Hofe ordentlich den Kopf verdreht. Schön war auch der Tenniseinsatz im zweiten Akt. Am besten aber gelang John Dews Regie die Szene mit der närrischen Fürstin Bozena (Ulrike Leithner) und ihrem zwar tollpatschigen, aber doch sehr belesenen Kammerdiener Penizek (Stefan Umhey). Dieser Mann beherrschte nicht nur das clowneske Element seiner nicht gerade einfachen Rolle virtuos, sondern hatte zur Feier des Tages auch noch Zitate aus dem "Datterich" parat. Wer in Darmstadt mit dieser Lokalposse auftritt, erhält von vorneherein den stärksten Schlussapplaus. Mit John Dew haben die Südhessen einen Theaterchef ergattert, der sich in die Herzen der Darmstädter hinein zu inszenieren versteht. |
|
Schmonzette als Glücksgriff Die Ohrwürmer wollen selbst am Tag nach der Premiere partout nicht aus dem Sinn. Wie auch immer man zu Emmerich Kálmáns Operette "Gräfin Mariza" steht: "Wienerlied" und Csárdásklänge haben dem 1924 uraufgeführten Stück aus der Spätblüte des Operettenzeitalters eine Popularität gesichert, die jetzt auch am Staatstheater Darmstadt anhielt. Nicht zuletzt sorgte Intendant John Dew, seit Beginn der Spielzeit im Amt, mit seiner Regie für einen Publikumserfolg. Endlich, muss man sagen. Denn seit Dew antrat (und die Musiksparte zum Ausweichen ins Kleine Haus gezwungen ist), wollte in Sachen Oper nichts so recht gelingen. Dews eigene Inszenierung von Monteverdis "L'Orfeo" beschränkte sich auf atmosphärische Bilder. Dass er einigen Ensemblemitgliedern zwischenzeitlich gekündigt hat, sorgte im Stamm-Publikum für Verstimmung. Besonders ärgerlich aber waren die beiden Inszenierungen des Oberspielleiters Philipp Kochheim, der Brecht/Weills "Mahagonny" und Rossinis "Barbier" nur schrill-oberflächlich servierte. Doch Regie-Routinier Dew hat jetzt mit "Gräfin Mariza" gezeigt, dass es in Darmstadt besser geht. Nur vordergründig wirkt seine Inszenierung in ihrer Entstehungszeit verhaftet, bildet die Durchgangshalle mit Säulen und augenzwinkerndem Schweinchen-Muster im Bühnenbild von Thomas Gruber den mondänen Rahmen eines Operettengeschehens aus vergangener Zeit und zugleich die prächtige Kulisse für das Schaulaufen des Chores in üppigen Kostümen (von José Manuel Vázquez). Bereits das erklärt wohl die Begeisterung des Publikums. Aber Regisseur Dew bietet mehr, hält der Operette sozusagen den Spiegel vor und lässt vorab Ensemblemitglied Elisabeth Hornung (Manja) erklären, dass in guten Operetten immer "Zigeuner" auftreten würden. Zugleich aber liefert er forsches Spiel, viel szenische Auflockerung und Tanz: Marizas Verehrer Zsupán (Jeffrey Treganza) und Populescú (Andreas Daum) legen eine flotte Stepp-Nummer vor. Und das obligatorische Faktotum, hier in Gestalt des Kammerdieners Penizek, gibt Stefan Umhey nicht nur mit genau choreografierter Wendigkeit, sondern auch mit einem Zitat aus dem Darmstädter Lokalstück "Datterich" auf den Lippen - so lässt man sich selbst den oft bieder wirkenden Lokalbezug auf der Bühne gefallen. Vokal zu gefallen - das gelingt der Mariza von Nicola Beller Carbone dank mühelos erreichter Höhen, silbrigem Timbre und trotz verbesserungsfähiger Artikulation besser als Wolfgang Schwaninger (Tassilo), der nur langsam zu operettentenoraler Leichtigkeit findet. Über solche Unbeschwertheit verfügt das Orchester des Staatstheaters von Anfang an, zumal Generalmusikdirektor Stefan Blunier die Melodien-Seligkeit auch instrumental süffig auskleiden lässt. Mit Blunier und Dew gelingt die Darmstädter "Mariza" als Chefsache gleich doppelt. AXEL ZIBULSKI |
|
Zum Schweinemelken großartig Von Claus Ambrosius
Wenn sich ein Intendant nicht zu fein ist, eine Operette zu inszenieren und der Generalmusikdirektor höchstselbst die musikalische Leitung übernimmt, braucht man eigentlich nicht nach dem Stück zu fragen: Es ist fast immer Straußens "Fledermaus", die als allgemeine geschätzte Spitze des Genres an vielen erlauchten Premiumhäusern die einzig hoffähige Operette ist. Nicht so in Darmstadt: In seiner zweiten Inszenierung am Haus legt John Dew eine Interpretation von Kalmans "Gräfin Mariza" hin, die - neben der "Lustigen Witwe" in der Deutung durch Christian von Götz in Wiesbaden - das Sehenswerteste ist, was in den letzten Jahren an Operette auf die Bühnen der Region kam. Zigeunerfolklore und Kinderchor raus, Spaß und Tempo rein: Wer sich mit Recht häufig an den schon zur Entstehung 1924 reichlich veralteten Klischees der rassigen Wahrsagerin Manja oder den ewig auf den ersten Silben betonenden Knallchargen störte, kommt hier voll auf seine Kosten. Warb eine "Mariza"-Produktion in Wiesbaden vor gut zehn Jahren noch mit einer "echten Zigeunerkapelle" auf der Bühne, so ist die Darmstädter Version in die Goldenen Zwanziger versetzt. Elisabeth Hornung übernimmt im Männeranzug als Conférencier und Dea ex machina das Strippenziehen in der Handlung um die reiche Gräfin und den verarmten Grafen Tassilo. Sie singt - leider reichlich unverständlich - das Lied der Manja und hält die Handlung immer dann geschickt am Laufen, wenn sie ins Stocken zu drohen gerät. Das Stück scheint dem Produktionsteam einen Heidenspaß gemacht zu haben: Thomas Gruber hat einen Einheitsraum mit heftig kassettierten Säulen gebaut, den ein Freskenfries aus Schweinesilhouetten ziert - immerhin geht es mit den 18 000 Schweinderln der Gräfin und den 20 000 ihres Möchtegern-Verlobten Koloman Zsupan ja um die "größte Schweinerei von Europa". José Manuel Vásquez´ Kostümorgie ist atemberaubend: Allein das Aufrittskleid der Gräfin dürfte posthum manchen Musikfilmstar erblassen lassen. Den vielen großen Musikproduktionen des frühen Kintopps sind viele Szenen entlehnt, die gar nicht erst versuchen, eine illusionistische verpackte Handlung zu erzählen: It´s showtime auf der Darmstädter Bühne, und diese Show kann sich sehen lassen. Von tief empfundenen Duetten ("Einmal möchte ich wieder tanzen" als getrennte Umkleide-Ekstase der Liebenden) bis zu herrlich kitschigen Übertreibungen a la Walter Bockmayers "Geierwally", wenn Mariza in Magdkleidung mit umgeschnallten Schemel aufbricht, um die Schweine (sic!) zu melken. Großartiger Finalcoup: Nach dem - wie bei Kalman so oft - unbefriedigenden Schluss erzählt Dew zu Musik des Stückes, was danach geschieht: Die Paare finden sich zur Gruppenhochzeit - ein herrliches Schlussbild, das gleich als erster Applausdurchlauf der Premiere genutzt wurde. Stefan Bluniers Leistung mit dem topmotivierten Orchester kann kaum hoch genug gelobt werden: Diese Feinheiten zwischen Csardas und Shimmy findet man nicht einmal in den besseren der zahlreichen "Mariza"-Aufnahmen. Nicola Beller Carbone ist eine hinreißend schöne Mariza - allein, ihre schöne Stimme, ihre Beweglichkeit und das versierte Spiel machen ihren Gesang kein Gran wortverständlicher. Ein Tassilo aus dem Bilderbuch ist Wolfgang Schwaninger mit kultiviertem Tenor, Stephanie Maria Ott gibt eine überzeugend naiv-junge Lisa. Ein artistische Leistung auf ganzer Linie bei annehmbarer Gesangsleistung bringt Jeffrey Treganza in der Bufforolle des Zsupan: Allein für diesen Darsteller, ein Typ zwischen Ursli Pfister und Mirko Nonchev, lohnte sich schon der Besuch dieses Ausnahme-Abends. Wo bleibt die Plattenfirma, die hier einmal ihre Mikrofone hineinhält? |
|
Faszination der Ohrwürmer
Die klassische Operette erweckt jedoch mit ihrem einfachen Weltbild und ihrer speziellen Art von Musik bei den Zuhörern mit nahezu suggestiver Wirkung Assoziationen an frühere, vermeintlich bessere Zeiten. Da geht es immer um Barone, Grafen und Fürsten, hin und wieder ist mal einer verarmt, aber nur kurzfristig, die Menschen sind schön, gut und reich und die Domestiken herzig und sich ihres Platzes in der Gesellschaft bewusst. Dabei kennt die Operette keinen Humor im eigentlichen Sinne, der nämlich zwangsläufig mit (Selbst-)Ironie gepaart ist. Die Operette und ihre Protagonisten nehmen sich bei aller Leichtigkeit bitter ernst, und der Schwank und Witz auf der Bühne ist ein dramaturgisch verordneter, der grundsätzlich eher von subalternen oder nicht ganz ernst zu nehmenden Figuren geliefert wird. Die Hauptpersonen jedoch ermöglichen erst mit ihrem tiefen Ernst die Identifikation des Publikums mit ihnen. Soweit zum Grundsätzlichen, das anzusprechen sich angesichts des Reizwortes "Operette" geradezu anbietet. In Darmstadt hat Intendant John Dew höchstpersönlich die Verantwortung für die Inszenierung von Emmerich Kálmáns "Gräfin Mariza" übernommen. Auf der musikalischen Seite assistiert ihm GMD Stefan Blunier. Dew hat sich die einzig richtige Interpretation des Librettos entschieden: Tempo und Leichtigkeit, Verzicht auf jedwede gesellschaftliche Problematisierung. Woraus besteht dieses Libretto? Nun ja, Operette halt: Herz - Schmerz - Happy End, Irrungen - Wirrungen - Wohlgefallen. Die reiche, schöne Gräfin Mariza wird von geldgierigen Freiern bedrängt, der unschuldig verarmte Graf Tassilo arbeitet inkognito als Verwalter auf ihrem Anwesen, wo er zufällig auf seine eigene Schwester Lisa trifft. Gräfin und verkappter Graf kommen sich näher, doch als Mariza ein angebliches Techtelmechtel Tassilos mit Lisa hinterbracht wird, feuert sie ihn unter demütigenden Umständen. Auch die Aufklärung des geschwisterlichen Verhältnisses kann den gekränkten Stolz der beiden Protagonisten nicht aufweichen. Da muss als "dea ex machina" erst Tassilos Tante Bozena Cuddenstein zu Chlumetz mit ihrem skurrilen Kammerdiener auftauchen, die mit ihrem Vermögen Tassilos heimatliches Gut wieder entschuldet hat. Nun steht einer Hochzeit nichts mehr im Wege, und auch Lisa bekommt ihren Baron ab. Zu diesem Libretto erübrigt sich jeder weitere Kommentar, die Inszenierung jedoch macht das Beste daraus. Gleich zu Beginn zeigt John Dew deutlich, wie die Männer der schönen Mariza zu Füßen liegen, wenn der männliche Part des Chors im Frack um die Gräfin herum auf dem Boden liegt und die weiß behandschuhten Hände anbetend schwenkt. Überhaupt spielt der Chor eine wesentliche Rolle, muss er doch immer wieder die "Hofgesellschaft" darstellen. Das bringt viel Leben auf die Bühne, und immer wieder spielt auch der Tanz eine Rolle. Dazu ist zu sagen, dass die Operette erst 1924 ihre Uraufführung erlebte. Kálmán hat aufgrund dessen viele musikalische Elemente der Zwanziger Jahre übernommen. Zeitweise klingt die Musik aus dem Graben wie früher Swing oder Charleston. John Dew lässt die Darsteller dazu entsprechend steppen und tanzen, als wäre Fred Astaire persönlich zu Gast. Dabei beutet er genüsslich die alte Doppelrolle des geschickten Tänzers und seines tölpelhaften Begleiters aus, so wenn Fürst Populescú und Baron Zsupán ihre mal tänzerischen, mal eher sportlichen Einlagen zeigen. Die Gags entstehen dabei fließend aus der Handlung und werden glücklicherweise nicht wiedergekäut. Das ungarische Kolorit kommt durch eine entsprechend "balkaneske" Sprache zum Ausdruck oder zumindest, was man so dafür hält. Natürlich gilt dieser immer wieder Heiterkeit auslösende Sprachwitz nur für die Chargen, nicht für die Protagonisten (s. oben). Fragt sich nur, warum Fürst Populescú - übrigens ein typisch rumänischer Name - mehr oder minder echtes Sächsisch spricht. Sollte John Dew da dem in Deutschland bereits platt gewalzten Witz mit dem Dresdner Idiom aufgesessen sein? Jedenfalls erntete dieser Witz nur Lacher von Kalauer-Format. Dagegen hat man den Kammerdiener der aus der dramaturgischen Götterwerkstatt aufgetauchten Tante Cuddenstein mit viel Slapstick-Witz ausgestattet. Nicht nur, dass er für seine Brotgeberin die Äußerung der jeweils angesagten Emotion übernehmen muss, nein, er würzt auch jede Situation mit einem literarischen Sprichwort einschließlich Quellenbezeichnung, da er jahrelang als Souffleur im Theater gearbeitet hat. Da kam natürlich für Darmstädter der Spruch "Bezahle, wenn man Geld hat, des ist kein Problem, aber...." gerade recht ("Datterich"). Das Bühnenbild besteht aus einem Halbrund von breiten Säulen, die oben einen breiten Fries mit - Ironie pur - großen Schweinen trägt. Zwei Couchen ergänzen das Mobiliar und geben den Darstellern vielfältige Möglichkeiten für diverse Slapstick oder Tanzeinlagen, die sie auch weidlich nutzen, so Mariza und Tassilo mit einem halben Strip oder Populescú und Zsupán mit einer unfreiwilligen gleichgeschlechtlichen Romanze. Musikalisch gab´s natürlich eine Reihe bekannter Ohrwürmer zu hören, die man, wenn nicht vom Theater, dann vom Radio her kennt. Dabei muss man im ersten Augenblick immer erst den Vorbehalt gegenüber diesen "Dauerbrennern" abschütteln, ehe man sie einfach nur genießen kann. Und gerade sie rufen diese bereits erwähnten Assoziationen an die "gute, alte Zeit" hervor. Aber sei´s drum. Operette ist Operette, und man sollte nicht mehr dahinter suchen, als dort zu finden ist. Schmissig und mit viel Leichtigkeit gebracht, bietet sie auch heute noch gute Unterhaltung. Dazu trägt bei dieser Inszenierung auch das Orchester unter der Leitung von Stefan Blunier bei, das mit viel Verve und Frische aufspielt. Hier sind nicht die leisen Töne und die subtilen Zwischentöne gefragt, sondern Temperament und "ungarrisches Blut". Blunier gelingt es sogar, diese Musik mit einer gewisse Ironie zu präsentieren, ohne sie deshalb zu karikieren. Es scheint, als wolle er sagen: "Nehmt das Ganze nicht so ernst, amüsiert Euch". Und diesem Motto folgen auch die Darsteller, von denen vor allem Nicola Beller Carbone Mariza sowohl stimmlich als auch schauspielerisch brilliert. Sie ist jederzeit präsent und kann sich sogar gegen den voll tönenden Chor mit Leichtigkeit durchsetzen. Wolfgang Schwaninger ist ihr mit seiner kräftigen und unangestrengt wirkenden Stimme ein ebenbürtiger Partner, wenn er schauspielerisch auch eher den ruhigen weil von Sorgen geplagten Part zu spielen hat. Jeffrey Treganza (Baron Zsupán) und Andreas Daum (sächselnder Populescú) geben ihr Duo zweier chancenloser aber eitler Freier mit viel Witz und Slapstick-Einlagen, Stephanie Maria Ott spielte die Lisa bis auf die letzte Szene eher etwas zurückhaltend, ist aber stimmlich ebenfalls auf der Höhe. Als Wahr- und Ansagerin Manja schwebt Elisabeth Hornung wie ein Zirkusdirekot im weißen Anzug und Zylinder über die Bühne. Ulrike Leithner gibt eine herrlich skurrile Tante Cuddenstein, und Stefan Umhey kann sich als ihr Kammerdiener Penizek verbal und körperlich austoben. Das Premierenpublikum war restlos begeistert und belohnte das Ensemble einschließlich Regie - was in Darmstadt nicht oft vorkommt - mit nicht enden wollendem Beifall. Honi soit qui mal y pense! |


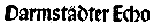

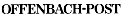
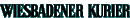


 Die Operette als kleine, leichtere Schwester der Oper hat wahrlich keinen guten Stand, vor allem bei der seriösen Musikwelt. Nicht dass man grundsätzlich gegen das Leichte wäre, aber diese Kunstgattung ist leider mit der Kaiserzeit gestorben. Einzelne Nachzügler wie "Glückliche Reise" folgten zwar noch, aber die Hochzeit der Operette verging mit dem Ersten Weltkrieg. Zu sehr waren ihre Sujets auf die feudale Gesellschaft des ausgehenden 19. Jahrhunderts mit ihren Ingredienzen Bälle, Champagner und Liebe als Zeitvertreib fixiert, als dass sie die radikal veränderte Welt nach 1918 hätte abbilden können. Darstellung der realen Gesellschaft und ihrer Probleme war ihre Sache nicht, Identifikationsmuster für das Publikum und Bedienung von Sehnsüchten standen im Mittelpunkt. Das mittlerweile ebenfalls in die Jahre gekommen Musical hat die Funktion der Operette übernommen, spiegelt es doch weitaus breiter gefächerte Themenkreise und geht auch auf soziale Probleme ein. Dennoch zeigt sich an dem Niedergang beider Kunstgattungen, dass sich das Triviale in seiner institutionalisierten Form selten für längere Zeit etablieren kann und durch neue Trivialformen ersetzt wird, frei nach dem Motto: "Der König ist tot, es lebe der König".
Die Operette als kleine, leichtere Schwester der Oper hat wahrlich keinen guten Stand, vor allem bei der seriösen Musikwelt. Nicht dass man grundsätzlich gegen das Leichte wäre, aber diese Kunstgattung ist leider mit der Kaiserzeit gestorben. Einzelne Nachzügler wie "Glückliche Reise" folgten zwar noch, aber die Hochzeit der Operette verging mit dem Ersten Weltkrieg. Zu sehr waren ihre Sujets auf die feudale Gesellschaft des ausgehenden 19. Jahrhunderts mit ihren Ingredienzen Bälle, Champagner und Liebe als Zeitvertreib fixiert, als dass sie die radikal veränderte Welt nach 1918 hätte abbilden können. Darstellung der realen Gesellschaft und ihrer Probleme war ihre Sache nicht, Identifikationsmuster für das Publikum und Bedienung von Sehnsüchten standen im Mittelpunkt. Das mittlerweile ebenfalls in die Jahre gekommen Musical hat die Funktion der Operette übernommen, spiegelt es doch weitaus breiter gefächerte Themenkreise und geht auch auf soziale Probleme ein. Dennoch zeigt sich an dem Niedergang beider Kunstgattungen, dass sich das Triviale in seiner institutionalisierten Form selten für längere Zeit etablieren kann und durch neue Trivialformen ersetzt wird, frei nach dem Motto: "Der König ist tot, es lebe der König".