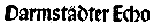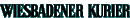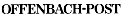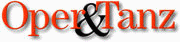|
Eine neue Leichtigkeit VON HANS-KLAUS JUNGHEINRICH Seinem Vorgänger gelang es, die gröbste Bescherung dem neuen Intendanten John Dew als Einstandsgeschenk zu hinterlassen: So ist dessen theatralisches Domizil in Darmstadt nun mitten drin im Sanierungs- und Umbauchaos, das Große Haus für ein Jahr geschlossen, der noch zugängliche Teil des Komplexes macht sich für mutige Pfadfinder über die Provisorien einer labyrinthischen Großbaustelle erreichbar. Der gewitzte Pragmatiker Dew ist aber nicht der Mann, sich durch solche Repräsentationshindernisse den Spaß am frischen Job nehmen zu lassen. Die enge Umarmung von Kunst und Bequemlichkeit war ohnedies kaum je sein Trachten. In seinen langen Bielefelder Jahren wurde der unerschöpflich produktive Opernszeniker zu einer Legende. Anschließend war er Theaterleiter in Dortmund, einer Stadt, die dem künstlerisch Besonderen weniger zugetan scheint. Darmstadt hat einen Ruf, dass dort die Künste lebten. Ein Gerücht zur Tatsache zu machen, ist das berufene Amt von Zauberern, und als solcher verbreitet John Dew nun auch einen schönen Regenbogen von Zuversicht, Enthusiasmus und Energie um seine beginnende Tätigkeit. Ausweichstätte für das Musiktheater ist in der anlaufenden Spielzeit das Kleine Haus, in das sich Dew und seine Mitarbeiter - die Notdurft zum Segen wendend - offenbar schon richtig verliebt haben. Als Eröffnungspremiere gab es hier Claudio Monteverdis L'Orfeo - räumlich klug, ja ideal formatiert und als ein veritables Fest. Nirgendwo ist ja das Feiern so authentisch wie im Zeichen von Provisorien. Die erste Repertoireoper aus der Retorte der Florentiner Künstlerphilosophen des frühen Seicento (auch das Libretto von Alessandro Striggio zeigt sich von Stoa-Renaissance durchtränkt), sozusagen ein programmatisches Einstandswerk, hebt mit einer atemberaubenden Fanfare an, die als Entrée von keiner späteren Oper getoppt wurde. Dieser fast martialische Klang der Metallbläserbatterie wuchtete auf das Publikum aus geöffneten Portalen zunächst von hinten ein. Auch im weiteren Verlauf kam es, etwa mit zahlreichen Echowirkungen, zu phantastischen Raumklang-Effekten. Anscheinend bedarf es mittlerweile keiner Originalklang-Spezialisten mehr für solche frühe Opernkunst. Vielmehr: Darmstadts GMD Stefan Blunier und das Staatstheaterorchester haben sich mühelos zum Monteverdi-Expertentum hinentwickelt. Mit unkonventioneller Streicherartikulation (senza vibrato) und etlichen barockisierenden Klangträgern (Lauten und Tasteninstrument als Continuo) ergaben sich variable und farbenreiche Intonationen. Insbesondere auch der Chor (Einstudierung: André Weiss) exzellierte in bald beschwingter, bald markant dramatischer Vokalpracht. Im luftig Heiteren, rhythmusbetont Tänzerischen, kolorierten sich zumal die Eingangssequenzen, abgelöst dann von den geheimnisvoll-unheimlichen Hades-Visionen, den Schmerz- und Schreckens-Kommentaren zu Orpheus' Höllengang auf der Spur der gefundenen und wieder verlorenen Liebe. Lapidar schnörkellos das Bühnenbild von Heinz Balthes, zunächst in lichten Blautönen, mit eingedunkelt transparentem Vorhang für die Unterwelt. Extravagante Akzente setzten die Kostüme von José Manuel Vázquez. Zum chorischen Habit der neuzeitlichen Sommergesellschaft kontrastierten die bizarren Roben der Höllengeister und der allegorischen "Musica" (mit eloqutem Countertenor gesungen von Gerson Luiz Sales), auch der Plutone (sonor: Andreas Daum), der mit verhängnisvoll grüngiftigem, rot züngelnden Schlangenarm bereits unter den fröhlichen Hochzeitern herumgespenstert. Das wechselvolle Bühnengeschehen arrangierte Dew mit ebenso sicherer wie leichter Hand. Die Vergegenwärtigung des Stückes überhob sich nicht am mythologischen Gepäck, betrieb auch keine rabiate Profanierung oder Psychologisierung. Barockoper behauptete in dieser Sicht wohl auch ein Anrecht auf Verzauberung, auf kulinarische Sensation. Und so drifteten auch die Schlussphasen nicht in eine absichtsvoll schale oder angebitterte Apotheose hinein. Dew, der den Orfeo mit einigen Recht als Künstlerdrama deutet, ironisierte das lieto fide allenfalls sanft, wo die Titelgestalt keineswegs unglücklich auf einem gelinden Säulenstumpf posierte. Der vom Leben Gebeutelte als Kunst-Held, von einem nicht zur Schäbigkeit hinstilisierten deus ex machina ins Pantheon versetzt und vom Chor, nun wieder in ausgelassener Feststimmung, bejubelt: also doch ein zufriedenstellendes Erfolgsmodell. John Dew scheint entschlossen, dem Publikum den Spaß an seiner Oper nicht zu verderben. Dazu waren auch die sängerischen Eindrücke nicht angetan. Sven Ehrke, der jugendlich baritonale Orfeo im weißen Anzug, wölbte seine rezitativischen Strecken durchweg zu vehementer, kaum ermüdender Ausdrucksfähigkeit. Prägnant im Lyrischen die zierliche Euridice von Stephania Maria Ott. Auch in den kleineren Partien war die Aufführung (selbstverständlich in der italienischen Originalsprache) ansprechend besetzt. Frischer Wind in Darmstadt. [ document info ] |
|
Ein Denkmal für Orpheus Von Heinz Zietsch DARMSTADT. Mit Pauken und Trompeten sowie Posaunen beginnt Claudio Monteverdis Oper „L’Orfeo" – nicht aus dem Orchestergraben, sondern vom linken Zuschauereingang her schmetterten die Blechbläser die einleitende Toccata; nur die Pauke dröhnte dazu aus dem Graben. Eine glänzende Idee hatte sich da der Intendant und Regisseur John Dew zur Spielzeiteröffnung einfallen lassen. Bis die Instrumentalisten soweit waren, musste Generalmusikdirektor Stefan Blunier am Samstagabend im Staatstheater Darmstadt noch etwas mit seinem Einsatz warten. Doch die Überraschung war umso größer, als dann, links und rechts durchs Parkett ziehend, eine illustre Gesellschaft die Bühne im Kleinen Haus betrat. Eine Party-Gesellschaft von heute. Mitglieder des Opernchores schwenken Gläser und Sektflaschen. Man ist offenbar schon etwas angeheitert, lacht und jauchzt. Schließlich gibt es ja etwas zu feiern: die Hochzeit von Orpheus und Eurydike. Außerdem ist da noch ein lustiger Gesell in einem barockisierenden Kostüm, das übersät ist mit allerlei Noten, und quer über seinem Körper ragt die Hälfte eines Cellos heraus. Charmant und augenzwinkernd tänzelt er umher. Die Figur der Musica ist auf diese Weise leibhaftig geworden. Der Kostümbildner José Manuel Vázquez hat sie in dieses harlekinartige Notengewand gesteckt. Überhaupt sind seine Kostüme bunt, in der sanften Helligkeit der Farben aber dennoch dezent gehalten, weil Weiß überwiegt. Der Countertenor Gerson Luiz Sales singt die Partie der Musik im Prolog einschmeichelnd und intensiv. Fast 400 Jahre alt ist die 1607 in Mantua uraufgeführte Monteverdi-Oper, die der Komponist damals noch „Favola in musica", also musikalische Fabel genannt hat. John Dew unternimmt in seiner ersten Darmstädter Inszenierung den Versuch, sie zu vergegenwärtigen, in eine stilisierte Gegenwart zu verlegen. Er bringt viel Bewegung ins Spiel, und wenn Orpheus seine beschwingte Arie und Canzone vom Frühling schmettert, dann vollführen die Hirten muntere Bewegungen, als wären sie in einer Disko von heute. Orpheus und die Seinen befinden sich in einer idyllischen Welt, die der Ausstatter Heinz Balthes mit einfachen Bühnenbildern vor Augen führt. Im Hintergrund wölbt sich aus dem Grün des Vordergrunds ein blauer Himmel empor, den nur eine Wolke trübt. Der schöne Schein ist bedroht. Schon beim Hochzeitsfest lauert die Schlange, die Eurydike tödlich verletzen wird. Klar, dass dann das Schattenreich der Unterwelt im Dunkeln liegt. Doch auch hierfür hat der Kostümbildner raffinierte und auch farbige wie einfallsreiche Kostüme gefunden. Alles greift in Dews klarer wie bewegungsintensiver Inszenierung ineinander. Ein Fest für Augen und Ohren hat der Intendant und Regisseur auf die Bühne gebracht. Vor allem fasziniert auch heute noch die Musik Monteverdis, deren Vielfalt man bestaunen kann. Es ist die erste vollkommen ausgebildete Oper, in der aber noch mehr Formen stecken, darunter das Pastorale genannte Hirtenstück, Madrigal, Motette, viele Instrumentalsätze, Echowirkungen, festliche Intermedien, die zu den Vorformen der Oper gehören, und Tanz – schließlich klingt das Werk mit einer vom Chor gesungenen und vom Tambourin aufreizend begleiteten Moreske aus. Stefan Blunier, der ohne Taktstock eine eigene Fassung nach der Partitur von 1609 dirigiert, gibt den Ohren genug Futter. Man bewundert, von wenigen Wacklern abgesehen, wie stilsicher das Orchester mit dieser alten Musik umgeht, wie gut alte Instrumente (Gamben, Lauten, Blockflöten, Claviorganum) sich den modernen Streichinstrumenten anpassen. Blunier betont das Rhythmisch-Tänzerische mit einem geradezu spritzigen Tempo, um dann umso intensiver und ausgedehnter den Schmerz und die Klage des Orpheus instrumental auszukosten. Selbst der Schluss wirkt inszeniert, wenn alle Darsteller noch einmal nach der gut zwei Stunden dauernden Aufführung die Bühne betreten und sich für den begeisterten Applaus dankend verneigen. Denn Blunier dirigiert dazu noch einmal die einleitende Toccata, dabei stehen die Bläser links und rechts an den Seitenbühnen. Publikumsliebling der Premiere am Samstag war eindeutig die Figur der Musica, die Gerson Luiz Sales gewitzt verkörperte, der allerdings, wie viele andere Sänger auch, noch weitere Partien zu übernehmen hatte und als Hirte und Speranza ebenso zu glänzen wusste. Ein Italiener würde diese in seiner Sprache gesungene Oper (eine deutsche Übersetzung wurde an den oberen Bühnenrand projiziert) wohl gut verstehen können, denn alle Sänger beherrschten das von Monteverdi intendierte „parlar cantando", das singende Sprechen. Großartig in ihren gesanglich feinen Schattierungen gab Katrin Gerstenberger die Messagera, die Unglücksbotin. Sven Ehrke war in der Titelpartie ein gewiefter Sängerdarsteller, dessen Tenor zudem eine beachtliche Tiefenfärbung besaß. Geschickt nahm er den Ton zurück, um den eingeschlafenen Caronte (Friedemann Kunder) nicht zu wecken. Beeindruckend, wie er mit dem Sonnengott Apollo (Jeffrey Treganza) ein geradezu sinnlich-betörendes Duett gestaltete. Stephanie Maria Ott sang mit geradliniger und noch etwas zurückhaltend wirkender Stimme die Euridice. Mit sonorer Tiefe verkörperte Andreas Daum den Unterweltgott Pluto. Mary Anne Kruger begeisterte mit fein abgestimmtem Sopran als Ninfa und Proserpina. In weiteren Rollen waren noch Stefan Grunwald und Lawrence Jordan zu vernehmen. In das Geschehen bestens integriert, dem Gesamtklang dabei viel Farbe gebend, war der von André Weiss einstudierte Chor, der in dieser Oper besonders spielfreudig agieren konnte. Mit dieser Inszenierung hat John Dew Monteverdis „Orfeo" ein Denkmal gesetzt. Im doppelten Sinne: Denn am Ende fährt Orpheus, statt mit Apollo in den Himmel aufzusteigen, auf einem Denkmalssockel in die Höhe. Doch zu einem starren musikalischen Denkmal ist Monteverdis Oper hier glücklicherweise nicht verkommen. |
|
Am Ende siegt doch die Liebe Der Umbau des Darmstädter Staatstheaters bezieht sich ja nicht nur auf die Sanierung der Gebäude. Auch in personeller Hinsicht hat sich einiges geändert. Der neue Intendant John Dew stellte sich nun mit einer launigen Inszenierung von Monteverdis "Orfeo" vor, einem Werk, das den meisten schon deshalb etwas sagen wird, weil "Orfeo" in den einschlägigen Opernführern stets als erstes erwähnt wird. Die 1607 in Mantua uraufgeführte Oper gilt als ältestes Werk dieser Gattung schlechthin. Und damals konnte man auch noch aus einfach verständlichen, übersichtlichen Handlungsabläufen zwei Stunden spannende Musik machen: Orpheus, zunächst im Liebestaumel mit Eurydike, muss schweren Herzens auf die Geliebte verzichten, die von einem Schlangenbiss dahin gerafft wird. Nach einer Begegnung mit den Mächten der Finsternis steigt Apollo herab und führt den Trauernden in die Ewigkeit, wo es ein Wiedersehen gibt. John Dew gelingt eine kompakte, mit allerhand hübschen Regieeinfällen garnierte Darstellung des Stoffes. Am Anfang und am Ende steht die Freude über den Sieg der Liebe; aber auch die leicht ironisierte Darstellung der Unterwelt mit Proserpina und Pluto weckt Interesse. Dazu kommen die vielfältigen Fähigkeiten des Orchesters, dessen Bläser nicht nur in der Ouvertüre getestet werden. Doch Stefan Blanier hat Hörner und Fanfaren erfolgreich zu äußerster Disziplin angehalten. Was diese Oper aber auch nach knapp vierhundert Jahren noch so hörenswert macht, ist die Feingliedrigkeit ihrer Orchestermusik, die von dem Orchester so überzeugend vermittelt wurde. Vielleicht ist es gerade deshalb ein Vorteil, dass die Aufführung – umbaubedingt – in dem intimer wirkenden Kleinen Haus stattfinden muss. Unter den Gesangssolisten ragt Sven Ehrke als Titelheld mit absoluter Stilsicherheit und stimmlicher Vielfalt heraus. Orpheus hat in dieser Handlung ja ein Wechselbad der Gefühle zu durchleben, das auch glaubwürdig durchsungen werden muss. Auch Stephanie Maria Ott überzeugt als Eurydike, Jeffrey Terganza als Apollo. (Ge) |
|
Heiterkeit auf dem Kunstrasen Von Volker Milch
Es ist zur Zeit gar nicht so einfach, den Eingang des Staatstheaters Darmstadt zu finden: Die düsteren Weiten der Tiefgarage stimmen indes trefflich auf die chthonischen Erfahrungen des mythischen Sängers Orpheus ein. Nachdem man sich zwischen Bauzaun und Beton an die Oberwelt durchgekämpft hat, wird man vor dem Kleinen Haus vom Schriftzug "Sehnsucht" empfangen. Ein schönes, sinnliches Wort. Aber Sehnsucht nach wem oder was? Nach Euridice, nach wundersam steinerweichender Musik oder einfach nach Ruhe? Darmstadts Theater befindet sich während seiner Sanierung im Ausnahmezustand, und der neue Intendant John Dew muss versuchen, die Nöte des Hauses in Tugenden umzuwandeln. Oper kann es nur noch im Kleinen Haus geben, das mit knapp 500 Plätzen halb so groß ist wie die eigentliche Musiktheater-Spielstätte. Kleinere Formen sind also gefragt, und dass die Beschränkungen auch zu gesteigerter Kreativität führen können, zeigt schon das reizvolle Konzertprogramm von Generalmusikdirektor Stefan Blunier im Kleinen Haus und in anderen Ausweich-Spielstätten. Zunächst hat im Kleinen Haus aber Darmstadts Opern-Saison begonnen, und die Entscheidung des erfahrenen, zur Zeit auch in Wiesbaden mit Wagners "Ring" geforderten Regisseurs John Dew für Monteverdis "L´Orfeo" war sicher eine wohlerwogene: Zu Beginn seiner Intendanz die Rückbesinnung auf die Wurzeln, die Ursprünge der Gattung Oper - und die Gewissheit ihres Fundaments kann ja gerade in unruhigen (Umbau-) Zeiten nicht schaden. Allerdings wurden hochgestimmte Erwartungen in Darmstadt bald enttäuscht. Der Regisseur, der 2002 in Wiesbaden Rameaus Sumpfnymphe "Platée" eine vergnügliche Frischzellenkur verpasst hatte, verließ ausgerechnet im musikalischsten aller Mythen kaum je die Ebene gefälliger Arrangements und vertrauter Theater-Gags. Das Publikum wird von einer mit Sektgläsern bewaffneten, lärmenden Hochzeitsgesellschaft überrascht. Sie stürmt aus dem Zuschauerraum auf die Bühne und amüsiert sich dort in erlesenen Pastelltönen (Kostüme: José Manuel Vázquez). Bräutigam Orfeo erinnert in seinem blütenweißen Anzug stark an den großen Gatsby und tändelt lustig mit seiner niedlich bekränzten Euridice - nicht mehr als Stereotypen aus dem Theater-Fundus. Die outrierte Heiterkeit auf dem Kunstrasen des Bühnenbildes von Heinz Balthes braucht John Dew, um mit dem Bericht von Euridices Tod dann einen schwarzen Trauerflor vor die Handlung zu ziehen. Katrin Gerstenberger sorgt hier mit ihrem Botenbericht für musikalisch eindringliche Momente der Premiere, und auch die Proserpina der Mary Anne Kruger gehört später im Schattenreich zu den Lichtblicken des Abends. Von der Faszination des mythischen Sängers selbst konnte Sven Ehrkes in den Koloraturen unscharfer Orfeo neben Stephanie Maria Otts Euridice kaum etwas vermitteln: Ihm und anderen Herren des Ensembles hörte man doch sehr an, dass der Umgang mit Alter Musik keine Selbstverständlichkeit im Theater-Alltag ist. Weitaus erfreulicher wirkte dagegen die Annäherung an Monteverdi unter Stefan Bluniers Leitung im Orchester: Mit Chitarrone, Blockflöten und Regal historisch gefärbt und in den Streichern diesem transparenten, akzentuierten Klangbild angepasst. Aber wie auch immer das Orchester spielt: Ohne angemessenes Solisten-Ensemble ist natürlich auch ein "Orfeo" musikalisch zum Scheitern verurteilt. Und wenn Apollo als Deus ex Machina herabsteigt und Orfeo auf seiner Säule zum Standbild versteinert, dann kann die ironische Note der Szene auch nicht die adrett servierte Routine dieser Inszenierung aufbrechen. Schade. Das war kein guter Start in die Saison. |
|
John Dews "L’Orfeo" in Darmstadt
Am Beginn der Opern-Intendanz der Anfang der Opern-Geschichte: Mit Claudio Monteverdis 1607 uraufgeführtem "L’Orfeo" startete Darmstadts Staatstheater jetzt in die neue Spielzeit. Mit diesem Werk aus der Geburtsstunde der Gattung stellte sich zugleich der neue Intendant John Dew in Darmstadt als Regisseur vor. Die Premiere fand im Kleinen Haus statt - wie alle Musiktheater-Vorstellungen dieser Spielzeit. Das Große Haus bleibt wegen der Sanierung des Staatstheaters für ein Jahr geschlossen. Mit Monteverdis Orpheus-Oper, für einen intimeren Rahmen ohnehin besser geeignet als für die große Bühne, jetzt also nach Jahren wieder Musiktheater in Darmstadts Kleinem Haus. Man fühlt sich schnell mittendrin im Geschehen, weil bereits während des Vorspiels die Blechbläser das Publikum vom Eingang zum Zuschauerraum aus mächtig beschallen. Und der Chor eilt anfangs in Sekt-Gutlaune durchs Haus auf die Bühne - und am Ende, nach etwas mehr als zwei Stunden (einschließlich Pause), wieder zurück. Dazwischen erzählt John Dew die Orpheus-Geschichte in bunten, zuweilen stereotypen, vereinzelt aber auch starken Bildern. Gemalte Wölkchen auf der Rückwand, die bruchlos geschwungen in die Spielfläche übergeht, künden Idyll auf der lichten, leeren Bühne; Heinz Balthes hat sie errichtet. Orpheus trägt Weiß, überhaupt herrschen helle Farben, bis plötzlich die Verkünderin von Eurydikes Tod einen schwarzen Vorhang hinter sich in die Szenerie zieht: Eher schablonenhafte Farbspielereien, zumal der Vorhang natürlich auch die Unterwelt bei Orpheus’ Gang in dieselbe ausstaffieren wird. Hübsch anzuschauen ist das gewiss, zumal auch die Kostüme von José Manuel Vázques einiges fürs Auge bieten. Zum Beispiel, wenn eingangs die als allegorische Figur auftretende Musik in einem fantasievoll stilisierten Cello-Kostüm das Geschehende ankündigt. Wohl hätte man sich von John Dew zuweilen eine etwas lebendigere, einfallsreichere Personen-Regie gewünscht. Aber er lässt der Musik eben nicht nur dann den Vortritt, wenn sie als allegorische Figur auftritt. Schließlich spielt das Darmstädter Orchester unter der Leitung von Stefan Blunier mit seidigem Streicherglanz historisch bestens informiert, farbenreich und äußerst exakt. Auf der vokalen Seite wünschte man sich allerdings einen Orfeo, der den Anforderungen an diese Zentralpartie wirklich gewachsen wäre: Sven Ehrke verfügt gewiss über ein natürlich-schlankes tenorales Timbre. Doch seinen Verzierungen fehlt bisweilen die vokale Souveränität, die Intonation fällt nicht selten allzu freizügig aus. Da erlebt man in den sonstigen Partien schon Genaueres: Stephanie Maria Ott ist eine reflektierende Eurydike, die leuchtend klare Sopranistin Mary Anne Kruger gefällt doppelt in den Partien der Ninfa und der Proserpina, gleich in drei verschiedenen Rollen ist der jugendliche Countertenor Gerson Luiz Sales zu hören. Zuverlässig auch die übrigen Ensemblekräfte in dieser italienisch gesungenen, deutsch übertitelten Oper, hoch konzentriert der von André Weiss einstudierte Chor. Mal sehen, wie die weiteren Darmstädter Opern-Inszenierungen im intimen Raum des Kleinen Hauses, teils in der Regie des neuen Intendanten John Dew, ausfallen werden. AXEL ZIBULSKI |
|
Verlassenes Denkmal mit der Lyra Von Siegfried Kienzle
Ironie und tiefere Bedeutung, freche Satire und tragische Erschütterung mischt John Dew mit leichter Hand. So gelingt ihm zur Eröffnung seiner Darmstädter Intendanz ein Meisterstück. Er erweckt Monteverdis "L´Orfeo", der immerhin schon 400 Jahre alt ist, zu unmittelbarer Lebendigkeit. Claudio Monteverdi hat sich 1604 am Hof von Mantua bei dieser "Favola in musica" noch eng an die Madrigale der Renaissance, an Ritornell-Zwischenspiele und Deklamation gehalten und dennoch mit diesem Werk den entscheidenden Schritt zur Entwicklung der Oper getan. Wegen Renovierung muss in Darmstadt die Oper ins Kleine Haus ausweichen. Das provoziert pfiffige Lösungen. Zu Beginn wirbelt eine Partygesellschaft von heute mit Gekicher und Gelächter durch den Zuschauerraum auf die Bühne und prostet dem glücklichen Brautpaar Orfeo und Euridice zu. La Musica (ausdrucksvoll der Countertenor Gerson Luiz Sales) tänzelt im Prolog in Rokokoperücke und affektiver Gestik über die Brüstung des Orchestergrabens. Der erste Hirt (Jeffrey Treganza blendend bei Stimme und Spiellaune) amüsiert sich zynisch über die naive Hirten-Idyllik, die Monteverdi besingt. Die Party der betrunkenen Playboys artet aus. Man raubt Euridice das Strumpfband, torkelt übereinander. Und plötzlich erscheint die Botin und verkündet Euridices Tod durch den Biss der Schlange. Da wechselt Dew von der Postmoderne in den erschütternden Ernst und beginnt ein neues Stück. Dieser Stilbruch aus der schrillen Bewegtheit in die Erhabenheit und Ruhe der Antike ist von größter Wirkung. Katrin Gerstenberger als Botin zieht einen schwarzen Schleier über die Szene. Mit Schmerz und Trauer färbt sie ihr Lamento, und die Koloraturen klingen beklemmend, als würde die Stimme versagen. Von Beginn an hat Plutone (Andreas Daum), dessen rechter Arm ein züngelnder Schlangenkopf ist, das fröhliche Treiben belauert und Euridice als Opfer ausgespäht. Zweimal muss der Tenor Sven Ehrke seine Euridice verlieren - in etwas monochromer Klangfarbe gestaltet er die Klage. Eindrucksvoll sein Bittgesang "Possente spirito" an Caronte, den Wächter der Unterwelt (Friedemann Kunder im Zylinder des Bestattungsunternehmers und mit dem Ruder als Waffe). Faszinierend, wie Stephanie Maria Ott als Euridice ihren Abschiedsgesang im Unhörbaren verschweben lässt, nachdem sie durch Orfeos Blick zurück endgültig ans Totenreich verloren ist. Mary Anne Krugers Proserpina trägt immer noch Laub und Blüten aus ihrem verlorenen Erdendasein und leiht der Fürbitte an Plutone berückenden Wohllaut. La Speranza (Gerson Luiz Sales) tritt diesmal nicht auf, sondern führt als Stimme von oben Orfeo an die Pforten der Unterwelt. Zuletzt steigt Apollo (Jeffrey Treganza) in Goldflitter eine Himmelstreppe herab, um seinen Sohn Orfeo zu trösten. Anders als im Libretto vorgesehen, wo er den Sänger in den Himmel führt, erhebt er ihn hier samt Lyra zum Denkmal. Da wird Orfeo von der Partymeute des Beginns unter den Klängen der Schluss-Moresca umjubelt, um bald verlassen dazustehen. Denn die Menge hat schon wieder einen neuen Trend entdeckt. Heinz Balthes erreicht mit einer Rückwand aus Himmelsblau und duftiger Sommerwolke zwischen Kulissengassen die schönsten Lichtwirkungen. Stefan Blunier hat aus Monteverdis Partitur eine eigene Fassung erstellt und in das klein gehaltene Orchester barocke Klangfarben von Blockflöten, einer Kleinorgel mit Zungenregistern sowie Gambe und Chitarrone einbezogen. Imponierend die Chöre, die zwischen den Solosängern der Hirten und dem Ensemble aufgeteilt sind. Eindringlich und schlicht zieht die Vergänglichkeit des Glücks in Darmstadt vorüber. |
|
Claudio Monteverdis „Orfeo" in Darmstadt
Eine fröhliche Hochzeitsgesellschaft zieht durch den Zuschauerraum zur Bühne, wie man sie auch vor dem berühmten Hochzeitsturm auf der Darmstädter Mathildenhöhe sehen kann: eine Art mobiler Sektempfang für die Horde der Gleichaltrigen. In pastellfarbenen Gewändern gesellen sie sich auf dem demonstrativ lichtgrünen Rasen zueinander und feiern das Brautpaar; über allem schwebt „ungeheuer oben" ein Wölkchen im Azur. So ist das Leben, wenn man es schön träumt. Doch ahnt man schon das Verhängnis, das als gut kostümiertes Reptil, die Rechte zum Schlangenkopf mutiert, die Szene umlauert. Die Botin (Elisabeth Hornung in schwerem, vollklingendem Mezzo) stürzt denn auch herein mit der erwarteten Nachricht, die Szene unwiderruflich mit einem schwarzen Flor überziehend. Dahinter wird bald ein vielleicht allzu harmlos wirkendes Totenreich sichtbar, begrenzt nur durch das grüne Band des mythischen Flusses. Davor wacht der schläfrige Fährmann (Dimitry Ivashchenko), der unter Orpheus‘ Gesang denn auch bald entschlummert und so den Weg frei macht. Als Plutone tritt Tito You auf, mit klarem, geschmeidigem Bass die „Doppelzüngigkeit" seiner Rolle unterstreichend, und siehe, er ist das todbringende Reptil selbst, oder umgekehrt, der Herr der Unterwelt bringt selbst das Verderben, das auf diese Weise mit dem Tod gleichgesetzt wird; in jedem Fall aber ist die „Doppelrolle" eine sinnfällige Eingebung der Regie. Proserpina, gesungen von Andrea Bogner mit hellem, schmeichelndem Sopran, gelingt es zwar scheinbar, für Orpheus und seine Geliebte zu bitten, doch spricht die gespaltene Zunge des Ungeheuers eine andere Sprache. Und so nimmt das Verhängnis seinen Lauf: Orpheus schaut sich um, teils aus Misstrauen gegenüber den dunklen Mächten, vor allem aber, weil er nicht anders kann. Und wir dürfen uns wieder die alte Frage stellen: Wäre seine Liebe zu Eurydike glaubwürdig, wenn er sich nicht umgeschaut hätte, wäre der Sieg dieser Liebe über die Mächte des Todes so zu nennen, wenn Orpheus stur geradeaus gegangen wäre? Auf jeden Fall wäre der Kasus gänzlich unpoetisch gewesen. Und so bleibt noch ein letztes, die Apotheose des Orpheus, bewerkstelligt durch Apollo (Jordi Molina Davila), den barocken Deus ex Machina. Doch nimmt der Gott den Sänger nicht mit, sondern stellt ihn auf den Sockel der Unsterblichkeit als Denkmal seiner selbst, des liebenden Sängers und der Musik. Diese Musik von Monteverdis Genie ist für uns, die wir an volltönende Opulenz gewöhnt sind, vielleicht spröder als sie für die Zeitgenossen gewesen sein mag. Wir hören dafür Oper in nuce und auch noch manchen Reigen im Rhythmus früherer Musik an der Schwelle zum Barock. Das Verdienst des Orchesters unter Generalmusikdirektor Stefan Blunier ist es, diesen Eindruck nicht abgeschliffen, sondern ihn mit der eigenen Melodik der Komposition verbunden und zu einem besonderen Hörerlebnis verschmolzen zu haben. Die Spannung zwischen unseren Sehgewohnheiten und der relativen Statik der alten Oper wurde dagegen von der Regie aufgenommen. Durch szenische Dynamik bringt sie Bewegung in die ausladende Rhetorik der Rezitative. Leichtigkeit war auch das Motto der Akteure, die Stimmen von Eurydike (Julia Amos) in hellem Sopran, Orpheus vielleicht allzu leicht und in den tieferen Partien weniger klangvoll. La Musica, gesungen von dem Countertenor Gerson Luiz Sales, stimmte das Publikum überzeugend ein. So bot John Dew mit seinem Ensemble, das unter erschwerten Bedingungen in einem Gebäude arbeitet und auftritt, das gerade saniert wird, den Darmstädtern einen gelungenen Opernabend und machte ein Meisterwerk der Musikgeschichte zu einem Genuss für Auge und Ohr; er kam dem heutigen Publikum ein Stück entgegen, ohne jedoch die historische Distanz zu tilgen, die uns vom Musizieren zu Monteverdis Zeiten trennt. Rotraut Fischer |
|
Altes zu Beginn Kritik von Uwe Schneider Die Stückwahl hat Symbolcharakter. Das neue künstlerische Leitungsteam des Staatstheaters Darmstadt, Intendant John Dew und sein Generalmusikdirektor Stefan Blunier, haben als erste Musiktheaterpremiere ihrer Amtszeit Claudio Monteverdis Favola in musica ‚L’Orfeo’ von 1607 gewählt. Jenes Werk, das gemeinhin (wenngleich musikhistorisch inkorrekt) als erste Oper gilt. Neubeginn von Anfang an, von den Wurzeln der Gattung her, könnte das also signalisieren. Doch die Idee allein reicht nicht, es bedarf auch einer entsprechenden Umsetzung. John Dew, gerade in den 1980ern als Bilderstürmer des Opernmuseums mit manch spektakulärer Inszenierung als enfant terrible des Musiktheaters bekannt geworden, will es also noch einmal wissen? Noch einmal die Opernwelt aufwecken, alte, festgefahrenen Traditionen hinterfragen, neue Wege beschreiten? Noch einmal neue ästhetische Sichtweisen präsentieren, vielleicht gar wieder politische Statements auf der Opernbühne geben, wie er es vor zwei Jahrzehnten etwa mit seinen Opernausgrabungen aus der Zeit zwischen den Weltkriegen getan hatte? Was also sah man in Darmstadts Kleinem Haus, das dem Musiktheater, während der Renovierungsarbeiten des Großen Hauses, als Interimsspielstätte dient? Zunächst sah man Partymenschen in pastellfarbenen Kostümen (Kostüme: José Manuel Vázquez) aus dem Zuschauerraum auf die offene, leere Bühne stürmen, die eine Wiese mit Himmel dahinter suggeriert. Dann tänzelte ein Charakter (Gerson Luiz Sales), der Noten auf dem Kostüm hatte und dem ein Laufsteg aus dem Rücken wuchs, vor dem Orchestergraben und sang tremoloreich davon, eine Geschichte erzählen zu wollen. Aha, so erkannte man, das ist der Prolog, den die personifizierte Musik singt. Die Partygesellschaft auf der Bühne vergnügte sich indessen, um dann in netten Gruppenarrangements, mal als Hochzeitschor, mal lässig Weingläser füllend und hochhaltend, mal Ringelreihen tanzend, das frisch vermählte Paar Orfeo und Euridice zu feiern. Schön bunt war das und – aha! – das sind vergnügte Menschen. Der Chor singt das klangschön, nicht immer präzise, aber mit merklicher Freude und Engagement. Bedrohlich lauert am Bühnenrand aber schon eine dunkle Gestalt, deren einer Arm wie eine Schlange aussah und – aha! – Bedrohung ist im Verzug. Inzwischen hat Euridice auch ihren Hochzeitskranz in die Menge geworfen und … - ja, was und? Sollte so der Neuanfang John Dews als Intendant in Darmstadt aussehen? Oder war dieses gefällige, belanglose Arrangement vielleicht nur eine geschickte Vorbereitung auf Dinge, die da kommen sollten? Um es kurz zu machen: was kam war dann, mit der Nachricht von Euridices Tod, ein schwarzer Gazevorhang, ein dahinter befindlicher Chor - und das war es dann auch erst einmal. Nun muss Orfeo, ziemlich allein gelassen, die Arme recken, seine Fäuste ballen und etwas auf der leeren Bühne herumstolpern. Immerhin konnte nun Heinz Balthes – wie in seinen anderen Ausstattungen - seine bewährte, flächige Grün-, Rot- und Blau-Beleuchtung einbringen. Aha, das hat wohl was mit den Stimmungen (der Personen) auf der Bühne zu tun, konnte man sich dabei denken. Die bewegten Arrangements des Anfangs waren inzwischen längst den statuarischen, bekannten Operngesten und einfallslosen Auf- und Abtritten gewichen. Der Fährmann Charon hatte sich inzwischen auch auf den Bühnenboden gelegt und spielte schlafen – nein nein, das gehört zum Stück, ihm war nicht langweilig geworden. Die Klänge von Orfeos Gesang schläferten ihn der Fabel nach ja ein. Schauspielerisch etwas unbeholfen diskutierten dann nach der Pause Plutone und Prosperina; Plutone sah dabei aus, als ob er von den Dreharbeiten zu Martin Scorseeses ‚Gangs of New York’ käme und Prosperina könnte in ihrem floralen Kostüm ohne weiteres auch den Schluss der Daphne spielen. Nun, schließlich bekam Orfeo, der inzwischen in seinem unschuldsvoll-weißen Anzug viel gesungen hatte, Euridice wieder. Aus irgendeinem Grund drehte er sich aber nach ihr um, was ihm untersagt worden war. Da war sie dann wieder weg, die Euridice. Und Orfeo stolperte wieder umher und sang wieder allein auf der großen Bühne, die nun keinen Trauervorhang mehr hatte, denn aus dem Hintergrund musste sich bald eine Treppe aus dem Himmel öffnen, so wie bei Flugzeugen. Da war dann eine Figur im goldenen Indianerlook zu sehen, die Apoll heißt und Orfeos Vater ist. Nur wenig später fuhr Orfeo dann auf einer Säule in die Höhe und verharrte als Statue. Achja, und dann kam noch die Partygesellschaft zurück und sang kurz und vergnügt, nicht ohne die Orfeo-Statue dabei zu umtanzen. So sieht also John Dews Neubeginn aus. Schamlos zitiert er sich selbst, montiert Versatzstücke älterer Inszenierungen und teilt das, was er sagen will, bereits vorher im Interview mit, bleibt die Umsetzung dessen auf der Bühne aber schuldig. Orfeo ist, nach Dew, nämlich er Typ Künstler, der der Kraft seiner eigenen Kunst nicht mehr vertraut, weswegen er sich auch vergewissernd nach Euridice umdreht. Ja, das kann man schon hineininterpretieren in die Fabel, die schon vieles über sich hat ergehen lassen müssen, warum nicht? Aber zeigen müsste man es halt auf der Bühne und sich die Konsequenz davon überlegen, die wohl kaum die Verklärung zum Säulenheiligen sein kann. Auch musikalisch war dieser Abend nicht gerade aufregend. Sicher, man muss die Relationen sehen, hier wurde aus dem (teils neuen) Ensemble des Staatstheaters Darmstadt besetzt ohne Spezialisten für Alte Musik. Das gilt auch für das moderne Orchester, das ‘mit einigen Sonderinstrumenten’, wie Stefan Blunier sagte, ‘historisiert’ wurde. Dazu hatte Blunier auch eine eigene musikalische Fassung erstellt (jede Aufführung von Monteverdis Orfeo ist ja aufgrund der schwierigen Quellenlage ohnehin immer eine Rekonstruktion). Das kann man alles machen und war ja auch schon andernorts erfolgreich. Doch das monotone Gleichmaß von Bluniers Tempi, denen jegliche Agogik fehlte, die temperamentlose, immer gleiche continuo Begleitung und die über weite Strecken farblose Instrumentation vermochten kaum ein überzeugendes Klangbild zu vermitteln. Das war immer nur Begleitung, nie aktive Gestaltung. Dazu kamen einige Patzer, wie die der Bläser bei der bekannten Toccata. Auch mit einem moderneren Orchester kann man durchaus Erkenntnisse der letzten Jahrzehnte aus historischer Aufführungspraxis ziehen, gerade was Klangfarben, Phrasierungen und Tempi betrifft. In Darmstadt war das kaum zu vernehmen. Oder aber man verweigert sich dem von vornherein; dann müsste man aber konsequenter Weise auf Fassungen wie die von Bruno Maderna zurückgreifen. Stilistisch ebenso unsicher waren auch die Sänger. Sven Ehrke in der anspruchsvollen Titelrolle ist eine sympathische Bühnenerscheinung, technisch war er allerdings mit seiner Rolle schlichtweg überfordert. Das zeigte sich nicht erst, als ihm gegen Ende auch die Koloraturen nicht mehr gelangen, sondern schon zuvor im ausdruckslosen Gesang der Freude und Klage, die sich atmosphärisch nicht unterschieden. Ehrke fehlen für diese Partie die Möglichkeiten der stimmlichen Farbgebung und Schattierung, der Atem- und Volumenkontrolle. Sein Charakter hatte keine vokale Entwicklung und blieb blass. Unscheinbar bleib auch Stephanie Maria Ott als Euridice, die zwar mit schönem Sopran brav phrasierte, aber keinen bleibenden Eindruck hinterließ. Katrin Gerstenberger als Messagiera fiel durch intensive Gestaltung ihrer gesungenen Botschaft auf, aber auch hier fehlte stilistisches Einfühlungsvermögen. Friedemann Kunder blieben gar die tiefen Töne des Caronte völlig weg, da war nur Luft zu hören; so etwas darf eigentlich in keiner Besetzung passieren. Jeffrey Treganzas Apollo, Mary Anne Krugers Prosperina und Andreas Daums Plutone waren auf solidem Stadttheaterniveau, nicht mehr aber auch nicht weniger. Es ist alles eine Frage der Relationen. Das Publikum der A-Premiere applaudierte freundlich und anhaltend, während Blunier mit dem Orchester Broadway-like noch einmal die Toccata anstimmte; ein Buh für Ehrke mischte sich darunter und einige Hände bewegten sich gar nicht. Wenn das Publikum mit einer derart aussagelosen und altbackenen Inszenierung zufrieden ist, dann hat John Dew ja seine Aufgabe in dieser Hinsicht erfüllt. Wenn dies aber auch ein programmatischer Auftakt für John Dews Darmstädter Intendantenzeit sein sollte, dann macht er in der Belanglosigkeit weiter, in die er die letzten Jahre mit unsäglichen, bunt ausgeleuchteten Rumstehinszenierungen, vor allem des Belcanto-Repertoires, geraten war. Aber vielleicht fällt John Dew ja doch noch mal etwas Neues ein? Früher jedenfalls, war er immer für Überraschungen gut. |
|
.... es lebe der König Mit dem Intendantenwechsel im Darmstädter Staatstheater hatten viele Opernfreunde dem gefeierten und erfolgreichen Friedrich Meyer-Oertel nachgetrauert, skeptisch gegenüber dem - zumindest für die Darmstädter - "unbeschriebenen Blatt" John Dew, neuer Intendant und gleichzeitig Opernspezialist. Mit Claudio Monteveris "L´Orfeo" gab er Ende September seinen Einstand und bewahrheitete damit sogleich das alte Sprichwort "Der König ist tot, es lebe der König". "L´Orfeo" gilt unter den Experten als eine der ersten Opern im heutigen Sinne, ja, vielleicht sogar als deren Ursprung. Erzählt sie doch eine dramatische und tragische Geschichte, die in sich abgeschlossen ist. Das musikalische Element dient hier weder als reine Belustigung wie in frühen Singspielen noch als hymnisch-klerikale Anbetung der göttlichen Instanz sondern als Spiegel menschlicher Gefühle und Leiden. Die Handlung selbst gibt den uralten Orfeus-Mythos wieder: Orfeus heiratet die geliebte Eurydike, verliert sie aber umgehend durch einen Schlangenbiss an die Unterwelt. Mit seiner Leier zieht er zum Hades und betört sowohl den Fährmann am Charon als auch Proserpina, die Gattin des Unterweltherrschers Pluto. Er darf Eurydike ins Reich der Lebenden zurückführen, sich aber auf dem Wege nicht nach ihr umdrehen. Als schwacher Mensch tut er aus Liebe natürlich gerade dies und verliert sie auf ewig. Den Verzweifelten tröstet sein Vater Apollon mit der Unsterblichkeit. Der Mythos vereint die elementaren und diametralen Triebkräfte menschlichen Lebens: Liebe und Tod. Der Mensch ist diesen Kräfte ausgeliefert und kann sie mit seinen transzendenten Fähigkeiten, und nichts anderes ist der Gesang, nur zeitweise aussetzen. Gehen Liebe und Gesang noch gemeinsame Wege ohne inhärenten Konflikt, stemmt sich der Tod allen menschlichen Bemühungen wie eine große Mauer entgegen. Doch selbst diesen kann die Kunst besiegen, wenn auch nur kurzfristig, und der Preis für diese Überwindung ist hoch. Die Ohnmacht des Menschen - hier ausgedrückt im Rückschauen Orfeus´ - ist ihm immanent und Teil des Lebens. Monteverdi hat das Rezitativ als wichtigstes musikalisches Mittel in den Mittelpunkt seiner Oper gestellt. Die Texte werden nicht in freier musikalischer Form mit entsprechend voluminöser Begleitung des Orchesters präsentiert, sondern als kunstvoller Sprechgesang, der nur selten in eine freie musikalische Ausdrucksform übergeht, und mit minimaler Begleitung durch das Orchester. Doch wer meint, dies mindere die Tiefe und Intensität des Ausdrucks, irrt. Die Beschränkung - nicht Reduzierung! - des oralen Ausdrucks auf eine dicht an der Sprache orientierte Form erlaubt eine zumindest ebenso intensive Wiedergabe von Emotionen wie eine "ausgesungene" Arie à la Mozart oder Verdi. Technisch sind die Anforderungen sogar höher, da die Solisten sich immer auf dem schmalen Grat zwischen spannungsloser Sprache und freiem Gesang bewegen müssen. Aus dem Orchester kommen zu diesen Rezitativen - vor allem den großen Solo-Arien - nur wenige "Tupfer", im Wesentlichen vom Cembalo und der Holzorgel mit ihren lang ausgehaltenen, tiefen Lagen, daneben von einer Reihe alter Lauten-Instrumente, die man in einer solchen Ansammlung noch nie im Darmstädter Orchester gesehen bzw. gehört hat, und feinen Kommentaren der Streicher. An besonders markanten Stellen greifen die Blechbläser ein: So zu Beginn, wenn Fanfaren aus dem Hintergrund des Zuschauerraums ertönen, oder beim Eintritt in die Unterwelt. Die einleitenden Bläser-Fanfaren begleiten auch den Chor auf die Bühne, der sich als lustig lärmende Hochzeitsgesellschaft durch den Zuschauerraum zur Bühne begibt, die dort dem Prolog der "Musica", einer harlekinartigen Figur, lauscht. Diese "Musica", dargestellt von Gerson Luiz Sales in der Manier eines Counter-Tenors, führte in der ursprünglichen Aufführungspraxis das fürstliche Publikum in die Oper ein. Hier verdoppelt sich dieses Publikum um die fiktive Hochzeitsgesellschaft auf der Bühne und bringt dadurch eine reizvolle Brechung der Bezugsebenen ins Spiel. Dieser Prolog lässt sich auch als die Urform der Opern-Ouvertüre deuten, die sich später zu wahren Miniatur-Sinfonien entwickelte. Bühnenbild und Kostüme der Inszenierung glänzen mit viel Farbe. Der Bühnenboden schwingt sich nach hinten zu einem Halbrund mit anschließendem blauen, von Wolken durchzogenen Himmel auf. Links und rechts stehen hohe Trennwände puristisch für Säulengänge. Die Kostüme sind zeitlos-modern, die Männer meist in hellen Leinenanzügen, die Damen des Chors in pastellfarbenen Kleidern. Die Protagonisten heben sich hiervon je nach Stellung ab: Eurydike im Hochzeitskleid, auch noch im Tod, Pluto als grün geschuppte Schlange - er hat sich über den Schlangenbiss Eurydike in den Hades geholt-, Proserpina mit einem symbolisch halbierten Kleid - halb grün wie Pluto, halb hell wie die Menschen -, die Diener des Hades in schwarz-grauen Fledermaus-Umhängen, glatzköpfig und furchterregend. Die Messagiera schließlich, die mit der bösen Botschaft von Eurydikes Tod Entsetzen auslöst, stürzt mit bleicher Maske und schwarzem Kleid auf die Bühne und zieht einen raumhohen, Unheil verheißenden Vorhang hinter sich her. Die Musik lebt von der Welt des Frühbarocks zu Beginn des 17. Jahrhunderts. Die Renaissance ist den Religionskriegen gewichen, Leid und Verfolgung breiten sich aus und üben ihre Wirkung auf die Menschen aus. Dieses Leid und die gewaltigen geistigen Umbrüche des 16. Jahrhunderts sind hier im Mythos des Orfeus verdichtet, zielen jedoch jedoch - ob unbewusst oder bewusst - auf die Befindlichkeit der Menschen in dieser Zeit. So überwiegt auch das - begründete - Klagen in der Musik, von der anfänglichen Hochzeitsfeier und ihrer Ausgelassenheit einmal abgesehen. Die Kernaussage erscheint zu Beginn des dritten Aktes, wenn Orfeus vor der Unterwelt steht, auf dem Vorhang: "Lasciate ogni speranza voi ch´entrate"; Dantes Wort aus der "Göttlichen Komödie": "Ihr, die Ihr hier eintretet, lasset alle Hoffnung fahren!". Dem Ensemble gelingt es in hervorragender Weise, diese Aussage in emphatische Musik umzusetzen. Dabei liegt das Schwergewicht auf den Gesangssolisten, die in ihren Rezitativ-Arien die Emotionen der Protagonisten ausdrücken müssen. Zuallererst ist dabei Andreas Wagner zu nennen, der mit dem Orfeus die tragende Rolle innehat und es schafft, den Spannungsbogen bis zum Schluss aufrecht zu erhalten. Selten hat man ihn so intensiv und auch technisch so überzeugend erlebt. Daneben fallen die anderen Darsteller jedoch nicht ab, auch wenn sie nur kürzere oder weniger tragende Partien zu bewältigen haben. Julia Amos verleiht der Eurydike den Charme einer glücklichen jungen Braut und zum Schluss die Entsagung der zum zweiten Mal Gestorbenen. Elisabeth Hornung gibt eine geradezu furchterregende Messagiera, die von ihrer Botschaft selbst am meisten verstört - ja, zerstört - ist. Andrea Bogner als Proserpina und Tito You als Pluto liefern sichere und auch schauspielerisch gekonnte Partien ab, und Gerson Luiz Sales eröffnet und beschließt den Abend mit einer leichtfüßigen Interpretation der "Musica.". Hervorzuheben ist auch der Chor, der unter der Leitung von André Weiß wieder einmal durch seine Stimmsicherheit und darstellerische Beweglichkeit überzeugt. Das Orchester unter Chefdirigent Stefan Blunier besticht vor allem durch die ungewohnte Instrumentation sowie die exakte Ausformung der feinen Begleitstrukturen, kann sich aber in dramatischen Momenten auch durchaus zu harmonischer und instrumentaler Fülle aufschwingen. Das Publikum geizte bereits zur Pause nicht mit Beifall und verabschiedete das gesamte Ensemble einschließlich Regie mit einhelligem, ausgiebigem Beifall, von dem der Löwenanteil auf Andreas Wagner entfiel. |