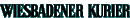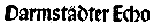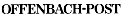|
Die Erben des Mythos VON HANS-KLAUS JUNGHEINRICH Sie lassen grüßen, die heroischen Barden von gestern und heute, im Leben Stars, im Tode Sternbilder am Himmel der kollektiven Erinnerung. Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Brian Jones, Madonna, John Lennon, Elvis Presley: Als zeitnahe Larven kleben sie vor den Gesichtern der Unterwelt-Götter und -Geister. Charon gar, der Totenschiffer, erscheint als sturer Klon des ewigblonden Heino, und Apollon (samt dem von ihm final berufenen Mänadenheer) hat sich gar die schwarze Haarpracht und den robothaften Schlottergang von Michael Jackson angeeignet. Die Riege der Hirten weidet sich bösartig-possierlich am tragischen Geschehen, eine Herde unbotmäßig dienstbarer Automaten-Heinzelmännchen. In all dem wunderlichen Getriebe der auf sich selbst gestellte Sänger Orpheus, ein grimmig-zotteliger Rabauke in zerfetzter Hose und mit E-Gitarre, die er mehr als Schlagwaffe denn als Verführungsinstrument handhabt, und Eurydike, eine schwer drogensüchtige Pop-Queen, total ausgeflippt und zu gefährlichen Stürzen neigend. Was soll diese Ikonographie ausgerechnet bei Monteverdis Orfeo von 1600, der ältesten erhaltenen Oper überhaupt, einem musikalischen Antiken-Projekt aus dem Geiste des Barock? Noch vor einigen Monaten demonstrierte John Dew in Darmstadt, wie man dieses Werk in schöner Gepflegtheit und phantasievoll dekorativ auf die Bühne stellen konnte, ohne hochkulturelle Optik zu unterlaufen. Dass der junge Regisseur David Hermann es nun im Bockenheimer Depot so konträr riskierte, war freilich den Versuch wert. Mehr noch, es warf ein besonderes Licht auf ein mythisches Sujet, das die waghalsigsten Lesarten rechtfertigt, wenn sie wie hier mit durchdringendem Ernst realisiert werden. Weniger von Belang (wenn auch nicht unerheblich) scheint dabei das Kalkül, ein verjüngtes Publikum mit scheinbar fernliegendem Stoff elektrisierend zu konfrontieren. Als verblüffend ergiebig zeigt sich aber vor allem das damit verbundene Pathos der Vergegenwärtigung. Die vermeintliche Nichtigkeit der kommerziellen Kultursphäre hat ihre dunkle Unterseite von Todesnähe, Todesverfallenheit. Sie partizipiert damit am Mythos. Schlicht gesagt: Es ist nicht alles Tand, was glänzt. Keine Illusion ein Spielen und Singen um Leben und Tod. Die Idole von heute sind also auch Wiedergänger des den Tod herausfordernden mythischen Dichters und Sängers Orpheus. Orgelregister als Gitarrenfloskel Eigentümlich neu - und das war wirklich das Ereignis dieses Abends - hört man auf diese Weise auch Monteverdis Musik. Abgeschält scheint von ihr der "historisierende" Gestus, die aristokratische Fremdheit einer hochartifiziellen, elaborierten, feudal kodifizierten Tonsprache. Wenn man Charon (mit humorig-sonorer Stämmigkeit: Magnus Baldvinsson) seine Klampfe wie ein Schild gegen Orpheus stemmen sieht, vernimmt man das begleitende Regal (ein Orgelregister) wie eine Gitarrenfloskel. Und die expressiven Aufbäumungen in der Partie des Orpheus klingen plötzlich wie die schrundigen, exaltierten Ausbrüche eines Rocksängers. Die Paradoxie ist umso größer, als der Dirigent Paolo Carignani und seine instrumentalen Formationen (Museumsorchesterstreicher, Bläser von "Ecco la musica" und der "Vivi Felice Barockmusikprojekte") kein Jota an zünftiger "authentischer" Aufführungspraxis ablassen. Es ist gerade dieser Widerspruch, der eine produktive, faszinierende Irritation herstellt (auch die jungen Madrigalisten des beteiligten Konzertchores Darmstadt, einstudiert von Wolfgang Seeliger, werden in diesen frenetischen Strudel hineingerissen). Staunend erlebt man das als erfüllt, was sonst oft als eine eher triviale Mutmaßung gehandelt wird: Monteverdis Expressivität ist von heute. Dabei schien der riesige, hochgewölbte Raum zunächst (bis sich die Ohren "justiert" hatten) nicht günstig für eine akustische Überwältigungskonzeption, als die sich die sorgfältige musikalische Wiedergabe nach und nach doch herausstellte, kulminierend im weit ausgreifenden Schlussmonolog der Titelrolle, mit der der wuchtige und lyrisch facettenreiche Bariton Christian Gerhaher eine gesanglich und darstellerisch imponierende Leistung vorstellte. Schauspielerisch wurde ihm ebenfalls Äußerstes abverlangt, bis hin zum Rundum-Rückwärtsgang über den schmalen Stegring, der das in einem kupferfarbenen Zentralpferch postierte Orchester einschloss. Akrobatisches Spiel Nach zwei diametral angelegten Publikumstribünen hin waren die Akteure adressiert. Zur wirkungsvollen Kargheit dieser szenischen Installation von Christof Hetzer (der auch die raffinierten Kostüme entwarf, darunter das scheinbar durchsichtige Netzkleid der Messagiera, anrührend gesungen von Arlene Rolph) kontrastierte eine bis ins Akrobatische gesteigerte Spiellebhaftigkeit. Weitere triftige stimmliche Eindrücke von Konstanze Schlaud (Euridice), Florian Plock (Plutone), Nidia Palacios (Proserpina) und Britta Stallmeister (als Musica keine steife Allegorie, sondern teilnehmende Beobachterin). Die Oper Frankfurt präsentiert jetzt doppelt soviele Premieren im Jahr wie zur Zeit von Martin Steinhoff. Man sollte ihn für die damaligen Defizite regresspflichtig machen, vielleicht in der Form einer Ehrenschuld, zu entrichten etwa in Kaurimuscheln, säckeweise. Jetzt hat, auch mit diesem Orfeo, Frankfurt wieder einen Ehrenplatz unter den Opernhäusern. Nichts gegen die Ehre; trotz Falstaffs Einspruch. [ document info ] Dokument erstellt am 14.03.2005 um 16:00:06 Uhr Erscheinungsdatum 15.03.2005 |
|
Frankfurt: Monteverdis "L´Orfeo" unter Drogen gesetzt Heino wartet bereits an der Pforte zur Unterwelt Von Volker Milch
Wie sieht der Albtraum eines Rockstars aus? In Frankfurt so: An der Pforte zur Unterwelt trifft er Heino, der eigentlich Charon heißt und mit wehrhafter Klampfe sein Schattenreich verteidigt. Nein, der mythische Sänger Orpheus hat es nicht leicht in David Hermanns Inszenierung von Claudio Monteverdis Ur-Oper "L´Orfeo", die am Anfang einer Reihe mit Werken des Altmeisters im Bockenheimer Depot steht. Da sich Charon rein musikalischen Nahkampfmaßnahmen gegenüber als resistent erweist, setzt ihn ein gezielter Schlag mit der E-Gitarre außer Gefecht. Orfeo träumt viel und schlecht in dieser Inszenierung, aber wenn er auf der Suche nach Euridice das Schattenreich betritt, hat das Träumen auch seinen Reiz. Er trifft zum Beispiel berühmte Kollegen, mit denen es sich trefflich fachsimpeln ließe: Elvis Presley, John Lennon, Jimi Hendrix, Brian Jones oder Jim Morrison. Ein Reigen rockender Geister. Der Chor trägt Masken legendärer Barden, mit denen Frankfurts Orfeo auch den ungesunden Lebenswandel gemein hat: Denn an Drogen wird im Umfeld des Stars nicht gespart. Er selbst wankt zwischen Wahn und Wirklichkeit über die Bühne, und seine Euridice ist ein Groupie, das kaum noch auf die Beine kommt. Von wegen Schlangenbiss: Todesursache war wohl eher eine Überdosis. An einer solchen krankt auch die Inszenierung, deren studentischer Charme durch eine Überdosis Munterkeit in die Klamotte umschlägt. Die Reinkarnation des Sängers als Rocker ist in der Geschichte des Orpheus-Mythos auch nicht ganz neu - legendär Harry Kupfers Sicht von Glucks Version des Stoffes an der Komischen Oper, wo Jochen Kowalski zur E-Gitarre griff. 2002 hat Joachim Schlömer Monteverdis "Orfeo" in Stuttgart zum Rockstar gemacht. Indes ist das Bockenheimer Depot mit seinem industriellen Charme ein trefflicher Ort für Hermanns Zeiten-Sprung. Die Bühne ist ein runder Laufsteg, der sich um das Orchester dreht. Auf ihm hält der Regisseur, der bei Hans Neuenfels in die Schule gegangen ist, die Handlung in Schwung. Das eigentliche Kraftzentrum mit enormer Ausstrahlung aber ist das Orchester unter Paolo Carignanis energischer Leitung. Ein glanzvolles, vom Publikum nachdrücklich gefeiertes Barock-Debüt für den Generalmusikdirektor. Streicher des Museumsorchesters haben Darmsaiten aufgezogen und vermitteln mit den Bläsern von "Ecco la musica" und "Vivi Felice Barockmusikprojekte" viel von der Macht dieser Musik, deren zeitloser Zauber dann doch nur sehr bedingt in der Bilderwelt massenkultureller Events zu fassen ist. Und die Besetzung ist so vorzüglich, dass sich der Weg nach Frankfurt allemal lohnt: Allen voran der umwerfende Bariton Christian Gerhaher als Orfeo, der in seiner Gestaltung der Partie nicht nur die dem Liedinterpreten eigene Kunst der Nuance zeigt, sondern auch mal so richtig aufdrehen kann, um seine uniformen Fans bei Laune zu halten. |
|
Heino bewacht die Unterwelt Von Michael Dellith Schlampige Arbeit kann man dem jungen Regieteam David Hermann (Inszenierung) und Christof Hetzer (Bühnenbild/Kostüme) wohl kaum vorwerfen. Mit Akribie und Feinsinn haben sie in die Musik Monteverdis hineingehorcht. Sie haben das rhythmische Potenzial aufgespürt, den barocken Drive entdeckt und in Bewegung umgesetzt – ja eine ganze Choreografie entwickelt, die nicht nur die Sänger, sondern auch das Orchester und den Chor miteinbezieht. Und sie haben eine Geschichte erzählt, freilich nicht die vom mythischen Orpheus, sondern eine ins Moderne transferierte: Hermann und Hetzer verwandelten den antiken Sänger in einen abgehalfterten Rockstar, dem die E-Gitarre um die Hüften hängt. Für sie ist Orpheus der Typus des selbstzerstörerischen Musikers, der nur durch Leiden zu seiner genialen Kunst findet – ein Hypersensibler, oft depressiv, der für das "normale" Leben untauglich ist und seine Reise in die Unterwelt als Drogentrip erlebt. Und die Hirten? Die erscheinen als Fan-Kollektiv im uniformen Trainingsanzug. Sie bewundern ihr Idol, hassen und verspotten Orpheus aber auch. Das alles spielt sich auf einem kreisrunden Laufsteg ab, und das Orchester sitzt, eingezäunt wie in einem Gehege, mitten drin. Ein Bühnenbild im herkömmlichen Sinne gibt es nicht. Dafür aber allerhand Action. Nicht nur, dass der Laufsteg fast ohne Unterbrechung rotiert, auch die auftretenden Personen – lauter kaputte Typen im punkigen Outfit – verfallen zum Rhythmus der Musik in unablässiges Zucken und Zappeln, Hüftschwingen und Posieren. Das mag für die Videoclip-Generation erbaulich sein, vom musikalischen Geschehen aber lenkt es ab. Und das ist besonders schade. Denn was Paolo Carignani, der mit dem "Orfeo" seine erste Barockoper dirigiert, dem Ensemble aus Streichern des Frankfurter Museumsorchesters, die auf Darmsaiten spielen, und Bläsern verschiedener Alte-Musik-Formationen an klanglichen Finessen entlockt, ist fabelhaft. Ihm gelingt ein plastisches Klangbild, rhetorisch geschärft, mal lyrisch-sanft, mal aggressiv aufgeraut im Ausdruck. Dabei tanzt Carignani in seiner filigranen und pointierten Zeichengebung die Rhythmen gleichsam mit, lässt die Musik immer vorwärts drängen. Auch sängerisch wird Exquisites geboten. Allen voran steht der gefeierte Liedinterpret Christian Gerhaher, der mit seinem höchst kultivierten Bariton die Gefühlsextreme des traurigen Titelhelden auslotet. Aber auch die Sopranistin Konstanze Schlaud als Euridice und die Mezzosopranistin Arlene Rolph (Messagiera) gestalten ihre Partien mit berückender Intensität. Ralf Simon (Pastore) und die Frankfurter Ensemblemitglieder Nidia Palacios (Proserpina), Britta Stallmeister (La Musica), Anna Ryberg (Ninfa), Florian Plock (Plutone), Michael McCown (Pastore) und Nathaniel Webster (Apollo) demonstrieren Barockgesang auf höchstem Niveau, unterstützt von den exzellent geschulten Sängern des Darmstädter Konzertchors. Bleibt noch Magnus Baldvinsson, der in der Partie des Fährmanns als Heino-Verschnitt die Unterwelt bewacht und von Orpheus eins mit der Gitarre übergebraten bekommt. Ein schöner Gag – das Premierenpublikum jubelte. |
|
Orfeo trifft Michael Jackson Musiktheater: Monteverdis Oper im Bockenheimer Depot in Frankfurt – Auch der Konzertchor Darmstadt ist dabei Von Heinz Zietsch FRANKFURT. Weder fährt Orfeo (Orpheus) zu den Sternen, noch wird er auf ein Denkmal gehievt, wie das zu Beginn dieser Spielzeit am Staatstheater Darmstadt in John Dews Inszenierung zu erleben war, sondern er bricht zusammen, der arme Mensch. Derweil er am Boden liegt, steigt eine Schar von Menschen im Gänsemarsch über ihn hinweg. Sie sehen alle aus wie vielfache Doubles von Michael Jackson, der zuvor als Gott Apollo Orfeo alle Herrlichkeiten der Sternenwelt, im übertragenen Sinn des Starkults, versprochen hat, in den Orfeo eingereiht und eingezwängt werden soll. Doch jetzt macht der unangepasste Sänger nicht mehr mit und gibt auf. Monteverdis Orfeo hat es in der Frankfurter Aufführung in die Popwelt von heute verschlagen. Orfeo selbst ist ein Rockstar, der zur Elektro-Gitarre, die allerdings stumm bleibt, seine Arien singt. Christian Gerhaher tut das mit schönstem Bariton-Belcanto und nuancenreichen Schattierungen. Seine Gemahlin Euridice führt sich auf wie ein blindlings ergebenes Groupie-Girl. Konstanze Schlaud, einst an der Darmstädter Akademie für Tonkunst ausgebildet, erfüllt diesen Part mit feiner, klarer und sicherer Stimme. Wie ein Macho behandelt Orfeo seine Euridice ziemlich von oben herab. Schließlich hat er noch andere Groupies im Gefolge, wie etwa die Botin (Messagera) oder die Hoffnung (Speranza). Der junge Regisseur David Hermann hat Monteverdis fast 400 Jahre alte Oper „L’Orfeo" mit dem Star- und Popkult unserer Tage verknüpft. Im Wettstreit singt der Rockstar Orfeo mit Caronte (Magnus Baldvinsson mit kräftigem Bass), der in Gestalt des die Klampfe spielenden Schlagersängers Heino mit marschierenden Schritten daherkommt. Da hilft nur noch eines: Da ein Rockstar keinen Menschen mehr in den Schlaf zu singen vermag, schlägt Orfeo seinen Kontrahenten Caronte mit der E-Gitarre zusammen. Doch es treten noch andere Popgrößen auf: Plutone trägt eine Maske von Elvis Presley und beherrscht natürlich auch den charakteristischen Hüftschwung, derweil ihn Proserpina mit Marilyn-Monroe-Maske becirct. Klar, dass auch Apollo Michael Jacksons Moonwalker-Schritt imitiert. Orfeo ist in dieser Inszenierung der Oper Frankfurt ein größenwahnsinniger Rockstar, dem seine Fans von der Ehrentribüne aus singend zujubeln. Es ist der von Wolfgang Seeliger sicher einstudierte Konzertchor Darmstadt, der wendig und klar singend die Chorpartien zum Besten gibt. Die Raum-Konstellation im Bockenheimer Depot ist für diese Sicht auf die erste durchgeformte Oper der Musikgeschichte ideal. Das Publikum blickt von zwei Seiten auf eine runde Spielfläche, in deren Mitte das von Barockspezialisten unterstützte kleine Orchester sitzt, dem Generalmusikdirektor Paolo Carignani mit heftigen und enervierenden Dirigiergesten regelrecht einheizt, als müsste sich auch der Orchesterleiter in diesem Stück in Szene setzen. Drumherum ein erhöhter und sich oft drehender Ring als Bühne (Ausstattung: Christof Hetzer). Entsprechend dem vergegenwärtigenden Ansatz der Regie raut der Dirigent den Orchesterpart auf, lässt ihn gleich zu Beginn eher aggressiv als geschmeidig erscheinen, so dass die einleitende Toccata fast wie ein Stück aus der Hardrock-Szene klingt. Und gar nicht so selten hat man in den rhythmisch wie melodisch stark akzentuierten Stücken den Eindruck, als hätte Monteverdi bereits in seiner Zeit der Renaissance die ersten Popsongs erfunden. Mit tänzelnden Schritten im Disco-Maß tun die verschiedenen Sänger noch ein Übriges. Die Sicht des Regisseurs ist also aufgegangen und wurde bei der Premiere am vergangenen Sonntag nach der knapp eindreiviertel Stunden dauernden pausenlosen Aufführung vom Publikum mit kräftigem Beifall bedacht. Monteverdis „L’Orfeo" ist unbeschadet im Rockzeitalter angelangt. |
|
Junge Regisseure haben es nicht leicht. Das gilt auch für das Operngenre. Fällt ihnen nichts Besonderes ein, nimmt sie öffentlich niemand zur Kenntnis, nur die Lokalkritik. Also: Ein neuer Einfall, eine zündende Idee muss her, damit man überregional auffällt. Das Problem dabei ist, dass solche Ideen schon früheren Regiegenerationen gekommen sind, als diese jugendbewegt ums Auffallen bestrebt waren. So wiederholt sich gleichsam in Jahresringen manches, und ein gut Teil gegenwärtiger Musiktheaterlangeweile rührt sicher daher, daß junge Opernregisseure sich die Welt der Oper auf eigene Faust zu imaginieren versuchen. Schließlich wurde auch das Schießpulver mehrfach erfunden. Die "deformation professionnelle", die dabei dem regelmäßigen Beobachter der Opernszene als Gefahr droht, sollte jedoch nicht dazu verführen, aufkeimenden Talenten die gebührende Aufmerksamkeit zu verweigern. Eines dieser Talente heißt David Hermann, ausgebildet an der "Hanns Eisler-Hochschule für Musik" in Berlin und häufiger Assistent von Hans Neuenfels, was ja keine schlechte Referenz ist. (...) In Mannheim überzeugte seine Darstellung von Mozarts Jugendoper Ascanio in Alba, in der er im kurzweiligen Verkleidungsspiel den traumatischen Aspekt aufdeckte: Im Schlaf erscheint der Nymphe Silvia immer wieder das Bild Ascanios, ohne diesen identifizieren zu können. Mit Hilfe einer Verdoppelung des Liebespaares durch zwei hinzugefügte Sprecher öffnete David Hermann gleichsam eine tiefenpsychologische "Wahnsinns"-Dimension in der Geschichte. Das Wahnsinns-Motiv projizierte der Regisseur jetzt auch auf Monteverdis erste Oper L'Orfeo, die er für die Oper Frankfurt in deren Nebenspielstätte im Bockenheimer Depot als Auftakt zu einem mehrteiligen Monteverdi-Zyklus inszenierte. Es lag nahe, im Bestreben nach dem individuellen Einfall den orphischen Barden weder in die plutonische Hölle noch in den apollinischen Himmel zu schicken, sondern in die Pop-Rock-Szene, ausstaffiert mit E-Gitarre, Drogen und dem typischen Schmuddel-Outfit. Orfeo steht unter hohem Erwartungsdruck. Seine "Fans", die als weiße Strichmännchen und mit verklebten Glatzkopfüberzügen kostümierten Hirten und Geister, treiben ihr Idol unbarmherzig voran. Eine anonyme Masse, die den hypersensiblen, introvertierten Sänger in die Depression treibt, speziell nach dem Tod der geliebten Euridice. In einem Akt von "kreativem Wahnsinn" (Hermann) gelingen Orfeo dann einige wunderbare Gesänge, die allerdings schon ein Barockkomponist namens Monteverdi schrieb. Aber dieser scheinbare Widerspruch zwischen dem tradierten Werk und der modischen Adaption ist höchstens oberflächlich wirksam. Die zerstörerischen Kräfte einer angestrengten Kunsthervorbringung, von der viele große Künstler der Vergangenheit bedroht waren, darf man auch für die Sphäre der Rock- und Popmusik reklamieren. Der psychische Druck, der hier gerade durch das Wechselspiel zwischen einer fordernden gesichtslosen Verehrermasse und dem individuellen Sänger-Musiker-Künstler entsteht, ist fast unermessbar. Der reale "Wahnsinn" liegt immer nahe, und so steigert sich David Hermanns Orfeo immer heftiger in seine Halluzinationen: Die Orpheus-Geschichte findet nur mehr in seinem Kopf statt, wobei ihm die Strichmännchen mit ihren vorgehaltenen Gesichtsmasken bekannter Rock- und Pop-Größen als unheimliche Phantasmagorie erscheinen. (...) GERHARD ROHDE |
|
Monteverdis "Orfeo"-Oper rockt das Bockenheimer Depot
Sie liegt schon wie hingestreckt auf der mittig arrangierten Drehbühne, wenn das Publikum weit voneinander getrennt seine Plätze einnimmt, und Paolo Carignani mit erstaunlich reinen "historischen" Holz- und Blechbldsern für ein festliches Entrie sorgt. Frau Musica im abgerissenen Party-Look scheint ihren Rausch auszuschlafen. Und wirkt angeschlagen, mit blutiger Wunde im Gesicht, als sei sie im Fan-Pulk jenes Superstars unter die Räder gekommen, dessen unsterblichen Ruhm sie mit süß lockendem Sopran (Britta Stallmeister) verkündet: Claudio Monteverdis "L' Orfeo", Titelheld aus frühen Operntagen, ldutet im Bockenheimer Depot lustvoll die Endzeit dieses Bühnengenres ein. Regisseur David Hermann hat ihn in zwei durchweg spannenden Stunden mit zerlumpten Jeans und Fender Stratocaster als Rockheroen ausgegeben. Und Monteverdis Musik, von Carignani im Intensivkurs dargeboten, der die so genannte historische Praxis ohne ideologische Scheuklappen als theatrales Ausdrucksmittel nutzt, gibt ihm sogar stellenweise Recht. Zerfließt sie doch zwischen prosaischem Rezitativ, tdnzerischem Ritornell, populdrer Chorgestik und feinem Arienmelos angelegentlich wie im klanglichen Rausch. Besitzt zudem rhythmischen Impetus - aber schon zu Beginn des 17. Jahrhunderts mehr als jene drei Begleitakkorde, von denen so mancher Rockheld heutzutage lebt. Wieder einmal garantiert ein Sdnger den Erfolg der Frankfurter Oper in Sachen Monteverdi - zur Premiere am Sonntagabend hagelte es verdiente Bravos für Titelheld Christian Gerhaher, der seine mal fein timbrierten, mal bewusst groß aufgemachten Stimmgaben ganz natürlich einbrachte. Wie die "historischen" Streicher - ohne störendes Vibrato. Ein schlanker heller Bariton, dessen Oratorien- und Kunstlied-Erfahrung diese Rolle trägt. Gottlob kein Monteverdi-Belcantist, aber auch ungemein sportlich die Zirkusarena umrundend, in deren Mitte das Orchester platziert ist. Was diese Inszenierung allen Akteuren abverlangt - Hermann bleibt konsequent im Bild, ldsst die Puppen tanzen. Wenn sie nicht gerade so bekifft herumhdngen wie Euridice (Konstanze Schlaud), eine köstliche Schlampe mit girrendem Sopran im Schlepptau des Orfeo, dessen Halbgott-Lob die Hirten und Nymphen besingen, hier in ihren aufgeklebten Glatzen und gleichförmigen Trikots geklonte Wesen vom Fantasy-Stern (Ausstattung: Christof Hetzer). Headbanging und allerlei seltsame Verrenkungen ersetzen das Ballett. Denn auch rhythmisch geht Carignani mit den Streichern des Museumsorchesters und den ungemein versierten wie ambitionierten Bldsern von "Ecco la musica" und "Vivi Felice Barockmusikprojekte" in die Vollen. Klanglich apart das origindre Continuo von "Echo du Danube" sowie von Doppelharfe und Theorben. Nicht zu vergessen den stimmlich ausgewogenen, seitlich platzierten Konzertchor Darmstadt (Einstudierung: Wolfgang Seeliger). Man kennt die Geschichte, im Depot auf italienisch gesungen, aber mit deutschen Übertiteln: Orfeo verliert seine Geliebte durch einen Schlangenbiss. Die traurige Botschaft überbringt Messagiera, eindringlich und mit mehr als nur stimmlicher Hingabe für den Guitar Man, der sich mit einem Würgegriff bedankt - Mezzosopranistin Arlene Rolph ist die personifizierte Leidenschaft. Und dann stellt sich dem Rocker auch noch ein als Heino maskierter Fährmann (Magnus Baldvinsson) in den Weg, der partout nicht auf dessen sensiblen Bittgesang einschlafen will - und daher die Gitarre über den Schädel bekommt. Im Hades sind sie versammelt, die früh Verstorbenen der Rockgeschichte, mit Elvis als Plutone (Florian Plock) und Janis Joplin als dessen Weib Proserpina (Nidia Palacios), dem Starkollegen eine Chance gebend, die Orfeo nicht nutzt, weil er sich aus liebevoller Fürsorge nach Euridice umschaut. Seine elegische Klage lockt den vdterlichen Apollo (Nathaniel Webster) der irdische Leiden in himmlische Freuden umzumünzen versteht: Mit den Hirten und Nymphen - jetzt geklonte Robot-Engel in schwarzen Plastik-Rastazvpfen - schreiten beide gemessen "nach oben", dabei frohlockend, wie ein vorweggenommenes Osterlachen. Überhaupt ist das Lachen bei David Hermanns "Orfeo" bedeutsam: Ein berufsmdßiges Ldcheln wie bei den Popstars auf den Bühnen dieser Welt, aber auch hdmisch, wenn Orfeo und Euridice den wohltemperierten Chor auslachen. Und tückisch angesichts des Unheils, das über den Opernrocker hereinbricht. Unsereins stimmt das alles freilich ein wenig traurig. Schließlich ist hier die ruhmreiche Operngeschichte schon zu Ende, bevor sie erst richtig begonnen hat. Immerhin: In Frankfurt ein Begräbnis erster Klasse. KLAUS ACKERMANN |
|
Das eigentlich Spannende am Theater ist dessen Unberechenbarkeit. Als die Oper Darmstadt im September mit Claudio Monteverdis L´Orfeo in die Saison startete, hatte wohl jeder Szenekundige damit gerechnet, dass John Dew als neuer Intendant am Hause ein Zeichen setzen würde mit einer revolutionären, neuen Lesart des Stoffes. Doch das enfant terrible von einst war zahm und zahnlos geworden, seine Inszenierung des Orfeus-Mythos eine zwischen belangloser Buntheit und narrativem Gestus pendelnde Plauderei. Doch jetzt kommt – ausgerechnet am benachbarten Haus in Frankfurt – ein junger Regisseur daher, ein Assistent von Hans Neuenfels, und zeigt dem erstaunten Publikum, wie aktuell und zeitgemäß eine brillante Inszenierung eben jenes L´Orfeo auszuschauen hat. David Hermann und sein Kostüm- und Bühnenbildner Christof Hetzer schlagen mit ihrer Inszenierung im Bockenheimer Depot von vornherein allein optisch einen bezwingenden und ungewohnten Weg ein. Das Orchester platzieren sie in einem kupferfarbenen Holzverschlag in der Mitte eines riesigen, horizontalen Rades, eines Laufstegs, der sich um das musikalische Zentrum dreht. Darauf agierten die Sänger. Kein Vorhang, keine weiteren Requisiten. Das Ganze steht in der Mitte der Halle, auf drei Seiten sind ansteigende Publikumstribünen montiert. Der Sänger als Rockstar. In diesem Rotationsfeld menschlicher Motiviertheit entwickeln die beiden ein hochkomplexes, durchspychologisiertes Spannungsgefüge. Es ähnelt der banalen Geschichte um den liebenden Mann, der seine Angebetete aus dem Reich der Toten zurückholen möchte, nur noch in Ansätzen. Orfeo wird zum Rockstar mit langen Haaren und E-Gitarre, dessen Kraft schon längst nicht mehr aus der musikalischen Inspiration fließt. In Caronte (Magnus Baldvinsson), einem blondgescheitelten Heino-Ebenbild, findet er den Gegenspieler, den er mit blanker Gewalt und der schlagkräftigen Hilfe des Instruments niederzwingt. Vom Tod bedrohte Rockstars, deren Schicksal ebenfalls von der Entrückung und Selbstüberschätzung direkt in den Selbstmord oder Drogentod führten, säumen fortan seinen Weg: Jimi Hendrix, Janis Joplin, Brian Jones, Elvis Presley, Jim Morrison, John Lennon - ein durchaus interessanter und legitimer Gedankengang, wenngleich zu hintergründig, um ihn auf Anhieb gänzlich ausloten zu können. Aber auch das macht die Sache spannend. Ist das Aufeinandertreffen von Orfeo und Caronte/Heino nicht bereits von Monteverdi kompositorisch als affektgeladener Zornesausbruch angelegt? Nicht minder großartig ist die musikalische Ausgestaltung dieser Favola in musica. Generalmusikdirektor Paolo Carignani erweist sich erneut als fundierter Kenner historisierender Aufführungspraxis, erweitert die Streicher des Frankfurter Museumsorchesters um die Bläser von "Ecco la musica" und "Vivi Felice Barockmusikprojekte" sowie die Continuo-Gruppe "Echo du Danube" und kreiert somit einen affektgeladenen Klang. Großartig Christian Gerhaher in der Titelrolle. Der junge deutsche Bariton verkörpert den scheiternden Helden mit enormer Strahlkraft und Klarheit. Ideal besetzt auch die Allegorie der Musica mit Britta Stallmeister. Es lohnt sich, zuweilen auch Nebenrollen mit der ersten Garde des Hauses zu beauftragen, denn Stallmeister verfügt über exakt jene Tiefe und Dramatik, die diese Rolle verlangt. Mimisch und stimmlich hervorragend weiterhin Arlene Rolph (Messagiera/Speranza) und Konstanze Schlaud (Euridice). Katharina Kutsch verkörpert eine der allegorischen Madrigale dieser rundum empfehlenswerten Inszenierung. Christian Rupp |