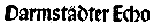|
Wie närrisch darf’s denn sein? Musiktheater: John Dew inszeniert Rameaus Oper „Platée" im Staatstheater Darmstadt als karnevalistisches Stück Von Heinz Zietsch DARMSTADT. Hässlich, wie es im Libretto heißt, sieht Platée in John Dews Inszenierung von Jean-Philippe Rameaus gleichnamiger Oper nicht aus, allenfalls ein bisschen aufgetakelt, überschminkt und etwas überspannt, weil sie sich nichts sehnlicher wünscht als einen Mann. Im Grunde ist diese in einer Sumpflandschaft residierende Nymphe eine naive, einfältige und tragische Figur, die am Ende einsam und verlassen, in einem Lichtspot sitzend, zurückbleibt. Jupiter hat ihr seine Liebe nur vorgegaukelt, weil er seine Gattin Juno von ihrer Eifersucht erlösen will. Tatsächlich parodiert Rameau in dieser Figur zugleich die Tragödie. Die Titelgestalt ist bereits in der 1745 uraufgeführten Komposition für eine Männerstimme geschrieben, die mit schrägen, ungewohnten und ausdrucksstarken Intervallsprüngen daherkommt, was das manchmal Linkische und Unbeholfene dieses Mannes in Frauenkleidern noch verstärkt. Die Masken- und Kostümbildnerei hat für die Darmstädter Aufführung viel Frau in diesen Mann hineingelegt und daraus eine Travestiegestalt gemacht, die der legendären Mary den Rang ablaufen könnte. Und Jeffrey Treganza, dessen lange Beine ganz und gar nicht so männlich aussehen, reizt diesen parodistischen Part genüsslich aus. Als Tenor mit baritonaler Stimmfärbung verfügt dieser großartige Sänger über vielerlei Schattierungs- und Ausdrucksmöglichkeiten. Hinzu kommen eine breit gefächerte Darstellungskunst und eine Mimik, die geschickt die höfisch-barocken Gesten aufgreifen. Klar, dass er am Ende der gut zweieinhalb Stunden dauernden Premiere am Freitag im Staatstheater Darmstadt den meisten Beifall vom Publikum im nicht vollständig besetzten Kleinen Haus bekam. Überhaupt kam die Inszenierung des Regie führenden Intendanten bestens an. Die Zuschauer waren hingerissen von dieser fantasievollen Aufarbeitung des barocken Stoffes und applaudierten überschwänglich. Mit leichter Hand hat sich Dew dieser Oper angenommen und das Komische, Parodistische herausgearbeitet. Das fängt bereits mit dem Prolog an, der einer Prunksitzung eines Karnevalsordens gleicht. Chor und Solisten tragen Narrenkappen und besteigen die Eulen-Bütt. Sogar ein zünftiges Karnevalsballett marschiert am närrischen Komitee vorbei. Fast leitmotivartig durchzieht das Karnevalsthema die Szenerie. Hier kommt der von André Weiss famos einstudierte Chor mit seinen Bajazzi und Clowns immer wieder zum Zuge. Dew mischt die Zeiten geschickt durcheinander, so dass sich Gegenwart und Barock reibungslos treffen: Es wird aus der Sicht von heute mit dem barocken Stil gespielt. Schließlich servieren viele Shows von heute Effekte, die mit der Opulenz des Barockzeitalters durchaus vergleichbar sind. Die Show muss weitergehen, und da langt Dew kräftig hin. Mercure kommt per Flugzeug („Olympic Air"), da quaken und tapsen Frösche und Schildkröten, Riesenbabys in Windeln purzeln und albern umeinander, Roller-Blades-Fahrer fegen wie im Sturmwind über die Bühne, ein Hüften wie die E-Gitarre schwingender Elvis-Presley-Verschnitt tänzelt auf einem amerikanischen Straßenkreuzer, mit dem Jupiter vorfährt, da kreuzen Müllmänner auf, um den Katzenjammer der verhinderten Liebe zwischen Jupiter und Platée wegzufegen, und La Folie, die Verkörperung der Narrheit, macht als Schlagersängerin (mit Mikrofon natürlich) ihre Show, als wünsche sie sich einen Cowboy als Mann. Tatsächlich wird sie von Cowboys umschwirrt. Andrea Bogner macht als La Folie stimmlich wie darstellerisch eine glänzende Figur. Überhaupt sind die Partien – es wird französisch gesungen (mit deutschen Übertiteln) – alle vorzüglich besetzt. Dimitry Ivashchenko wuchert als Jupiter mit seinem pfundigen Bass. Auch darstellerisch bleibt nichts zu wünschen übrig. Großartig, wie Katrin Gerstenberger als Juno ihre Stimme einsetzt, die an Wucht und Kraft enorm gewonnen hat. Jordi Molina zeigt sich als Mercure mit heller, perfekt sitzender, wenn auch schmaler Tenorstimme stets gewandt. Geradezu ausgewogen rund und volltönend serviert Werner Volker Meyer die Partie des Cithéron. Köstlich, wie Thora Einarsdottir als betulich-scheue Dienerin der Platée sich beim Aufbau des Liegestuhls verheddert. Dew hat die idealen Leute um sich geschart, die seinem unterhaltsamen Konzept zuarbeiten, welches das Publikum bezaubern und zum Lachen bringen soll. Tatsächlich wird bei der Premiere viel gelacht und geschmunzelt wie selten in einer Oper. Da sind die farbenprächtigen Bühnenbilder von Heinz Balthes, der im ersten Bild einen paradiesischen Zaubergarten im Stile des naiven Malers Rousseau entwirft. Hinzu kommen die bunten, fantasievollen wie faszinierenden Kostüme von José-Manuel Vázquez. Und wenn mal der Ablauf durchzuhängen droht, gibt’s flugs ein paar Tanzeinlagen, die in der Choreografie von Mei-Hong Lin wieder für Bewegung sorgen. Rameaus „Platée" ist im Grunde eine komische Oper mit Balletteinlagen, keine Ballett-Opernkomödie – die Bezeichnung des Komponisten als „Ballet-bouffon" führt hier ein wenig in die Irre. Die Tänze lockern das Stück auf, sorgen für Bewegung. Die entsprechende Grundlage bietet Rameaus Musik, aus der das Orchester des Staatstheaters unter der Leitung von Raoul Grüneis die überraschenden, witzigen und illustrierenden Momente stilsicher herausholt. Beherzt kostet der Dirigent, nach anfänglichen Unebenheiten zwischen Bühne und Orchester, die dynamischen Wechsel und die harmonischen wie rhythmischen Finessen aus, die das Ohr selbst heute noch so wunderbar reizen. Sehr schön im Klang integriert ist das vom Verein der Freunde des Staatstheaters gestiftete Cembalo mit einem wunderbaren Lautenzug, der die dicken, perlenden Krokodilstränen der Platée tönend illustriert, während die Streicher seufzen und die Flöten zu schrägen Orchesterharmonien den Lärm der Vögel imitieren. Die Musik bietet jene Tiefe, der Dews Regie aus dem Wege geht vor lauter närrischen, niedlichen, netten und putzigen Details, die manchmal aber auch nur flach und albern wirken. Unterhaltsam und witzig ist die Inszenierung allemal und wird das Publikum begeistern – wie schon im September 2002 am Staatstheater Wiesbaden, wo Dew die Oper erstmals inszeniert hatte. Jetzt ist das Werk als Koproduktion mit Wiesbaden auf die Darmstädter Bühne gekommen, aber eigentlich eine Neuproduktion, denn alles musste auf die Darmstädter Verhältnisse neu zugeschnitten werden. |
|
John Dew inszeniert in Darmstadt zum Saisonabschluss Rameaus Oper "Platée" Wenn sich der Vorhang im Kleinen Haus des Staatstheaters nach der Ouvertüre hebt, sehen sich die verblüfften Zuschauer einem "Elferrat" mit bunten Narrenkappen gegenüber, wobei man wohl eher von einem "111-Rat" sprechen muss, da neben den Hauptdarstellern der gesamte Chor das karnevalistische Gremium erweitert. Diese groteske Versammlung präsentiert nun den Prolog, der die Handlung nicht nur einleitet sondern ihr darüber hinaus auch einen ironischen Rahmen verleiht. Die Rahmenhandlung, die das Thema des eigentlichen Stücks erst entwickelt, führt zu einer inhaltlichen Distanzierung und verhindert damit eine irrtümliche ernsthafte Rezeption des Stoffes. Diese Vorgehensweise ergibt sich schlüssig aus dem ursprünglichen Konzept der Oper, dem Publikum am Hofe Ludwig XIV. ein vor allem amüsantes Spektakel zu bieten. Eventuelle motivische Grausamkeiten, die das Libretto durchaus enthält, verwandeln sich dadurch in eine satirische Groteske. Eine weitere Erfahrung oder Grundeinstellung mag John Dew zu seiner Art der Inszenierung motiviert haben: Schauspielerei hat in erster Linie etwas mit der Lust und dem Spaß an der Vor- und Verstellung zu tun. Theater - und damit auch die Oper - dient nicht in erster Linie der Entlarvung misslicher gesellschaftlicher Zustände sondern vor allem dem lustvollen Nachstellen menschlicher Schwächen und der grotesken Konstellationen des Zusammenlebens. Insofern ist Theater eher komödiantisch und und ironisch, seltener rein tragisch und ernsthaft. John Dew hat diese Erkenntnis zur Grundlage seiner "Platée" gemacht und kostet die komödiantischen Möglichkeiten dieses barocken Werks denn auch genüsslich aus. Im Prolog entwickeln einige Archetypen der antiken Kulturgeschichte - Momus, Thespis, Thakia und Amor - die Idee eines lustigen Spaßes, um die langweilige Götterwelt etwas "aufzumischen". Der ewige Fremdgänger Jupiter soll der so hässlichen wie liebesgierigen Nymphe Platée den Kopf verdrehen und ihr die Heirat anbieten, und erst Jupiters eifersüchtige Gattin Juno soll im letzten Moment diese Mésalliance verhindern. Das Ganze ist als Riesenspaß auf Platées Kosten geplant - soweit zur Nachbarschaft von Witz und Grausamkeit. Dabei spielt Merkur eine wesentliche Rolle als Vermittler zwischen Götter- und Menschenwelt. Platée, die Herrscherin über die Sumpfbewohner, klagt denn auch im ersten Akt über die fehlende Liebe und erwählt umgehend Momus als Objekt ihrer Begierde, der ihr eigentlich nur beiläufig die Nachricht von Jupiters Neigung zu ihr überbringen soll. Nur mühsam kann sich Momus mit dieser Botschaft ihren Zudringlichkeiten entziehen, und sofort ist Platée von der Liebe des Göttervaters überzeugt. In jedem Lebewesen - Esel, Eule - sieht sie den verkleideten Göttervater und befiehlt ihrem amphibischen Gefolge, in die Jubelrufe über ihr Glück einzustimmen. Jupiter kommt denn auch unter Blitz und Donner, spielt den vermeintlichen Liebhaber und lässt die Dinge bis zur Hochzeitsfeier treiben, aus der ihn erst im allerletzten Moment eine scheinbar vor Eifersucht rasende Juno befreit. Die Gesellschaft windet sich vor Lachen, Platée jedoch zieht sich wütend und rachelüstern in ihre Sümpfe zurück. Rameau hat diese eher schlichte Handlung durch umfangreiche Tanzeinlagen am Ende eines jeden Aktes angereichert, da Ludwig XIV. als großer Freund und Experte des höfischen Tanzes galt. Und dem Potentaten zu Gefallen zu sein, war nicht die schlechteste Art, die eigene Stellung am Hofe zu festigen. John Dew nutzt diese Konstruktion zusammen mit der Tanzabteilung des Staatstheaters zu so ungewöhnlichen wie skurrilen Tanzeinlagen. Wer hier "klassisches" Ballett erwartet hatte, sah sich enttäuscht. Für die Inszenierung des Librettos gilt das Gleiche. Konsequent setzt Dew auf das Groteske, Karnevaleske und Unterhaltende der Vorlage. Das fängt mit dem großen Fastnachtsrat an und setzt sich fort in den einzelnen Figuren. Momus alias Cithèron kommt als Clown mit weiten Hosen und grell geschminktem Gesicht daher, Mercure als listiger Wirbelwind im Phantasiekostüm und viel Schalk im Genick. Er reist in einem an der Bühnenrückwand abwärts gleitenden Airbus aus dem Olymp an und entsteigt einer veritablen Gangway mit der Aufschrift "Olympic Air". Als Platée, bereits bei Rameau von einem Mann besetzt, stolziert Jeffrey Tragenza aufgeblondet und im rosaroten Strandkostüm auf hohen Hacken aus den grünen Sümpfen (nicht politisch gemeint!) auf die Bühne. Die Dienerin Clarine im faden Einheitskostüm, Brille und Schnittlauchfrisur gewinnt ihr marginalisiertes Selbstbewusstsein lediglich aus der vor der Brust festgeklammerten Handtasche. Jupiter erscheint als "Clark Gable"-Verschnitt im rosa Cadillac mit sonnenbebrilltem Chauffeur, und die "Narrheit" ("La Folie") tritt mal als Elvis-Karikatur auf dem Kofferraum des Cadillacs und dann wieder als flotte Westernbraut im Kreise handfester Cowboys auf, die eine gekonnte Tanzshow à la Texas hinlegen. Den Rest der Tanzeinlagen übernimmt das reichhaltige Ensemble des platéeschen Sumpfes alias die Mitglieder des Tanztheaters: Frösche, die auf der Bühne umeinander kugeln, große Insekten mit Flügeln und spitzen Nasenfühlern und wild beblätterte Sumpfpflanzen. Als Höhepunkt spielen dann ein halbes Dutzend übergroße Säuglinge mit Windeln und Rasseln mit gekonnt inszenierter Plumpheit und scheinbar zufälligen Verrenkungen Sandkastenspiele auf der Bühne. Diese Wickelkinder stehen für die brennenden Sehnsucht der hässlichen Nymphe nach vielen Jupitersöhnen. Eine wichtige Rolle spielen in dieser Oper die Musik und die Sprache. Das klingt zwar trivial, ist es aber nicht in dem vermeintlichen Maße, denn beide ahmen bewusst die Laute des Sumpfes nach oder kommentieren ironisch die Gefühlsregungen der Protagonisten. So bedient sich Platée immer wieder der Worte "Dites moi! Pourquoi", was sich wie das Quaken der Frösche im Teich anhört. Das Orchester schließt sich diesen Lautmalereien an, lässt mal per Flöten die Vögel in der Sumpfflora zwitschern, dann wieder im breiten Celloton die Kröten unken. Darüber hinaus gibt das Orchester mit lang nach unter gezogenen Seufzerklängen Platées falsche Sentimentalität der Lächerlichkeit preis. Fast liebevoll folgt das Orchester unter der Leitung von Raoul Grüneis den schnell wechselnden Befindlichkeiten auf der Bühne und karikiert diese immer wieder mit geradezu diabolischer Lust. Das gilt auch für die Länge der Arien und andere musikalische Eigenarten, die immer wieder als satirische Überzeichnung gewisser musikalischer Usancen von Rameaus Zeigenossen daher kommen. So spielt die Musik mit dem Sujet und die Protagonisten auf der Bühne spielen mit der Musik, und das Ganze ergibt einen Heidenspaß mit viel Futter für musikalische Experten. Der Chor fügt sich in dieses Satyrspiel glänzend ein und hat neben den szenischen Aktivitäten auch gesanglich eine Menge zu leisten. Womit wir bereits bei der Ensemble-Kritik sind. Allen voran begeisterte Jeffrey Tragenza mit seiner allerdings auch sehr dankbaren Rolle als Transvestit. Er nutzt die Möglichkeiten dieser publikumswirksamen Konstellation in vollen Zügen aus und lässt kein legales Klischee ungenutzt, frei nach dem Motto: "Hier bin ich Transvestit, hier darf ich´s sein". Da tänzelt er und wackelt mit den Hüften, himmelt Jupiter an, lässt die Zicke gegenüber der Dienerin raus, schmollt, strahlt, sonnt sich im vermeintlichen Erfolg und zieht dabei alle Register weiblichen Verhaltens, wie es sich die Männer so vorstellen. Das gibt natürlich reichlich Gelegenheit zum Lachen, und das Publikum nahm dieses Angebot auch dankbar an. Wenn das Klischee als solches von Anbeginn als Motto vorangestellt wird, gewinnt es eine gewisse Legitimität, und Jeffrey Treganza brilliert in dieser Rolle, natürlich auch stimmlich, wobei seine kraftvolle Stimme allein schon ironisches Apercu ist. Die anderen Rollen fallen dagegen kaum ab, wenn sie auch nicht ganz die szenische Dominanz aufweisen. Dabei sind natürlich Werner Volker Meyer als Momus alias Cithéron sowie sein "alter ego" Jordi Molina als Mercure zu nennen. Diese beiden bilden ein gut aufeinander eingespieltes Paar und werfen sich die verbalen Bälle gekonnt zu. Wenn man aufgrund der französischen Sprache auch nicht alles versteht, so sprechen doch Mimik, Gestik und nicht zuletzt die elektronische Texttafel Bände...Andrea Bogner zeigt sowohl als leicht geschürzte Thalie im Prolog wie auch als La Folie in der Oper eine mitreißende Partie, vor allem im Zusammenspiel mit den tanzenden Cowboys des Tanztheaters, Kathrin Gerstenberger stürmt als streng gekleidete Geschäftsführerin des Olymps mit viel aufgestautem Ärger über den windigen Ehemann auf die Bühne und reagiert ihre Wut mit kraftvoller Stimme ab. Dimitry Ivanshenko kommt als aalglatter Schürzenjäger im eleganten Abendanzug daher und erinnert eher an einen leicht läufigen Prinzgemahl als an den Herrn des Olymps (auch bei den Göttern haben die Frauen die Hosen an), und Thora Einarsdottir glänzt vor allem als herrlich verschreckt-spießige Dienerin Clarine, die sich immer auf die falsche Stühle setzt. Sebastian Bollacher mimte im Opernteil mal den Amor, mal den Momus. Das Bühnenbild von Heinz Balthes geizt nicht mit Farbe und anderen Anregungen für das Auge, seien es die üppigen Pflanzen des Sumpfs, der kalte Mond am Himmel oder die antike Tempel-Fassade im letzten Akt, deren Inschrift dem lateinkundigen Zuschauer (DOM SVB INDOC S M MAGDALENAE) einige Rätsel aufgibt. Dem Premierenpublikum hat´s gefallen, der Beifall war kräftig bis begeistert, und vor allem bei Jeffrey Treganza steigerte er sich fast bis zu "standing ovations". So lange hat man das Publikum seit einiger Zeit nicht mehr applaudieren sehen, und sogar für die Regie fiel gegen alle Gewohnheiten kein einziges "Buh". John Dew und sein Ensemble vernahmen es mit Freude und dürften den Abend mit Recht als Erfolg gefeiert haben. |