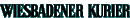|
Nur ein kurzes Glück: George Gershwins "Porgy and Bess" in der Frankfurter Alten Oper Immerhin, es geht auch heute noch einigen Zuschauern so. Wenn der tapfere Porgy am Ende singt "Oh Lawd, I'm on my way, I'm on my way to a Heavenly Lan'", muß manch einer eine Träne zerdrücken ob der unverbrüchlichen Liebe des behinderten Porgy zu der wankelmütigen Bess, die das brave Hauskleid aus-, das rote Satinfähnchen wieder angezogen hat und, gefügig gemacht durch den Stoff, aus dem die Träume sind, dem Dealer Sportin' Life nach New York folgte. Doch Porgy bricht auf, sie zu suchen: Kein Happy End für das tragische Traumpaar, dem nur ein kurzes Glück beschieden ist. Bald 70 Jahre ist es her, daß George Gershwins American Folk Opera "Porgy and Bess" ihre Uraufführung erlebte. Zum ersten Mal wurden in einer Partitur klassische Strukturen derart mit Gospel, Jazz, Blues verwoben - eine Mischung, die auch heute noch in Staunen versetzt, zumal sie den Sängern durch ihre rhythmischen und klanglichen Eskapaden einiges abverlangt. Daß es sich bei "Porgy and Bess" dennoch wirklich um eine Oper handelt und nicht um ein Musical, ist heute ein wenig in Vergessenheit geraten. Und daß "Summertime" ursprünglich nicht so klingt wie bei Billie Holiday oder Ella Fitzgerald, ist wert, wieder einmal ins Gedächtnis gerufen zu werden. Gelegenheit dazu gibt es nun in der Frankfurter Alten Oper, wo bis zum 31.Dezember das New York Harlem Theatre zum zweiten Mal nach dem Jahr 2000 mit seiner Inszenierung von "Porgy and Bess" gastiert. Dort singt zu Beginn des ersten Bildes ein glockenheller Sopran (Janinah Burnett) das legendäre Schlaflied, das in der Oper noch mehrere Male wiederkehrt - auch aus dem Munde von Bess (Marquita Lister), die später, endlich von der Gemeinschaft als Porgys (Alvy Powell) Frau akzeptiert, Claras Kind hütet, als diese und ihr Mann mit den anderen Fischern im Sturm vermißt werden. An schönen Stimmen herrscht in dieser Inszenierung wahrlich kein Mangel: Haupt- wie Nebenrollen, die zum größten Teil alternierend besetzt sind, erzeugen einen Wohlklang, der zuweilen in scharfem Kontrast steht zu dem, was da gesungen wird, von Armut, Leid, Kriminalität, kleinem Glück und den großen Träumen der Bewohner der Catfish Row. Auf musikalische Authentizität legt der Dirigent und Künstlerische Leiter des New York Harlem Theatre, William Barkhymer, ganz offensichtlich größten Wert. In flottem Tempo jagt ein bekannter Song den nächsten, vom süßen Arienton bis zum "dreckigen" Gesang der Straße, wie ihn Sportin' Life (Larry Marshall) oder Maria (Marjorie Wharton) darbieten. Alle Sänger der traditionell nur mit Schwarzen besetzten Oper, haben, neben anderen Opern- und Gesangsengagements, schon zum Teil jahrelange Erfahrung in ihren Rollen. Das sieht und hört man dem Ensemble an, das ebenso souverän spielt und tanzt wie es singt. Daß die schäbigen Häuschen der Catfish Row, die karierten Hemden der Fischer und das Picknick auf der Insel eine historische Wirklichkeit heraufbeschwören, die europäischen Besuchern ein wenig bieder erscheinen könnte, mag der Tatsache geschuldet sein, daß Baayork Lees Inszenierung mittlerweile seit 1993 gespielt wird. Ein wenig frischer Wind könnte nicht schaden. Es muß ja nicht gleich ein Experiment daraus werden. EVA-MARIA MAGEL |
|
Im Rausch VON ANNETTE BECKER
Unerschütterlich sind dagegen die Illusionen des gelähmten Porgy, der an seiner hoffnungslosen Liebe zu Bess auch dann noch festhält, als diese längst ihrem Dealer nach New York gefolgt ist. Wie vor vier Jahren sang ihn der Bariton Alvy Powell. Und wie vor vier Jahren zeichnete er Porgy als sanften Riesen mit genauso großen Gefühlen, die auch noch vorhanden sind, als er einen Menschen getötet hat.
[ document info ] Dokument erstellt am 17.12.2004 um 15:56:40 Uhr Erscheinungsdatum 18.12.2004 |
|
Die Farbe des Schmerzes Von Claudia Arthen Ganz gleich, was Abraham Lincoln im 19. Jahrhundert über die Freiheit und Gleichheit aller Menschen sagte: Die Nachkommen der Negersklaven wurden bis in die 30er Jahre des 20. Jahrhunderts als Menschen dritter Klasse behandelt. Das spiegelte sich auch auf der Bühne und im Film wider. Wenn schwarze Darsteller auftraten, spielten sie augenrollende Idioten oder eben Sklaven; war’s eine Hauptrolle, schminkte sich einfach ein Weißer "auf schwarz". Anders bei Gershwin. Der Komponist, der damals schon der Darling des Broadway, der Meister glitzernder Revuen und eleganter Musicals war, komponierte 1935 eine ernste "American Folk Opera" nur über Schwarze und mit Schwarzen – sehr zur Verwirrung des damaligen Premierenpublikums und der Kritiker. Das Stück nach dem Roman-Bestseller "Porgy" von DuBose Heyward spielt in den schwarzen Slums von Catfish Row in South Carolina, wo rasch und brutal getötet und gestorben wird und die Musik nicht nach Wagner oder Puccini klingt, sondern nach amerikanischem Folk, Show-Schlager und Spirituals. Regisseurin Baayork Lee hat das Spektakel in ein buntes, gleichwohl intimes Musikdrama von bestechender Wirkung übersetzt. Kein Massenereignis, sondern eine anrührende und schnörkellos-geradlinig erzählte Geschichte von fröhlicher Armut und bitterer Melancholie. Die Zuschauer können mit den Figuren fühlen, die in den schlichten Holzbaracken leben: mit dem Krüppel Porgy und der bei ihm Unterschlupf findenden Bess, die zwischen den Versuchungen und Versprechungen des Gauners und Dealers Sporting Life, den brutalen Liebeseinforderungen ihres Ex-Liebhabers Crown und der ehrlichen Zuneigung des Bettlers Porgy aufgerieben wird. Sie können auch mit den unzähligen anderen Figuren empfinden, ihren oft nur kleinen, unscheinbaren Episoden und Geschichten, aus denen Gershwin seine im wahrsten Sinne des Wortes farbige Oper zusammengesetzt hat. Natürlich liegt das vor allem an dem Spiel der Interpreten und an der glänzenden Leistung der Sänger. Allen voran der Darsteller des Porgy: Alvy Powell, der den gesamten Abend auf Knien absolviert, und seiner Rolle mit warmem, dunkeltönigem Bariton ein starkes, sensibles Profil gibt. Gleiches gilt für die Sopranistin Marquita Lister, die Bess mit emphatischer Leidenschaft verkörpert. "Fischersfrau" Janinah Burnett singt ihr Kind mit dem Wiegenlied "Summertime" anrührend in den Schlaf, und Monique McDonald trumpft als Serena mit überzeugendem Opernstimmen-Format auf. Das brillant geführte Orchester tut sein Übriges; Dirigent William Barkhymer reizt alle Möglichkeiten der ungemein farbigen Instrumentation aus und sorgt für große atmosphärische Dichte. Der Chor aus mehr als 50 Mitwirkenden des New York Harlem Theatre entfaltet seine ganze Stimmgewalt – vor allem in den Gospel-Songs, deren visionäre Kraft zum Vorschein kommt. Eine effektvolle, keineswegs reißerische Darbietung. Oder, um es mit den Worten des italienischen Jazzchronisten Arrigo Polillo zu sagen: "Die schönste Huldigung eines weißen Musikers an die Kultur der amerikanischen Neger". |
|
Foto: Alte Oper Mama mit Meerschaumpfeife Von Ines Steiger Ein Sommerabend in der legendären Catfish Row. Fischer in jeansblauen Latzhosen treffen sich zum Würfelspiel, eine füllige Mama im bunt geblümten Kleid und mit bierdeckelgroßen Ohrringen zieht an ihrer Meerschaumpfeife. Eine junge Frau drückt ihr Baby an sich und singt ihm das Schlaflied "Summertime..." Vor einer malerischen Kulisse, die fast ein wenig verstaubt wirkt, weil sie so altmodisch ist, präsentiert das New Yorker Harlem Theater derzeit den Klassiker "Porgy and Bess" an der Frankfurter Alten Oper. Ein glänzendes Orchester, große Solisten und ein Chor, der dadurch beeindruckt, dass jeder seiner Mitglieder in seiner Rolle von Anfang bis Ende ganz aufzugehen scheint, bieten eine überzeugende Ensemble-Leistung. Die Liebe zwischen dem verkrüppelten Porgy und der ebenso schönen wie leichtlebigen Bess steht im Mittelpunkt der Oper, die in den 40er Jahren in den USA ihren Durchbruch erlebte und das Schicksal der afro-amerikanischen Bevölkerung in das Gewand eines mitreißenden Musicals kleidet. 1935 wurde das von George und Ira Gershwin komponierte Werk, das heute nur mit schwarzen Darstellern aufgeführt werden darf, mit zunächst nur mäßigem Erfolg uraufgeführt. Die Filmversion kam Anfang der sechziger Jahre mit Sidney Poitier, Dorothy Dandridge und Sammy Davis Jr.. Die flotte Mischung aus Opern-, Jazz- und Spiritualklängen begeisterte damals eine ganze Generation. Der amerikanische Bürgerrechtler King hatte seine berühmte Rede gegen den Rassenhass noch nicht gehalten. Schulkinder in Alabama durften die für Weiße reservierten Plätze im Bus unter Strafandrohung nicht benutzen. Die Inszenierung von "Porgy and Bess", die nun unter der Regie von Baayork Lee in Begleitung des Orchesters unter dem Dirigenten William Barkhymer in Frankfurt zu sehen ist, weckt Erinnerungen an jenen Film, der eine ganze Generation rührte, auch weil er die Situation der Schwarzen in den USA romantisierte. Wenn Alvy Powell als Porgy seiner Stimme jene unerhörte Zärtlichkeit verleiht und Bess (äußerst kraftvoll und geschmeidig: Marquita Lister) in seinen Armen wiegt, scheint die Zeit still zu stehen. Im Publikum werden Taschentücher gezückt. "Mornig time and evening time..." perlt Bess zum Beweis, dass ihr Lied eine Liebe für immer verspricht. |
|
Große Geste fürs Gefühl Von Shirin Sojitrawalla In der Catfish Row ist alles beim Alten: Das Leben ist einfach, die Fische springen, die Baumwolle blüht. Sommerzeit. Nach getaner Arbeit tummeln sich die Bewohner des berüchtigten Viertels unter freiem Himmel, und bei einem ihrer Gelage kommt es zu einem Mord. Die sommerfrische Idylle ist erst einmal dahin, und die Handlung von Gershwins Volksoper "Porgy and Bess" kommt in Gang. In der Inszenierung des New York Harlem Theatre sieht alles so aus wie wohl auch schon vor siebzig Jahren: Am 30. September 1935 wurde die Oper, manch einer bezeichnet sie als eigenwilligste der Vereinigten Staaten, in Boston uraufgeführt. In der Alten Oper öffnet sich der Vorhang, und die Zuschauer sind sogleich mittendrin: in der Catfish Row (Bühne: Michael Scott). Unwirtliche Behausungen zu beiden Seiten, im Hintergrund der Hafen. Gleich links wohnt Porgy, der verkrüppelte Titelheld und gutmütige Nachbar, der sich rettungslos in Bess verlieben wird. Alvy Powell gibt den wuchtig Liebenden, der auf einem Rollbrett sein Dasein fristet. Sein kraftvoller Bariton, aber auch sein Spiel mit den begrenzten Möglichkeiten seiner Rolle meistert er souverän. Bess ist der heiße Feger des Viertels, ihr rotes Kleid flattert in der Luft wie ein uneingelöstes Versprechen. Marquita Lister verkörpert sie in Frankfurt, und insbesondere in ihren Duetten mit Porgy gelingen ihr anrührende Momente. Sehr viel präsenter aber erscheint Monique McDonald in der Rolle der Serena, die mit stimmgewaltiger Zärtlichkeit um ihren ermordeten Mann trauert. Ansonsten werden große Gefühle an diesem Abend gerne mit großen Gesten umgesetzt. Wo die Guten und wo die Bösen stehen, scheint ohnehin keine Frage in dieser Oper, die auf dem Roman "Porgy" von DuBose Heyward basiert. Das Libretto schrieben das Ehepaar Heyward und der Bruder des Komponisten, Ira Gershwin. "Porgy and Bess" ist dabei eine geradezu klassische Liebesgeschichte, was schon miteinschließt, dass sie nicht gut endet. Dennoch schöpft die Oper auch aus ihrem fehlenden Happy End eine Kraft, die sich im hoffnungsvollen "Oh Lawd, I`m on my way" kraftvoll entlädt. Unter dem energisch wie bedachten Dirigat von William Barkhymer zeigt sich das Orchester gut aufgelegt. Gershwin hat mit seinen Melodien für Millionen einen Nerv getroffen, der die Zeiten überdauert. Dabei liegen die Stärken des Abends in Frankfurt zweifellos im Musikalischen: hervorragende Solisten, darunter auch Larry Marshall, der Sportin´ Life in all seiner geschmeidigen Grausamkeit eindrucksvoll Gestalt verleiht, sowie ein stimmgewaltiger Chor. Die Inszenierung indes ist höchstens von nostalgischem Wert. Zu bieder, bis in die seltsam ideenlosen Choreografien hinein, setzt Baayork Lee die Oper in neun Bildern um. Die Exotik der fremden Welt stockt in dekorativer Folklore. Dabei geht an diesem Abend alles genauso vonstatten, wie man es erwarten durfte. Überraschungen? Fehlanzeige. Aber vielleicht liegt hierin ja auch genau der (Retro-)Charme dieser Inszenierung. Der stürmische Schlussapplaus in Frankfurt spricht jedenfalls sehr dafür. |


 Es ist völlig egal, ob Michael Scotts Bühnenbild der Catfish Row am Hafen von Charleston etwas plakativ und klischeehaft geraten ist. Es ist auch egal, ob es sich mit Christina Gianninis Kostümen möglicherweise ähnlich verhält oder ob Baayork Lees mehr illustrierende als interpretierende Inszenierung einen Hang zum Postkartenhaften hat. Fakt ist, dass das New York Harlem Theatre unter der künstlerischen Leitung von William Barkhymer auf seiner internationalen Tournee mit George Gershwins Oper Porgy and Bess wieder ein genauso exzellentes Ensemble nach Frankfurt in die Alte Oper bringt wie vor vier Jahren. Das beginnt bei den ersten Tönen. Und hört gut zweieinhalb Stunden lang nicht auf.
Es ist völlig egal, ob Michael Scotts Bühnenbild der Catfish Row am Hafen von Charleston etwas plakativ und klischeehaft geraten ist. Es ist auch egal, ob es sich mit Christina Gianninis Kostümen möglicherweise ähnlich verhält oder ob Baayork Lees mehr illustrierende als interpretierende Inszenierung einen Hang zum Postkartenhaften hat. Fakt ist, dass das New York Harlem Theatre unter der künstlerischen Leitung von William Barkhymer auf seiner internationalen Tournee mit George Gershwins Oper Porgy and Bess wieder ein genauso exzellentes Ensemble nach Frankfurt in die Alte Oper bringt wie vor vier Jahren. Das beginnt bei den ersten Tönen. Und hört gut zweieinhalb Stunden lang nicht auf. Einen handtuchschmalen Orchestergraben hat man vor der Bühne abgesenkt. Darin drängen sich die Streicher links, Bläser und Schlagwerk rechts, aufgereiht wie Kinder, die Eisenbahn spielen. Ein Kinderspiel ist es aber nicht gerade, was Porgy and Bess auch von den Musizierenden neun Bilder lang verlangt, und das ohne nennenswerte Atempausen. Bereits der Xylophon-Einsatz in der "Introduction" ist eine waschechte Probespielstelle. Auf den ersten Blick schaut das Ganze aus wie harmlose Vier-Viertel- und Zwei-Viertel-Takte voller gleichmäßiger Sechzehntel. Aber die Melodie ist nicht nur rasend schnell, sondern derartig gespickt mit aufmüpfigen Akzenten, dass das Metrum sich völlig auflöst. So wie Bess im Kokainrausch.
Einen handtuchschmalen Orchestergraben hat man vor der Bühne abgesenkt. Darin drängen sich die Streicher links, Bläser und Schlagwerk rechts, aufgereiht wie Kinder, die Eisenbahn spielen. Ein Kinderspiel ist es aber nicht gerade, was Porgy and Bess auch von den Musizierenden neun Bilder lang verlangt, und das ohne nennenswerte Atempausen. Bereits der Xylophon-Einsatz in der "Introduction" ist eine waschechte Probespielstelle. Auf den ersten Blick schaut das Ganze aus wie harmlose Vier-Viertel- und Zwei-Viertel-Takte voller gleichmäßiger Sechzehntel. Aber die Melodie ist nicht nur rasend schnell, sondern derartig gespickt mit aufmüpfigen Akzenten, dass das Metrum sich völlig auflöst. So wie Bess im Kokainrausch. Genauso groß wie die Gefühle sind auch die Stimmen der Sängerinnen und Sänger, gemäß der Vorschrift Gershwins alle schwarz. Und so kommen Klangnuancen ins Spiel, die man bei Weißen vergeblich sucht. So hart und metallisch kann Bess (Marquita Lister) klingen, so samtig Serena (Monique McDonald), so innig Clara (Janinah Burnett) nicht nur bei Summertime, und so phänomenal kehlig bis schrill die üppige Maria, grandios besetzt mit Marjorie Wharton, die die Rolle unter anderem an der New Yorker Metropolitan Opera sang und auch vor vier Jahren in Frankfurt zu erleben war. Crown (Cedric Cannon) ist ein gebührend unangenehmes Großmaul, Sportin' Life (Larry Marshall) gebührend ölig bis zynisch, und auch die kleineren Rollen sowie der Chor überzeugen durchgängig. Unbedingt anhören.
Genauso groß wie die Gefühle sind auch die Stimmen der Sängerinnen und Sänger, gemäß der Vorschrift Gershwins alle schwarz. Und so kommen Klangnuancen ins Spiel, die man bei Weißen vergeblich sucht. So hart und metallisch kann Bess (Marquita Lister) klingen, so samtig Serena (Monique McDonald), so innig Clara (Janinah Burnett) nicht nur bei Summertime, und so phänomenal kehlig bis schrill die üppige Maria, grandios besetzt mit Marjorie Wharton, die die Rolle unter anderem an der New Yorker Metropolitan Opera sang und auch vor vier Jahren in Frankfurt zu erleben war. Crown (Cedric Cannon) ist ein gebührend unangenehmes Großmaul, Sportin' Life (Larry Marshall) gebührend ölig bis zynisch, und auch die kleineren Rollen sowie der Chor überzeugen durchgängig. Unbedingt anhören.