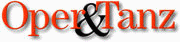|
OPER Vermonsterung Von Anja Hirsch MÜNSTER. Münster, Schauplatz der Täuferbewegung, hebt ein opulentes Werk auf die Bühne: Die Neuinszenierung der Oper "Der Prophet" von Giacomo Meyerbeer, die 18 Jahre von den Bühnen Deutschlands verschwunden war, ist auch ein musikwissenschaftliches Ereignis. Seit Gründung des Meyerbeer-Instituts werden Quellen verglichen, um die Bühnenwerke des im 19. Jahrhundert meistgespielten Opernkomponisten in einer werkkritischen Edition zugänglich zu machen. Das stand an; Material war nur brüchig vorhanden, und auch Meyerbeer selbst griff noch während der Proben in seine Urfassung ein.Man kennt die eisernen Körbe an der Lambertikirche, in denen 1536 die gefolterten toten Leiber der drei Wiedertäufer-Führer aufgehängt wurden. Einer von ihnen, Johann von Leyden, steht im Mittelpunkt von Meyerbeers 1849 uraufgeführter Oper (in französischer Sprache mit Untertiteln). Meyerbeer verquickt den historischen Stoff mit der dramatischen Ausgestaltung einer Mutter-Sohn-Beziehung. Jean de Leyde ist verliebt in die Leibeigene Berthè. Deren Gutsherr verweigert den Freischein zur Heirat und erpresst Jean, der sich für die Mutter und gegen Berthe entscheidet. Wiedertäuferkönig als Zauderer Aus persönlicher Rache, weniger aus politischer Motivation, lässt sich Jean für die Sache der Wiedertäufer einkaufen und krönen. Der Preis ist die Mutter, die er verleugnen muss. Jeans Blutmoral wird ihm selbst unheimlich. Im Kerker versöhnt er sich mit der Mutter. Berthè dagegen begeht angesichts der Vermonsterung ihres Geliebten Selbstmord. In den Tod folgen ihr vereint die Mutter und Jean, der Täufer wie Gegner in die Luft sprengt. Meyerbeers Sicht auf die Täuferbewegung fokussiert den Fanatismus aller Gruppen und leitet ihn erstaunlich modern ödipal ab. Der Psychologismus seiner Figuren spiegelt sich in einer ausgefeilten Leitmotivtechnik. Dass seine Massenszenen schwer umsetzbar schienen, tangiert Münster kaum: Wolfgang Quetes (Regie) blendet sie aus, wo es die Partitur zulässt - so in der Krönungsszene. Jean erscheint hier als Zauderer, geblendet und verstört vom ihn jagendem Scheinwerferlicht. Daniel Magdal meistert seine anspruchsvolle und dauernde Titelpartie, erschöpft nicht und strahlt, wo er am meisten gefordert ist. Nicht an Charisma liegt ihm, eher an den subtilen Tönen, die den Wankelmut seines Charakters betonen; suggestiv seine Traumerzählung, ein gehaltenes Pianissimo, dem er ein Forte quasi als Selbstvergewisserung entgegensetzt. Betörend ihm zur Seite steht Suzanne McLeod; warm fließend, klagend, aufgeregt, aber immer mit einer urgewissen Ruhe gestaltet sie den schwierigen Part der Mutter. Zurückhaltend, aber flexibel und wendig singt Carmen Acosta die Berthè, eine Partie, die große Intervallsprünge verlangt; anspruchsvoll in der Intonation ihr Duett mit der Mutter Fidès. Überzeugend ist auch das Trio der Wiedertäufer, schaurig der wiederkehrende Choral und ihr Auftreten: Schlicht, trotzdem mächtig erscheinen sie in langen schwarzen Mänteln, großen Hüten, langen Zöpfen, in den oberen drei Türen einer zweistöckigen mauerartigen Kulisse (Bühne: Heinz Balthes), überzeugen schnell und bewaffnen die Masse mit Steinen. Meyerbeer ist ein Instrumentationsgenie, und man lauscht ergeben, wenn immer wieder ein Dialog zwischen Stimme und Instrument sich ergibt. Unter der Leitung von Ivan Törzs werden Feinheiten hörbar, zwingend gestalten sie den Stoff, und da sieht man über wenige Ungereimtheiten im großen Duktus hinweg. Nur die Gesten bleiben vorhersehbar. Weniger Theater, vor allem die Musik steht hier im Vordergrund. Münster zollt seiner Geschichte und einem besonderen Kapitel der Musikgeschichte alle Ehre. © Westfälischer Anzeiger Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG |
|
Meyerbeers „Prophet" in Münster
Münster steuert auf eines seiner Stadtjubiläen zu, für die es – der Quellenlage sei Dank – im Früh- und Hochmittelalter manchen Termin gibt, an den sich anknüpfen lässt. Ein Vorschlag, der den Städtischen Bühnen schon vor 25 Jahren unterbreitet wurde, kam nun zur Ausführung: Giacomo Meyerbeers „Le prophète" am „Originalschauplatz". Die exemplarische Grand opéra von 1849 thematisierte Episoden aus Münsters Stadtgeschichte (1534/35): die Erhebung des „Täufers" Johann Bockelson zum König eines „neuen Jerusalem" und das grausame Ende dieser „Herrschaft von Gottes Gnaden". Nachdem es bereits vor elf Jahren mit der Uraufführung von Azio Corghis Oper „Divara" eine der konfliktreichsten Phasen der regionalen Geschichte ins Visier genommen hatte, stellte sich das Theater in Westfalen jetzt der besonderen Herausforderung Meyerbeers. Damit das Stück überhaupt in einem in Münster realisierbaren und rezipierbaren Rahmen aufgeführt werden konnte, wurden nicht nur die wichtigsten editorischen Novitäten in die neue Werk-Fassung integriert, sondern im Gegenzug auch wieder kräftige Striche gemacht. Die chemisch keineswegs reine Sozialutopie, deren Initiatoren der Librettist Eugène Scribe wie der Komponist Meyerbeer ein entschiedenes Engagement gegen Bauernarmut und Fürstenwillkür zubilligten, erscheint so in etwas verändertem Licht. Gegenüber dem umfunktionierten Historien-Drama „Le prophète", das John Dew 1986 in Bielefeld als aktuell sektenkritisches Kammerspiel zeigte und das Hans Neuenfels 1998 an der Wiener Staatsoper zu einer psychoanalytischen Studie degenerierte, wahrt die Inszenierung die Balance zwischen den verschiedenen Komponenten, die in dieser Grand opéra zusammentreffen – auch wenn die Wahl der Bildebene alles andere als unanfechtbar erscheint. Wolfgang Quetes, neuer Generalintendant in Münster, ließ Heinz Balthes einen Bühnenraum bauen, der an den Eingangsbereich des nahe gelegenen Theater-Parkhauses erinnert: Ein aufgeschnittenes Oktogon – Beton-Architektur mit einem Stück Treppe, die in tiefes Blau getaucht wurde. Es ist dasselbe Blau, das Berthès Kleid schmückt und so die Braut des Schankwirts Johann von Leyden, der in die Funktion des Propheten gedrängt wird, optisch aus dem Aufmarsch der armen Leute heraushebt. Und die muten an, als entstammten sie – nicht anders als die Bewaffneten der verschiedenen politischen Gruppierungen – einem Sozialdrama Gerhart Hauptmanns. Durch Drehungen wird der Wechsel der Schauplätze angedeutet: Von der Zwingburg des Grafen Oberthal geht es so kräftig blau in die Kneipe zu Leyden (die einst sicher nicht so weiträumig war), weiter in verschiedene Unterstände bei der Belagerung Münsters durch die eigentlich pazifistischen „Täufer" und hinein in die blauäugige Stadt, in der sich Johann nicht nur zum geistlichen Führer, sondern auch zum weltlichen Herrscher aufschwingt. Der Machtappetit kommt mit dem Essen – und sehr umsichtig verfährt Regisseur Quetes, der die Elemente der Historie gradlinig, ohne Brechung „erzählt", auch mit den eingelagerten und an zentrale Stelle rückenden persönlichen Konflikten: den der Berthè mit dem Grafen Oberthal – Carmen Acosta sticht in dieser Partie positiv hervor – und den Konflikten um und mit der Mutter Fidès, der Suzanne McLeod als vom (falschen) Propheten nicht minder verratene Frau eine ergreifende Stimme verleiht. Ivan Törzs sorgt mit dem Sinfonie-Orchester Münster für einen stimmigen Rahmen, in dem die Glanzlichter der Klarinetten-Soli und der Trompeten-Signale aufblitzen, die dunkle Färbung der Partitur des Skeptikers Meyerbeer aber hinreichend deutlich wird. Hohe Anerkennung verdient die Ausführung der anspruchsvollen großen Chorpartien durch das bemerkenswert leistungsfähige Kollektiv sowie den Extra-Chor, auch wenn die Choristen bei der szenischen Gestaltung ihrer Auftritte von ihrem neuen Dienstherrn und Regisseur im Stich gelassen wurden; sie kamen und standen wie bestellt und nicht abgeholt. Das Terzett der Täufer, die religiösen Fanatismus mit Selbstverwirklichungsabsichten paaren, macht seine böse Sache ebenfalls glänzend. Allein die beiden männlichen Protagonisten – Graf Oberthal und Prophet Johann – mag man sich von stimmkompetenteren Sängern besetzt wünschen. Dass und wie letzterer ein Muttersöhnchen gewesen sein mag, zeigt die Inszenierung deutlich. Und sie schlägt schließlich den Bogen zum großen Vernichtungswerk eines anderen Kleinbürgers und Diktators: Bilder des im Zweiten Weltkrieg zerbombten Münster krönen das letzte Finale auf geschichtslehrsame Weise. Frieder Reininghaus |