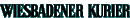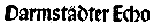|
THEATER "Siegfried" bringe den Mythos "dem Publikum im Spiel, wie einem Kinde ein Märchen", bei, schrieb Richard Wagner am 10.Mai 1851 an seinen Dresdner Freund Theodor Uhlig. "Alles prägt sich durch scharfe sinnliche Eindrücke plastisch ein, alles wird verstanden." Damals war er mit Konzeption und erster Prosaskizze zum zweiten Tag seines Bühnenfestspiels beschäftigt. Am 23.Februar 1869, beim Abschluß der Partiturreinschrift des zweiten Akts, teilte er König Ludwig II. mit: "Das ist keine Familienkinderszene: das Schicksal der Welt hängt von dieser göttlichen Einfalt und Einzigkeit des furchtlosen Einzigen ab." Damit ist eigentlich schon (fast) alles zu John Dews Wiesbadener "Ring"-Inszenierung gesagt, die jetzt bei "Siegfried" angelangt ist. Wie bei "Rheingold" und "Walküre" zielt Dew auf einen psychologisierenden poetischen Realismus ab, diesmal werkgerecht mit betonten Märchenzügen. Psychologie und Realismus treffen sich in Mimes Männerwirtschaft: Den Haushalt hat der Zwerg mit der Bravour eines Küchenballettmeisters in Kopf und Körper. Daß er seinem Ziehsohn Siegfried Vater und Mutter zugleich ist, glaubt man ihm schon ohne den Blick auf die Konturen eines nackten Frauenkörpers, die ihm der Kostümbildner Jose-Manuel Vazquez auf die Schürze appliziert hat. Zugleich läßt Gilles Ragon, den Wiesbadenern als Rameaus brillante Platee wohlbekannt, in pointierter Stimme, Diktion und Gestik den neidisch deformierten Intellekt des Schmieds Amok laufen. Gerade in "Siegfried" häufen sich schwer lösbare Regieaufgaben. Mit dem "Wurm" Fafner (Christoph Stephinger) kam Dew plausibel zurecht: Ein Scheinwerfer hoch oben an der Bühnenwand symbolisierte die Augen des aus dem Schlaf Gerüttelten. Dann preschte er auf einem Panzer durch eine Mauer - zwar längst ein Regieklischee, hier aber sinnvoll als plastisches Bild für die alles niederwalzende Gewalt in wurmartigem Kriechen auf Kettengliedern. Fast noch schwieriger zu bewältigen ist die ins Unendliche gedehnte Annäherung Siegfrieds und seiner Tante Brünnhilde in der Waberlohe, hier einleuchtend als Lichterspiel auf bewegtem rotem Vorhang (Bühnenbild Peter Schulz, Licht Max Karbe). Dew konnte sich hier wie während des ganzen fünfstündigen Dreiakters auf seine mimisch-gestisch differenzierte Kunst der Personenführung verlassen, aber auch auf ein grandioses Sängerpaar. Barbara Schneider-Hofstetter stattete die Wotans-Tochter mit einer Fülle glühender Farben aus. Alfons Eberz, seit dieser Saison Wiesbadener Ensemblemitglied, lief in diesem ewigen Augenblick des "Verweile doch, du bist so schön" zur Hochform des heldentenoralen Strahlemanns als Neo-Hippie auf. Die übrigen Sänger, bis hin zu Thora Einarsdottirs markantem Waldvogel und Carlo Hartmanns Alberich, hielten dieses Niveau. Ralf Lukas war ein stimmlich wie darstellerisch majestätischer Wanderer Wotan, der Kern des Bären, mit dem Siegfried im ersten Akt seinen Adoptivvater erschreckt. Marina Prudenskaja strahlte auch als ratlose Erda in unappetitlicher Verkleidung als fette Fruchtbarkeitsgöttin noch die Würde ihres profunden Alts aus. Fast noch erstaunlicher war die Orchesterleistung. Der neue Generalmusikdirektor Marc Piollet stieg hellhörig und gestisch prägnant in den "Ring" ein. So kammermusikalisch durchhörbar bis in feine Stimmen- und Farbenpartikeln, so körperhaft ausmodelliert und sängerfreundlich trotz wuchtiger, doch nie massiver Tutti, so schlüssig im dynamischen Auf- und Abbau war das Hessische Staatsorchester bisher kaum je zu vernehmen. Für so viel Glanz erntete es beim Premierenpublikum den verdienten Applaus, ebenso wie die Sänger. Das Regieteam dagegen wurde auch heftig mit Buhs bedacht - warum? John Dew, einst Rebell des Regietheaters, machte auch in seinem Programmheftbeitrag keinen Hehl aus seiner nunmehr gezähmten Sicht: "Revolution war noch nie eine Frage guten Benehmens, dennoch ist zu bezweifeln, ob dies wirklich der Weg ist, auf dem die Menschheit sich weiterentwickeln kann." Seine Wende zu durchdachter Konvention kann doch gerade das Wiesbadener Publikum nicht belästigt haben. Und innerhalb der Konvention war das Niveau der Inszenierung aller Ehren wert. ELLEN KOHLHAAS |
|
Selbstfindung eines Hippies VON STEFAN SCHICKHAUS Er ist einer, der das Fürchten wohl nicht gelernt hat. War bis vor einigen Jahren noch allein als Barocksänger bekannt, wurde nach seiner Wiesbadener Platée-Titelrolle als hoher Tenor gepriesen, wie ihn speziell der französische Barock verlangt. Und jetzt singt er Wagner: Gilles Ragon. Sein Debüt als Schmied Mime bei der Premiere von Richard Wagners Siegfried am Staatstheater Wiesbaden gelang geradezu spektakulär. Eigentlich ist es ja Mimes Ziehsohn Jung-Siegfried, der der Furchtlose ist, und Siegfried-Darsteller Alfons Eberz zeigte auch eine mehr als tapfere Leistung. Doch dem Franzosen Ragon gelang der große Coup: So markant war sein Auftreten, so hell und klar sein Tenor, und vor allem so unglaublich präzise. Wo sich andere Wagner-Sänger rhythmisch gerne großzügig zeigen, blieb er stets so akkurat und punktgenau wie seine Schläge auf den Amboss. Überhaupt war diese Wiesbadener Ring-Fortsetzung außerordentlich kompetent besetzt, der Wagner-Neuling mit der Barocklaufbahn stand qualitativ nicht allein. Sein Tenor-Kollege Alfons Eberz, der in der Walküre im vergangenen Jahr den Siegmund noch im strahlend-harten Heldenton gesungen hatte, fokussierte hier nun mehr das Lyrische - eine positive Entwicklung des neuen Wiesbadener Ensemblemitglieds, das ihm dennoch einige wenige Buh-Rufe einbrachte. Konstitutionell zeigte sich Eberz dieser Extrempartie jederzeit gewachsen, Ermüdungserscheinungen waren kaum erkennbar. Alleine das schon eine Leistung. Barbara Schneider-Hofstetter gab wie im vergangenen Jahr eine superbe Brünhilde, Ralf Lukas einen Wanderer der eleganten Art, keine Defizite auch in den weiteren Rollen. Interessant im Vergleich mit den bereits vorgestellten Teilen der Ring-Tetralogie, die noch der frühere Wiesbadener GMD Toshiyuki Kamioka dirigierte, die Orchesterleistung: Der neue Mann am Pult dort, Marc Piollet, ist von Kamiokas beherztem, straffem Zugriff zwar gar nicht weit entfernt, doch hat er dazu das Orchester bereits wesentlich besser in der Hand. Das Hessische Staatsorchester klingt nun kultivierter, die Farben sind klarer definiert, Störgeräusche etwa von Seiten der Blechbläser kommen so gut wie nicht mehr vor. Vor allem der zweite Akt dieses Siegfried schlug, einmal abgesehen von einigen kleinen Waldweben-Irritationen, ein neues Kapitel auf im Wiesbadener Orchestergraben. Die Klampfe und die alte Leier Musikalisch also ein Meisterstück - und die Regie? Für den gesamten Ring des Nibelungen, der 2002 am Wiesbadener Haus seinen Anfang nahm, ist John Dew verantwortlich, und damit ein Regisseur, der sonst immer in den ersten Zeilen einer Premierenbesprechung zu lesen ist, denn Spektakuläres wird von ihm erwartet. Rheingold und Walküre eröffneten den Ring dementsprechend, Siegfried jetzt schloss sich konsequent an. Siegfried ist der Ruhepol in Wagners Tetralogie, das Tempo fährt zurück, und mit ihm auch der üppige Bilderreigen, den John Dew und sein Bühnenbildner Peter Schulz bislang geboten hatten. Dew erzählt die Geschichte stringent und konkret, aber auch etwas zurückhaltend weiter: Siegfried kommt ganz nach dem Vater Siegmund, den John Dew in der Walküre als Pazifisten im selbstgestrickten Pullover gezeigt hatte. Sein unerzogener Sohn, von Mime kaum sozialisiert, wird in Wiesbaden als ein waschechter Hippie auf die Bühne gestellt. An der Klampfe begleitet er des Ziehvaters alte Leier, am Küchentisch liest er die politisch korrekten Superhelden-Comics seiner Generation: Asterix. Aus Nothungs Trümmern vermag dieser Siegfried kein Schwert zu schmieden, es gerät ihm zum Klappmesser. In jeder Ring-Folge vermochten Dew und Schulz bisher mindestens ein Bild von wahrhaft plakativer Kraft zu finden, das sich mit staunen machender Logik in sein Gesamtkonzept einpasst. Im Rheingold etwa war es die Darstellung der Götterburg Walhall als Kernkraftwerk, das Machtzentrum contra naturam sozusagen; in der Walküre dann das 60er-Jahre-Spießerheim Hundings, des KKW-Schutzpolizisten. Hier nun, bei Siegfried, klemmt das Bild ein wenig, jenes einzelne, etwas isolierte Bild, mit dem John Dew am meisten provoziert: der Hippie Siegfried begegnet dem von allen gefürchteten Riesen Fafner, diesem "wilden Wurm", mit Blumen in der Hand - Fafner ist Panzerfahrer, er ist der Böse hinter der Betonmauer des Kalten Kriegs, vor dem alle warnen. Gitarren statt Knarren, mit Blumen gegen Panzer, aber dennoch hat Siegfried sein Klappmesser dabei, er ist ja auch ein Aufgehetzter. Plakativ, konsequent, ja, John Dew bleibt sich treu. Allerdings war Fafner im Rheingold noch ein Bauarbeiter, die gelbe Schutzweste trägt er nun im Panzer, so kleine Brüche hatte der Regisseur bislang geschickt vermieden. Dennoch lief es für Dew, der soeben seine erste Spielzeit als Intendant im Nachbar-Opernhaus in Darmstadt gestartet hat, bestens, ja besser kann es gar nicht kommen für einen, der seinen Ruf als charismatischer Polarisierer zu verteidigen hat: Nach fünf doch überaus gelungenen Stunden Siegfried kamen exakt zur Hälfte Buh-Rufe, zur Hälfte Bravi auf das Realisierungsteam herab. [ document info ] Dokument erstellt am 22.11.2004 um 16:08:53 Uhr Erscheinungsdatum 23.11.2004 |
|
Das rabiate Blumenkind Von Rudolf Jöckle Auch wenn die Szene mit Schlüssigkeit und Pointiertheit, den Witz des "Rheingoldes" zurückeroberte, der in der "Walküre" ziemlich verloren gegangen war: Die bemerkenswerteste Veränderung fand am Pult statt. Erstmals hatte Marc Piollet, Wiesbadens neuer Chefdirigent, die musikalische Leitung. Er überzeugte durch fließende Tempi, die die Bewegung der Bühne aufs schönste unterstützten, dabei die Musik nie instabil werden ließen. Auch die farbliche Differenzierung gefiel, von einigen zu "nahen" Holzbläsern abgesehen. Piollet gab den nötigen dramatischen Antrieb hin zu einer recht lebendigen Darstellung des soliden Orchesters – ein erheblicher Gewinn gegenüber Tokyushi Kamioka. John Dew, inzwischen ja Spielleiter der Darmstädter Oper, inszenierte (nach Egon Voss) den "Siegfried" als "musikalisches Märchen". Das kam nicht zuletzt dem unbefangenen Spiel des 1. Akts zugute: Der doch nicht ganz unsensible und langhaarige Haudrauf Siegfried löst sich von seinem Vater Mime, der ohnehin ganz anders aussieht als er, und will das Fürchten lernen. Nothung wird zum Klappmesser, was später die Brutalität der Morde an Mime und Fafner verstärkt. Herrlich pittoresk gibt sich dagegen das Bühnenbild von Peter Schulz, eine von Gemüsepflanzungen umgebene Waldhütte mit Esse und Küche, sämtlichen Instrumenten, Töpfen und Bierflaschen. Der Bär taucht auf – nur hat sich Wotan im Fell verborgen, die Umtriebigkeit des scheiternden Gottes durchzieht wie ein Leitmotiv die Bilder, vom Finale der Liebenden abgesehen. Hier gibt es nur die wabernden roten Vorhänge aus der "Walküre", hinter denen die metallisch blauen der "seligen Öde" auftauchen. Neidhöhle (2. Akt) ist ein mit Mauern geformter Hof. Aus ihm bricht Fafner mit einem Panzer aus, auf den Siegfried schließlich springt. Die Stimmung des Bildes evoziert in der Tat – und jenseits billiger Aktualität – die Assoziation "Zonengrenze". Dazu passt auch die fast suggestiv abstoßende Pennerfigur des Alberich (Carlo Hartmann mit recht heller Stimme). Und diese Art der Suggestivität erreicht auch Erda, die als eine prähistorische Venus (nachdrücklich singend: Marina Prudenskaja) aus einer Baumhöhle (Weltesche?) sich herauszwängt. Dew hat ein solides Ensemble. Alfons Eberz als Siegfried ist überzeugend im Spiel, als eine Art rabiates Blumenkind (Kostüme: José-Manuel Vazquez) besitzt er viel "glänzendes" Material, hat genügend Atem für das Aussingen der Phrasen, bleibt in der Färbung indes (noch) zu undifferenziert. Gilles Ragon ist ein eminent beweglicher, kauzig-gefährlicher Mime (man muss nur sehen, wie er Gemüse für den "Sudel" schneidet), Ralf Lukas ist ein kraftvoll-sonorer, noch jugendlicher Wanderer. Großartig im Finale Barbara Schneider-Hofstetter als Brünnhilde, in den poetischen Momenten wie in der dramatischen Gestaltung. Viel Zustimmung. |
|
Anarcho mit der Klampfe Von Volker Milch
Von Mime wird Siegfried das Fürchten sicher nicht lernen: Gilles Ragon (links) und Alfons Eberz in John Dews Inszenierung. Kaufhold Eine der großen, das Publikum bewegenden Fragen vor jeder "Siegfried"-Premiere: Wie hält´s der Regisseur mit dem Drachen auf der Opernbühne? Da gibt es so viele Möglichkeiten zwischen dem klassischen, Dampf schnaubenden Zweiflügler und bedrohlich in Bewegung geratendem Industrieschrott, der in Harry Kupfers Bayreuther "Ring" zumindest dem Publikum das Fürchten gelehrt hat. In Wiesbadens Staatstheater nun, wo der dritte Teil von Richard Wagners Tetralogie "Der Ring des Nibelungen" seine gefeierte Premiere hatte, durchbricht der Drache Fafner krachend eine Betonwand - und zeigt sich als ein veritabler Panzer, dessen grüne Scheinwerfer-Augen uns allerdings ironisch zuzublinzeln scheinen wie die ganze Inszenierung: "Nehmt mich nicht allzu ernst, ich bin doch irgendwie auch schon historisch!" Dem jungen Helden Siegfried, einem anarchistischen Hippie mit Klampfe und Stirnband, sind solche Elemente der Distanzierung sicher fremd. Er erlegt den Panzerfahrer mit einem Klappmesser - denn das väterliche Erbe, die Bruchstücke des Schwertes Notung, hat er in Mimes Werkstatt zu einer zeitgemäßeren Waffe umgeschmiedet. Der Tod des Panzerfahrers ist auch so etwas wie ein revolutionärer Sündenfall: Letztlich ist Fafner, dessen Kluft ihn als Werktätigen ausweist, doch nur Kanonenfutter, Opfer der Macht. Betreten bedeckt Siegfried Fafners und Mimes Leichen. Wotans Speer kriegt Siegfried mit dem Messerchen übrigens nicht mehr klein, der muss übers Knie gebrochen werden wie in diesem Fall ein Teil der schönen Symbolik, die Wotans Machtverlust anzeigt. Wir erinnern uns: In der "Walküre" ist Notung am Speer zerbrochen. Seitdem aber ist viel Zeit vergangen, wir befinden uns in der nächsten Generation. Siegfried hat von Siegmund neben dem etwas handfest revolutionären Charakter und den langen Zottelhaaren die schöne, kraftvolle Stimme geerbt: Alfons Eberz, der mit der Partie auch in Willy Deckers Dresdner "Ring" reüssiert, überzeugt mit einer sehr differenzierten Gestaltung, die seine bisherigen Wiesbadener Leistungen in den Schatten stellt: Zur Wucht der Schmiedelieder gesellt sich ein anrührendes Espressivo, das die Sehnsucht nach der Mutter so glaubwürdig werden lässt wie das Erwachen delikater Gefühle am Walküren-Felsen. Das Staatstheater kann sich glücklich schätzen, einen solchen Tenor im Ensemble zu haben. Zu einem wahren Sängerfest trugen aber auch illustre Gäste bei: Ganz erstaunlich das Wagner-Debüt von Gilles Ragon, der in Wiesbaden als Rameaus Sumpfnymphe Platée brillierte und nun mit einem tenoral gestählten, scharf profilierten Mime überraschte. Dass der Franzose mit einem Händchen fürs Komödiantische im tiefen deutschen Wald auch ein paar Konsonanten verschluckte, war dabei zu verkraften. Großes Format zeigten wieder Ralf Lukas als Wanderer (im heruntergekommenen Büro ist die Pracht der Macht nur noch zu erahnen), Carlo Hartmanns Alberich, Christoph Stephingers Fafner, Marina Prudenskajas Erda und die Brünnhilde der Barbara Schneider-Hofstetter. Als brillant zwitschernder Waldvogel flattert Thora Einarsdottir durch den Zuschauerraum. Gegen solche szenische Niedlichkeiten des "heroischen Lustspiels" setzt das Staatsorchester immer wieder den düsteren, heiligen Ernst von Wagners Gruselklängen, die den Hörer buchstäblich an den Ohren in die Tiefen des Waldes ziehen. Marc Piollet, Wiesbadens neuer Generalmusikdirektor, erweist sich hier als mutiger, umsichtiger Pfadfinder, hat das Geschehen im Orchestergraben und auf der Bühne souverän im Griff und fängt Unebenheiten im virtuosen Schlagabtausch des ersten Aufzugs ab. Auffällig unter seiner Leitung ist die Entwicklung der Klangqualität, die sich gegen die problematische Akustik behauptet. Hier bestätigt sich der Eindruck, den schon sein "Rigoletto"-Dirigat hinterlassen hatte: So schöne, weiche, fast ein wenig nostalgisch anmutende Kantilenen der Violinen hat man schon lange nicht mehr gehört. Auch viele vorzügliche Solo-Beiträge zeigen, dass der "Ring" unter Piollets Leitung auf einem guten Weg ist. In John Dews Inszenierung blitzen wieder viele kluge und witzige Details auf: Im Bär, den Siegfried über die Bühne treibt, steckt der omnipräsente Wotan-Wanderer, und zur windschiefen Idylle von Mimes Hütte gehört ein veritabler Gemüsegarten, aus dem sich der Zwerg für sein Süppchen bedient. Als großer konzeptioneller Wurf erweist sich Dews an Déja-vu-Erlebnissen reicher "Ring" indes auch im dritten Teil nicht und will das wohl auch gar nicht sein: Oft hat man den Eindruck, dass der Regisseur ganz bewusst der Musik den Vortritt lässt. Der Feuerzauber etwa beschränkt sich auf bescheidene Lichteffekte und die Illustration aus dem Orchestergraben. Es ist nicht der große Effekt, den Dew mit dem Bühnenbildner Peter Schulz und José-Manuel Vazquez (Kostüme) sucht. Eher hat man den (vom Programmheft bestärkten) Eindruck, dass er sich nach einer verlorenen Naivität vergangener Theaterzeiten zurücksehnt, nach einem Staunen, das im Zeitalter virtueller Realität verloren geht. Die Inszenierung zeigt aber auch immer wieder, dass man für magische Momente im tiefen Wald manchmal nicht mehr braucht als eine Baum-Silhouette und ein paar Taschenlampen. |
|
Der Drache sitzt im Panzer Ring des Nibelungen: Darmstadts Intendant John Dew inszeniert im Großen Haus des Staatstheaters Wiesbaden Richard Wagners „Siegfried" Von Heinz Zietsch WIESBADEN. Was ist Siegfried doch für ein aufmüpfiger, überheblicher und dummer Kerl! Ausgerechnet er soll der Welt ein anderes Gesicht geben? Kaum zu glauben. Außerdem wirkt er wie ein Riesenbaby, das noch nicht den Babyspeck an Kopf und Bauch verloren hat. Siegfried gleicht einem jugendlichen Streuner, vernachlässigt, heruntergekommen, einem Nichtsnutz mit langen Haaren und Stirnband, hineingesteckt (Kostüme: José-Manuel Vazquez) in mit bunten Flicken übersäten Jeans, der jugendbewegt zur Klampfe singt und schon früh dem Alkohol verfallen scheint, derart oft greift er zur Bierflasche in Mimes ärmlicher Behausung, die zugleich als Schmiede dient. Wie kann dieser junge Mann überhaupt das Schwert Notung schmieden, an dem sich schon Mime vergeblich versucht hat? Er kriegt’s nicht hin in John Dews Inszenierung von „Siegfried", dem dritten Teil aus Richard Wagners Tetralogie „Der Ring des Nibelungen". Mit viel Aufwand versucht Siegfried, das von Wotan zerschmetterte Schwert seines Vaters Siegmund wieder herzustellen. Ein Berg kreißt und gebiert am Ende nur ein Mäuslein. Siegfried (Alfons Eberz mit geradlinigem, lang durchhaltenden Tenor) hat kein großes Schwert geschmiedet, sondern nur ein kleines Stilett, das er großmäulig als Notung, das „neidliche" Schwert preist, das jetzt allenfalls nur noch niedlich zu nennen ist. Zähneknirschend nimmt’s der Zuschauer hin. Doch die Ironie, die der Darmstädter Intendant und Regiseur Dew da hineingepackt hat, ergibt durchaus Sinn: Was Siegfried ererbt von seinen Vätern, das kriegt er nicht mehr hin. Sein Ende ist programmiert, auch wenn er mit diesem Dolch den Drachen (Christoph Stephinger) und Mime (Gilles Ragon mit wendiger, gewitzter Stimme) umbringt. Dieser Drache haust hinter einer Mauer, davor sind Panzersperren aufgestellt (Bühnenbild: Peter Schulz). Tatsächlich durchbricht der Drache, auf einem Panzer herausfahrend, diese Mauer. Siegfried besteigt den Panzer mit Blumen in der einen und dem Dolch in der anderen Hand. Und erinnert an die Nelkenrevolution, wenn er sein Blumengebinde an den Panzer heftet. Doch Siegfried meuchelt hinterrücks den Widersacher, bis das Drachenblut fließt. Dew hat die Gestalt des Siegfried kräftig entmythologisiert und an dessen Heldentum gerüttelt. Denn wenn Siegfried Brünnhilde (Barbara Schneider-Hofstetter mit voluminöser Stimme) begegnet, ihr mit dem Stilett den Amazonenanzug aufschlitzt und sie entkleidet am Boden liegen sieht, da packt ihn die Furcht, er kaut ängstlich an seinen Fingerkuppen, greift sich verlegen in seine Haarsträhnen und wünscht sich, bei Muttern zu Hause zu sein. Nein, er ist kein heldischer Draufgänger, eher schüchtern nähert er sich Brünnhilde. Derweil kündet die Musik vom Gegenteil, vom Ausgelassensein des sich wie toll gebärdenden Liebespaares Brünnhilde und Siegfried. Marc Piollet am Dirigentenpult reizt Wagners Partitur in allen ihren Schattierungen energisch und voller Akribie aus. Da entstehen die schillerndsten Farben, die bestens zur raffiniert ausgeleuchteten Bühne (Licht: Max Karbe) passen. Schwärmerisch schwelgt das Orchester in den lyrischen Abschnitten, und kraftvoll durchleuchtet der neue Generalmusikdirektor die modernen Klangbilder, die Wagner bereits hier entwirft und in der „Götterdämmerung" noch steigern wird. Piollet ist ein Gewinn für das Wiesbadener Theater und heimst zu Recht viele Bravos ein. Dew hat den Stoff tüchtig entrümpelt. Doch das hat ihm am Ende der fünfstündigen Aufführung auch Unmutsäußerungen des Publikums eingebracht, so dass bei der Premiere am vergangenen Sonntag im Großen Haus des Staatstheaters Wiesbaden auch einige Buhs sich unter den überwiegend begeisterten Beifall mischten. Dabei hat Dew den kniffligen Stoff geschickt aufgedröselt. Großartig, wie sich Wotan als Wanderer (Ralf Lukas) immer wieder in das Geschehen einmischt, weil er nicht loslassen kann von Macht und Geld. Da ist aber auch noch ein anderer zugegen, wenn Siegfried mit bloßen Händen Wotans Speer zerbricht: Alberich (Carlo Hartmann), ein heruntergekommener, alkoholisierter Clochard, nimmt jene Hälfte mit der Speerspitze an sich. Wenn schon nicht die ganze Macht, so will er sie wenigstens zur Hälfte. Ob ihm das was nützen wird? |
|
Blumenkind am Schrebergartenzaun John Dew setzt seinen Wiesbadener "Ring" mit "Siegfried" fort / Glanzleistung von GMD Marc Piollet
Blick zurück ins Hippie-Zeitalter: Alfons Eberz als Siegfried und Barbara Schneider-Hofstetter als Brünnhilde in John Dews Wiesbadener "Siegfried". Foto: Martin Kaufhold Von Richard Hörnicke Nicht enden wollender Jubel im Großen Haus des Wiesbadener Staatstheaters für die Premiere von Wagners "Siegfried", die zumindest im musikalischen Bereich Bayreuther Maßstäbe erfüllt. Ein Abend der Debüts - der neue Generalmusikdirektor Marc Piollet zum ersten Mal in Wagners "Ring" am Pult, Alfons Eberz in der Partie des Titelhelden, Gilles Ragon, gefeierte Platée in Rameaus gleichnamiger Oper, auf dem Weg vom leichteren Genre in das des Charaktertenors. Zu den Debütanten traten Künstler, die sich bereits in "Rheingold" und "Walküre" bewährten. Schon bei Verdis "Rigoletto" fesselten Nervigkeit und Energie, mit der Piollet der Partitur lebendigen Atem einhauchte, ihr ein sensibles und zugleich vitales Klangspektrum verlieh. Mit dem souveränen Dirigat des "Siegfried" spornte er das Orchester zu Höchstleistungen an, setzte die Linie des einfühlsamen Hineinhorchens und Ausformens musikalischer Strukturen fort, bruchlos und fesselnd wurde die "unendliche Melodie" des "Siegfried" zum exquisiten Hörerlebnis. Man sieht nun der Übernahme des Dirigats der bisherigen beiden Teile der Tetralogie mit besonderer Spannung entgegen. Alfons Eberz war den Anforderungen der kräftezehrenden Partie des Siegfried bewundernswert gewachsen. Mit seiner ebenmäßigen und nie forcierten Stimmführung, dem metallischen Strahl der Spitzentöne ist er eine Idealbesetzung. Erstaunlich, welches packende Format Gilles Ragon der Rolle des Mime verleiht, wie er diesen bösen, "wissenden Zwerg" stimmlich und darstellerisch charakterisiert, auch das eine Glanzleistung. John Dew bleibt in seiner Inszenierung im Bühnenbild von Peter Schulz und in den Kostümen von José-Manuel Vazquez dem mit "Rheingold" und "Walküre" begonnenen und schon erprobten Konzept treu. Er holt das Geschehen in überzeugender Personenführung in die Zeit der sechziger Jahre zurück. Siegfried ist mit lang wallendem Haar und Stirnband ein Blumenkind mit Revoluzzerneigung, Wotan versucht in gutbürgerlicher Kleidung seine schwindende Macht zu retten, Mime bewegt sich in seiner von einem Schrebergarten umgebenen Schmiedewerkstatt zwischen Kühlschrank und Schmelzofen. Der "Drache" durchbricht in Gestalt eines Panzers eine Mauer (die DDR lässt grüßen), vor der sich Alberich mit Bierflasche als heruntergekommener Penner lümmelt. Man sieht, es geht sehr menschlich und manchmal etwas Historie-schwanger in dieser Regieführung zu. Den Mittelpunkt der Szene beherrscht die Weltesche. Nur in der letzten Szene muss sie einem lichtblauen Rundhorizont weichen, in dem sich Brünnhilde und Siegfried ihrer Liebe hingeben. Barbara Schneider-Hofstetter als Brünnhilde, nach dem Erwachen allzu lange dem Boden verhaftet, überzeugt mit leuchtend klarem und sich dramatisch weitendem Sopran. Das Schlussduett mit Eberz wird zu einem musikalischen Höhepunkt. Ralf Lukas versieht die Partie des Wanderers mit schlackenlos strömendem, markantem Bariton, Carlo Hartmann gibt dem Alberich signifikantes Profil, Marina Prudenskaja leiht in füllig aufgeblähter Kostümierung der Erda ihren warmen, ausdrucksvollen Alt. Ein munterer, silbrig singender Waldvogel war Tora Einarsdottir. In den Beifall mischten sich beim Erscheinen des Regieteams einige Buhrufe. |