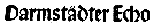|
Händels "Agrippina" in Frankfurt VON HANS-JÜRGEN LINKE Macht könnte etwas sein, was aus einer mythischen Nähe zwischen Mensch und Wolf entstanden ist: Auf dem Vorhang säugt eine Wölfin Romulus und Remus, in der hohen, dunklen Grabkammer dahinter sitzen die handelnden Personen auf Sarkophagen, werden vom Personal nach vorn geschoben, die Oper kann beginnen. Händels Agrippina basiert auf dem fintenreichen Libretto des Klerikers und Politikers Vincenzo Grimani, der die im großen und ganzen historisch verbürgte höfische Geschichte, wie Nero auf den römischen Kaiserthron gelangte, mit einem aktuell satirischen Anliegen verbindet. Koalition der Machtwilligen Dieses quer über die Zeiten gespannte satirische Band rechtfertigt die Idee, den Intrigenstrudel noch ein paar Jahrhunderte weiter in die Gegenwart hinein kreiseln zu lassen. Rom ist in David McVicars Inszenierung eine Art Residenz einer Koalition der Machtwilligen, bevölkert von britischen Armeeuniformen, amerikanischer Offizierskluft und eleganter Abendgarderobe. Thematisch geht es um die enge Verbindung von Macht, Erotik, Sucht, Feigheit, Skrupellosigkeit und strikter Ausbeutung aller Gefühle. Die Macht wird auf der Bühne (John Macfarlane) repräsentiert durch eine hohe, schmale Treppe mit einem Thron oben drauf; den Weg, der zu ihr führt, symbolisiert ein weiblicher Torso auf dem Bühnenprospekt. Titelfigur Agrippina ist die Meisterin der Gefühlsausbeutung; sie macht sich nicht nur vorhandene Gefühle zunutze, sondern lässt sie entstehen, um sie dann zu verwerten; Echtheit, Größe und Energiegehalt der Gefühle sind also unverzichtbar. So weit der ernste Teil. In Wirklichkeit geht es witzig, satirisch, manchmal geradezu heiter zu auf der Bühne. Händels Agrippina ist eine barocke Komödie, die sich gegen die psychischen Zumutungen der Macht mit hoher Kunst wehrt, mit Brillanz, Gelächter, Intelligenz und einer emotional ausdrucksreichen Musik. David McVicars Arbeit für die Oper Frankfurt ist die Neueinstudierung einer Produktion, die im Mai 2000 im Théâtre Royal de la Monnaie in Brüssel Premiere hatte; sie bedurfte bisher keiner intensiven Überarbeitung, und die Frankfurter Besetzung (nur Malena Ernman als Nero wurde aus der Original-Inszenierung übernommen) singt ihre Partien durchweg ausgezeichnet bis überragend und verströmt intensive Spielfreude. Zentrum der soziologischen und psychologischen Analyse der Macht und ihrer Mechanismen, die dieses barocke Stück in Text und Musik unternimmt, ist die Figur der Agrippina; alle anderen sind ihr letztlich ergeben und / oder unterlegen, sogar die einige Jahrzehnte früher ebenfalls zu Opern-Titelfigur-Ehren gelangte Poppea, die hier nur als zweite Siegerin vom Platz gehen darf, mit wesentlich geringer bemessenem Machtbereich. In der brillanten Juanita Lascarro mit ihrem voluminösen, strahlenden, ausdrucksreichen Sopran und ihrer tänzerisch elastischen Präsenz hat die Oper eine angemessene Protagonistin. Anna Ryberg als Poppea kommt lyrischer und mit weicherem Timbre daher, wenngleich ohne jede Sanftheit und mit einer variablen Bühnenpräsenz. Inszenatorisches Kleinod ist eine leicht somnambule Bar-Szene, in der die von Intrigen niedergedrückte Poppea auf den geliebten Ottone trifft; es kommt zu einem Duo Poppeas mit dem Continuospieler am Bar-Hammerklavier, man tanzt Bartänze, ein Headbanger schüttelt die Frisur, die Bargäste begleiten die barocke Musik mit gegenwärtigen Tanzbewegungen und knüpfen so eine feine, zwanglos schwebend-schwingende halbseidene Brücke aus fernen Vergangenheiten in die Gegenwart. Selbstverliebt wie Robbie Williams Zentrum der satirischen Komödie ist der, um den herum Agrippina ihr Intrigengewebe knüpft, dem sie auf den Thron helfen will, um selbst zu herrschen: Nerone. Der spätere kaiserliche Massenmörder ist hier zwar schon völlig moralfrei, aber noch unfertig und linkisch. Malena Ernman präsentiert ihn geradezu perfekt: feige und machtgeil, selbstverliebt wie Robbie Williams, beweglich wie eine ganze Boygroup. Lauernd umschleicht er die symbolische Treppe, traut sich anfangs noch nicht recht hoch, begattet bodenturnerisch eine Treppenstufe und hantiert verschwenderisch mit weißem Schnupfpuder. Malena Ernmans Alt ist von einer entwaffnend reichen, dunkel timbrierten stimmlichen Ausdrucksfähigkeit, ihr Nerone ist eine durch und durch zeitgemäß barocke Figur, von der man gar nicht genug bekommen kann. Die einzige schöne Seele auf der Bühne ist Ottone, den Lawrence Zazzo zurückhaltend, unschuldig und sentimental gibt und mit samtigem, lyrischem Alt versieht. Simon Bailey als tapsig-burschikoser Kaiser Claudio ist ein dominanter, kraftvoller Bariton, das komische Paar am Rande der höfischen Macht, Pallante und Narciso, wird von Soon-Won Kang und Christopher Robson mit komödiantischer Mannschaftsdienlichkeit gegeben. Felice Venanzoni leitet ein reduziertes Museumsorchester mit dynamischer Feinstarbeit und einem wachen Sinn für die überraschenden Klangbilder, die weichen, ausdrucksvollen Linienwerke und prägnanten Parallel- und Synchronführungen zwischen vokalen und instrumentalen Stimmen. Gelegentliche kleinere Abstimmungsprobleme im Tempo, die sich in der Premiere zuweilen hören ließen, werden leicht zu beheben sein. Das Erstaunlichste an dieser Oper ist ihr Schluss-Ensemble, in der das gattungsspezifische, gleichwohl wider alles Erwarten glückliche Ende in einem Ensemble kulminiert, das tatsächlich all das tief gestaffelte Ausdrucksvermögen des Ensembles zusammenführt und aufhebt. Nero ist jetzt auf dem Thron, und eine Inszenierung, die den weiten historischen Bogen stimmiger und leichtfüßiger schlägt als diese, ist schwer vorstellbar. [ document info ] Dokument erstellt am 25.06.2006 um 17:05:34 Uhr Letzte Änderung am 26.06.2006 um 09:59:05 Uhr Erscheinungsdatum 26.06.2006 |
|
Die Mutter des Nero Von Rudolf Jöckle Die Produktion dieses venezianischen, also frühen Händel-Werkes war schon um 2000 in Brüssel zu sehen. Sie wurde allerdings für Frankfurt von Regisseur David McVicar aufs gründlichste neu einstudiert (bei nur zwei der Protagonisten als Gäste). Den staatsmännischen Bericht des Tacitus über Neros Aufstieg zum Kaiser mischt das Grimani-Libretto zu einem verwirrenden Intrigenspiel mit Kaiserin und Nero-Mutter Agrippina als Spinne im Netz, in das sich eine Frau, die brave Poppea, und fünf Männer – Claudio, Ottone, Nerone sowie die tölpelhaften Höflinge Pallante und Narciso als Randfiguren – verfangen. Michael Hampe hatte dieses quid pro quo einst für Köln/Schwetzingen als riesigen rheinischen Spaß („Colonia Agrippina") inszeniert. Und auch McVicar, der die Szene in eine moderne Kostüm-Zeit (britische Uniformen!) verlegt, zieht möglichst viele – und hinreißende – komödiantische Register. Er bleibt freilich zurückhaltender, mischt sich nicht direkt in diese Affäre um Macht und Sex und Liebe ein, sondern beobachtet sie amüsiert mit Distanz: ein Blick voller Einsicht in den ironischen Untergrund des Durcheinanders. Denn am Ende wird Nerone ja wirklich Kaiser, der soldatisch-brave Ottone hat endlich die geliebte Poppea fest an der Hand (er glaubt es wenigstens). Und möglicherweise beginnt der (noch) in halbstarke Motorik verstrickte Nerone (schon in den Bewegungen eine Glanzleistung der jungen Sopranistin Malena Emman, von der Makellosigkeit ihrer Gesangslinie samt halsbrecherischer Koloraturen ganz zu schweigen) zu begreifen, was ihm geschah. Doch verloren hat ohnehin niemand, und niemand wird bestraft. Was für eine wundervolle römische Welt! John McFarlane hat sie mit riesigen dunklen und locker verschiebbaren Säulen (Pfeilern), die heimliche Orte bergen können, geschaffen, von denen sich der helle, goldene Thron (über 20 Stufen ohne Geländer hoch) abhebt. Die pfiffigste Auflösung des Raumes: eine ebenso witzige wie tiefsinnige Barszene mit Poppea, Ottone und dem unwiderstehlichen Blondschopf Nerone. Und mit dem virtuosen Cembalisten Stefano Maria Demicheli (sonst im Continuo). Es sind jedenfalls Räume, in denen sich die Solisten locker und konzentriert bewegen, dazu verstärkt noch eine nicht geringe Statisterie (Chor) mit oft verblüffender tänzerischer Gewandheit die Pointiertheit der Szene. Juanita Lascarro in der Titelpartie pendelt auch stimmlich bravourös-flexibel zwischen Verführung und Machtwillen, eine höchst intelligente Darstellung. Anna Ryberg als Poppea gewinnt dafür, nicht weniger bestechend, etwas komischere, aber auch innigere Töne. Der Countertenor Lawrence Zazzo gibt dem Ottone rollendeckendes Profil, und Simon Bailey hat für den Claudio bis in bei Händel ungewohnte Bassestiefen den großen Atem. Das Rollendeckende auch in der genauen Darstellung gilt zudem für Soon-Won Kong (Pallante), Christopher Robson (Narciso) und Gérard Lavalle (Lesbo). Am Pult steht Felice Venanzoni, der erst spät und nach Paolo Carignanis Absage („Erschöpfung") sein Amt übernahm. Um so eindrucksvoller, wie sicher er das an historischer Klangpraxis ausgerichtete und entsprechend reduzierte (und nur selten unruhige) Orchester lenkt, mit viel Gespür für die Tempi, entschiedene Artikulation der klaren Orchesterstimmen (Bläser!) und rhythmische Prägnanz. Großer Jubel und tatsächlich ein paar Buhs für die Regie. |
|
Barockes Musical aus dem höfischen Intrigantenstadl Händels barocker "Agrippina" an Oper Frankfurt geziemend verjuxt
Intrigen haben zum Saison-Ende an der Oper Frankfurt Hochkonjunktur. Nach Mozarts "La finta semplice" im Bockenheimer Depot erlebte Händels "Agrippina", Neueinstudierung einer Produktion des Théâtre de la Monnaie Brüssel, eine umjubelte Premiere, bei der vereinzelte Buhrufer auf verlorenen Posten standen. Ein schöner Erfolg des schottischen Regisseurs David McVicar, der keine Ehrfurcht vor dem gern als britischen Nationalkomponisten vereinnahmten Sachsen Georg Friedrich Händel kannte und die heitere Satire auf ein Libretto des italienischen Kardinals Vincenzo Grimani in ein handfest erotisches barockes Musical umbog. Seiner Inszenierung, die geflissentlich auf ironische Distanz ging, sangen und spielten nicht nur die Protagonisten dieses höfischen Komödienstadls lustvoll zu, auch die musikalischen Weichen waren in diese Richtung gestellt. Von Paolo Carignanis Assistenten Felice Venanzoni und dem Museumsorchester, dessen Solisten teils auf alten Instrumenten musizierten, die Leitlinien der Gurus historischer Praxis gnadenlos umsetzend: mit Hilfe überlieferter Spieltechniken Barockmusik ins Hier und Heute zu überführen. Venanzoni hatte die Tempi ebenso angeschärft, wie er etwa das Spiel auf leeren Saiten druckvoll vorantrieb oder die vielen Verzierungen in feinen Klangnebel zerstieben ließ. Da gedieh im ausdauernden Dreivierteltakt-Pendelschlag das Menuett zum Triumph-Walzer, emotionale Engpässe bezeugten unerbittliche klangliche Härten, die erotischen Momente besaßen auch instrumentalen Kitzel. Im steten Ritual zwischen den Liebe, Lust und Leid transportierenden Rezitativen und den gefühlvollen wie charakterisierenden Da-capo-Arien - gottlob in angemessener Kürze, was dennoch eine vierstündige Spielzeit ergab - stützte der Dirigent zudem das inspiriert und mit Laute aufspielende Basso Continuo an Cembalo und Orgel. Im Prinzip eine hanebüchene Geschichte aus römischer Kaiserzeit: Agrippina geht über Leichen, um ihren gammeligen Sohn Nerone auf den Thron zu hieven, macht sich die sie umgebenden Menschen - vor allem ihre Gegenspielerin Poppea - zum Werkzeug und hat selbst noch Erfolg, als ihr keineswegs bei einem Sturm umgekommener kaiserlicher Gemahl wieder auftaucht. Der glättet nämlich am Ende wie ein Deus ex machina alle Wogen. Mit dem fatalen Schluss, dass die Hauptintrigantin als edler Mensch dasteht, während ihre Opfer als vermeintliche Bösewichte gebrandmarkt werden - eine echte Satire. McVicar erweist sich als Choreograf unter den Opernregisseuren, der Komik zu strukturieren versteht und permanent seine Duftmarken setzt. So ist auf dem Vorhang jene kapitolinische Wölfin abgebildet, die Roms Gründer Romulus und Remus säugt, wie das Spätwerk eines jungen Wilden anmutend. Zur Halbzeit zeigt sie blutrote Lefzen, am Ende liegt sie wie platt auf dem Rücken - ohne Romulus und Remus, deren Bühnen-Nachfahren wieder in jenen Sarkophagen verschwinden, aus denen sie aufgetaucht waren. Echte römische Grufties halt, aber in modernen Klamotten und Uniformen, die samt Sonnenbrillen jedem Junta-General wohl anstehen. Mondän sind John Macfarlanes Kostüme - wie seine Ausstattung keine Rätsel aufgibt: Vor und hinter einer güldenen Treppe mit dem Thronsessel am Ende lässt es sich gut munkeln. Die begrenzenden Quader wirken antik, das Bild einer überdimensionierten Nackten könnte aus Gustav Klimts Jugendstil-Atelier stammen. Doch so direkt mag es der Regisseur überhaupt nicht. Säulen und Pfeiler schieben sich vor die hüllenlose Schöne, ihren Körper erst preisgebend, wenn es erotisch zur Sache geht. Da nutzt McVicar zudem die Tatsache weidlich komisch aus, dass Händel zwei Countertenöre in Männerrollen besetzt hat. Als Narciso ist Christopher Robson nicht nur ein schleimiges Weich ei, Agrippina geht ihm auch eindeutig zweideutig an die Wäsche, was den versierten Altus zu höchsten Tönen animiert. Die Sopranistin Juanita Lascarro bleibt jedoch immer Herrin jedweder Situation - stimmlich so elastisch wie der Charakter ihrer Bühnenfigur. Und ihre hochherrschaftliche Intrigantin Agrippina zeigt sogar echte Gefühle, als die Situation zu kippen droht. Daran ist Poppea schuld, die schnelle Kleiderwechsel meistert, eine schöne Perlen-Arie singt, für innige Herz-Schmerz-Töne sorgt und den auf Abenteuer erpichten Kaiser in Schach hält. Sopranistin Anna Ryberg, ebenfalls Ensemblemitglied, bringt bei aller Koketterie auch den gefühlvollen Zwischenton. Und in der fantastischen Szene an einer Bar, die vom US-Maler Edward Hopper gestylt scheint, geht sie sogar als Erfinderin der beschwipsten Koloratur durch, ihren Kummer in Champagner ertränkend. Wegen Ottone, der zwar den Kaiser gerettet, den sie aber fast ins Unglück gestoßen hat. Lawrence Zazzo ist dieser hin- und hergeschubste Anti-Held. Wieder ein emotional hochkarätiger Altus, der sein Leiden in der wohl anrührendsten Arie wundersam artikuliert. Dass am Tresen gehopst werden darf, liegt am barocken Barpianisten Stefano Maria Demicheli, der am Cembalo auf der Bühne eine virtuose Händel-Show abzieht. Das korrespondiert inszenatorisch mit dem Part des Nerone. Mezzosopranistin Malena Ernman gibt ihn als Rock’n-Roller - und trägt nicht nur stimmlich mächtig auf. Sie robbt die Treppen zum Thron herauf, spielt das weinerliche Muttersöhnchen, posiert wie ein Popstar, schnüffelt bei gemühlsmäßiger Schieflage schon mal am Koks - und provoziert die meisten Lacher. Man glaubt aufs Wort, dass ihr Nerone einmal Rom anzünden wird. Dass Kaiser Claudio besonders scharf auf die schöne Poppea ist, unterstreicht er in einem deftigen Strip. Ansonsten kehrt Bassbariton Simon Bailey den auch stimmlich etwas teigigen Alleinherrscher hervor, dem die Felle permanent davonschwimmen; wie seine etwas brüchig wirkenden Koloraturen. Als gefoppter Möchtegern-Liebhaber der Agrippina hält der uniformierte Soon-Won Kang (Pallante) seinen noblen, ausdrucksfähigen Bass nicht unter Verschluss. Als Claudios mehr oder minder erfolgloser Ratgeber Lesbo komplettiert Gérard Lavalle den hohen Ensemble-Anteil in dieser Oper mit geradlinigem Tenor. Friede, Freude, Eierkuchen am Ende - und ab geht’s wieder in die Gruft. Händel als Musical-Komponist in Frankfurt: Das hält der barocke Meister glatt aus, wenn auch der Perückenpuder kräftig staubt. Nur Zartbesaitete flüchten da in Oper-rette-sich-wer-kann … KLAUS ACKERMANN |
|
MUSIKTHEATER: McVicar aktualisiert in Frankfurt das Historienspiel "Agrippina" mit feiner Ironie Von Gerd Döring Blutrot und schwefelgelb prangen auf dem Bühnenvorhang die kapitolinische Wölfin und die beiden Knaben Romulus und Remus. Wenn in Frankfurt Georg Friedrich Händels "Agrippina" gespielt wird, werden die Bilder der römischen Symbolfiguren immer düsterer, zum Finale hängt die Wölfin kopfunter, gemalt mit expressivem Pinselstrich. Für Händels 1709 in Venedig uraufgeführte Jugendoper hat Monsignore Vincenzo Grimani dem jungen Italienreisenden ein eigenartiges Libretto geschrieben, das die finsteren Machtspiele im Rom der Cäsaren in eine unmoralische Komödie packt. Wie aktuell das Historienspiel sein kann - David McVicars beweist es Dank einer famosen Ensembleleistung in Frankfurt. In den klotzigen Räumen eines Herrscherpalastes bahnt sich ein Machtwechsel an, wir erleben ein Ränkespiel, in dem die skrupellose Agrippina obsiegt: Ihr geliebter Sohn Nerone erklimmt die Stufen zum Thron. McVicar hat die Szene ins Heute verlegt, die Herren stecken in Uniformen mit Lametta an der Brust, die Damen tragen chanel-inspirierte Kostüme. Als Reminiszenz an die Vergangenheit hat ihm John Macfarlane mobile Marmorsärge und monumentale Säulen auf die Bühne gestellt, zwischen denen geturnt wird wie bei den Marx-Brothers. Immer den hohen, grellgelben Thron im Auge, der die Szene dominiert, eine Händel-Comedy, die ihre Wirkung erzielt mit einer gekonnten Mischung von dreistem Klamauk und feiner Ironie. Am Pult tanzt Felice Venanzoni dem kleinen Orchester seinen Händel vor und die zwei Dutzend Mitstreiter lassen sich von dem engagierten Dirigenten mitreißsen. Kurzfristig für den erkrankten Paolo Carignani eingesprungen, gelingt Venanzoni eine feine und dynamische Händel-Interpretation mit wachen Bläsern und einer vividen Basso Continuo-Gruppe mit Laute, Violoncello und Cembalo. Stefano Maria Demicheli darf sich als Tastenfex feiern lassen, wenn er auf der Bühne den Barpianisten gibt. Begeistert rocken Poppea und ihre Verehrer den Händel - auch dafür ist Platz in den Weiten des Cäsarenpalastes. Juanita Lascarro in der Titelrolle mit klarem, strengem Sopran ist eine stimmkräftige Agrippina, der Anna Ryberg als Poppea in nichts nachsteht. Simon Baileys Claudio verfügt nicht nur über einen bemerkenswert variablen Bass, sondern auch über viel Humor. Den meisten Beifall des Abends heimst die junge Schwedin Malena Ernman ein, die als zappeliger Nerone über die Bühne stakst wie einst der junge David Bowie durch das Berlin der achtziger Jahre: mit locker sitzendem Schlips und einem Näschen für des weiße Pulver. Mit wunderbar klarem und biegsamem Mezzosopran erreicht sie allemal die androgyne Faszination der Pop-Ikone. |
|
„Agrippina" von Georg Friedrich Händel Die Oper Frankfurt präsentiert zum Ausklang der Saison Georg Friedrich Händels Erfolgsoper um Intrigen aus dem alten Rom Von Rotraut Fischer Das Bild der Wölfin empfängt den Zuschauer gleich beim Eintritt. Es schmückt den Bühnenvorhang, blutrot verwischt, mit den Gründern Romulus und Remus, die einen unheilbringenden Trank aus ihr saugen. Der Gedanke: Brudermord. Aus der solcherart begonnenen römischen Geschichte ist der Stoff zu Georg Friedrich Händels Oper „Agrippina" entnommen. Als mit der Uraufführung 1709 die Karnevalssaison in Venedig eröffnet wurde, jubelte das Publikum. Das Libretto stammte von Vincenzo Grimani, einem Mann, der es wissen musste; denn er war Kardinal, Kaiserlicher Botschafter beim Vatikan, Vizekönig von Neapel und der Gegenspieler des Papstes, also mit allen Wassern politischer Intrige gewaschen. Im Mittelpunkt der Handlung steht das Intrigenspiel Agrippinas, der Gattin des Kaisers Claudius und Mutter Neros; den Sohn will sie unbedingt auf den Kaiserthron bringen, den aber sein Stiefvater noch innehat. Mit „sex and crime" spielt sie das große Spiel um die Macht, wobei auch die Gegenspieler und -spielerinnen nicht zimperlich sind. Ungewöhnlich ist das Ende der Geschichte, denn es gibt keine Bestrafung der Bösen. Alle haben erreicht, was sie wollten, die Bösen und die etwas weniger Bösen, die doch nur die schlechteren Intriganten sind. Händel und sein Librettist machen aus dem Plot eine Mischung von Situationskomik und echtem Gefühl. Heroisch ist niemand. In der Frankfurter Aufführung, einer Produktion des Brüsseler Théâtre Royal de la Monnaie mit David McVicar, die der international bekannte schottische Regisseur zu diesem Anlass neu einrichtete, gelingt es, die Vorgaben des Werks prononciert in Szene zu setzen und eine schlüssige Formel für die unangestrengte Aktualisierung zu finden. Das Regiekonzept McVicars lässt im Spiel sichtbar werden, was bei Händel/Grimani als wechselseitiges Kommentieren von Text und Musik angelegt ist. Dazu gehört freilich auch, dass die kleine, auf historischen Instrumenten spielende Besetzung des Frankfurter Museumsorchesters mitspielt. Unter der Leitung des Studienleiters Felice Venanzoni (anstelle des erkrankten Generalmusikdirektors Paolo Carignani) unterstützt es durch betonte, wechselnde Tempi die ironische Brechung und musiziert dabei doch so klangrund schön, dass es eine Freude ist. Die sängerische Leistung steht dem nicht nach. Juanita Lascaro singt brillant und in den Koloraturen sicher die Agrippina. Sie gibt der Rolle alle Nuancen von gespielter Unschuld bis zur gefährlichen Ruhe. In der Sopranrolle des Nerone ist Malena Ernman zu hören, die expressiv und die Töne schleifend einen missratenen und verdrehten Spätpubertierenden auf die Bühne bringt. Simon Bailey gibt den polternden, tumben Machtmenschen Claudio, Grimanis Version von Papst Clemens XI, der selbst gegen seine Blamagen unempfindlich ist. Der zu Unrecht beschuldigte Ottone wird nuancenreich gesungen von dem Countertenor Lawrence Zazzo, die edle Kurtisane Poppea spielt und singt hell und leicht Anna Ryberg. Auf einer Bühne, deren mobile Elemente aus antiker Stadtarchitektur sich immer wieder neu komponieren und dem historischen Ort des Geschehens Gegenwart verleihen, während die modernen Kostüme und Uniformen zeigen, dass die Spielregeln des Kampfes um die Macht Gültigkeit besitzen, bewegen sich die Sänger nach einer ausgeklügelten Choreografie, entworfen von Andrew George. Sie ist das Bindeglied zwischen Antike und Moderne und trägt den Eindruck der Geschwindigkeit, der die ganze Aufführung durchzieht. Darin eingelassen freilich sind wie Preziosen die konzentrierten Momente einzelner Arien. Denn das Spiel um die Macht im Wolfsrudel ist nicht harmlos, auch wenn es einen hohen Unterhaltungswert hat. Die unorthodoxe Mischung aus Gelächter und tiefem Ernst, die schon die Uraufführung zum Erfolg gemacht hatte, stimmte auch in Frankfurt, was dieser intelligenten Aufführung großen Beifall bescherte. |
|
Wenn Kaiser zu viel koksen Von Axel Zibulski
FRANKFURT Sieht man den jungen Nero die Stufen zum Thron mit kreisender Hüfte hinaufrutschen, ahnt man: Diesen kommenden römischen Kaiser scheint schont die Aussicht auf die Macht sexuell zu erregen. Und je länger die Intrigen vor seiner Inthronisierung dauern, umso härter muss der spätpubertäre Chaot, der zum Despoten werden wird, sich ablenken, schnupft gar Kokain in Unmengen in sich hinein. Nur vor dem Sohn schaut Neros Mutter bisweilen verlegen drein; ansonsten lässt sie in jedem Winkelzug des Machtkampfs keine Gelegenheit zum kühl berechnenden Handeln aus. Sie, Agrippina, ist die Titelgestalt in dieser Oper Georg Friedrich Händels, die 1709 in Venedig uraufgeführt wurde. Als letzte Neuinszenierung der Saison hatte "Agrippina" jetzt an der Oper Frankfurt Premiere, eine Übernahme von David McVicars vor sechs Jahren für die Brüsseler Bühne entstandener Regiearbeit. McVicar hat das Geschehen in einen Militärstaat moderner Prägung verlegt und nutzt dabei in der Ausstattung von John Macfarlane zahlreiche Gelegenheiten zu drastischer Situationskomik: Zu Beginn des zweiten Teils der gut vierstündigen Aufführung findet sich das kaiserliche Umfeld ziemlich erschöpft an einer Bar nebst stilvoll platziertem Cembalo wieder, wo Anna Ryberg als Poppea ihre rezitativischen Einwürfe nur noch alkoholisiert einwerfen kann. Den zunächst verschollenen und bald wieder aufgetauchten Kaiser Claudio, den Simon Bailey ohne letzte Tiefen-Souveränität gibt, zieht es eher zum Golfen als zum Regieren. Und Ottone als hölzern uniformierter Günstling, dem Lawrence Zazzo freilich seinen unbeschwert strahlenden Countertenor leiht, wirkt schon komisch, wenn er nur menschliche Regungen zeigt. So gibt McVicar die eigentlich bestialischen Gestalten immer auch ein wenig der Lächerlichkeit preis, allen voran den jungen, von Malena Ernman wendig gesungenen, zappelig gespielten Nerone und dessen Mutter Agrippina, die Juanita Lascarro mit teils scharfen, aber sicher gesungenen Koloraturen gibt. Bevor sie alle zurückgeschickt werden auf jene Sockel, von denen sie ins Bühnengeschehen herabgestiegen sind, mögen an diesem langen Abend Passagen szenischen Leerlaufs nicht ausbleiben. Doch sie werden packend überspielt von dem gestisch, klanglich scharfkantig und immer wieder überraschungsreich sekundierenden Museumsorchester, an dessen Pult Frankfurts Studienleiter Felice Venanzoni die Gelegenheit nutzt, sich als Kenner historischer Aufführungspraxis zu profilieren. |