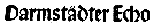|
Carmen in der Kittelschürze Bizet-Premiere im Großes Haus endet im "Buh"-Gewitter für die Regie Von Axel Zibulski
WIESBADEN Es passiert kurz nach der Pause, zu Beginn des dritten "Carmen"-Aktes. Don José ist gerade damit beschäftigt, seine Mutter in ein frisch ausgehobenes Erdloch zu verbringen, als sich die angespannte Stimmung des Premieren-Publikums in einer Flut von "Buh"-Rufen entlädt; auf der Bühne und im Orchestergraben spielt man dazu tapfer weiter "Carmen". Oder doch eher "Don José". Oder "Don Josés Männer-Phantasmagorie". Das nämlich ist es, was Regisseur Hermann Schmidt-Rahmer im Großen Haus des Wiesbadener Staatstheaters zeigt. Don Josés Mutter? Sie tritt eigentlich in Georges Bizets "Opéra-Comique" nicht persönlich auf. Schmidt-Rahmer hat sie, dargestellt von Helga Bender, als greise, in ein weißes Nachthemd gehüllte Gestalt in die Oper eingefügt. Schon zu den Klängen des Orchestervorspiels legt sich Don José ins Bett an ihre Seite; was folgt, ist ein Traum, Don Josés Fantasiegebilde: Eine rechteckige Bühne auf der Bühne hat Herbert Neubecker dafür errichtet, mit Wänden aus Papier, die im Laufe des Abends immer weiter eingerissen werden. Anfangs noch beobachtet Don José das Geschehen ganz bürgerlich vom Schreibtisch aus, wird aber immer weiter hineingezogen in diesen Traum, in dem sich allerhand Irreales ereignet, sein Rivale Escamillo trotz zahlreicher Messerstiche nicht die Spur einer Verwundung zeigt, und mancher, der erschossen oder begraben wird, ohnehin gleich wieder aufsteht. Am Ende, im glutrot ausgeleuchteten Schlussbild des vierten Akts zieht es Don José sogar noch den letzte Stuhl wie von Geisterhand weg. Welche Rolle spielt Carmen hier? Sie wird in dieser gänzlich verschobenen Regie-Perspektive zum Typus der Frau, die der Mann als Muttersohn offenbar sucht: Zunächst durchaus mit verführerischem Rot und Schwarz lockend (Kostüme: Michael Sieberock-Serafimowitsch) wird ihr, kaum dass sie erobert ist, von Don José eine Schürze angezogen und zur Freude der Mutter die neue Einbauküche vorgeführt - was dann doch ein wenig küchenpsychologisch anmutet. Insgesamt kann Schmidt-Rahmers Regie, ergänzt um die Choreografie von Gregory Livingston, nur mit erheblichen Brüchen ausfallen, weil er eben eine ganz andere Geschichte als die der Carmen erzählt: So weicht er im zweiten Akt zum Beispiel ins Slapstickhafte, aber nicht wirklich Komische aus, als sich die Schmuggler Dancaero (Axel Mendrok) und Remendado (Jud Perry) in recht triviale Dialoge verstricken - gesungen wird französisch, gesprochen deutsch, und zwar auf Grundlage der Dialogfassung von Fritz Oeser in einer eigenen Übersetzung, eher Neufassung des Regisseurs. Diese deutsch-französische Mixtur ist in "Carmen"-Inszenierungen nicht unüblich, mit ihren Sprach-Friktionen gleichwohl problematisch. Vor allem aber mag sich in dieser neuen Wiesbadener "Carmen" die Musik mit ihren spanischen Anklängen so gar nicht mit der Szene verbinden. Natürlich muss man das Werk nicht als folkloristische Kostümschlacht inszenieren - das prächtige Torero-Gewand, in dem Ralf Lukas als Escamillo auch baritonal eine hervorragende Figur macht, wirkt in diesem Umfeld fast schon wie eine Karikatur. Aber hier bleibt die Orchesterpartitur häufig eine eigentümlich blasse Begleiterscheinung, die das Szenische nie recht beglaubigen mag, obwohl der französische Dirigent Emmanuel Joel das Hessische Staatsorchester durchaus zu einer rhythmisch pfeffrigen, dabei dynamisch eher dezent als plakativ wirkenden, klanglich schlanken Interpretation anhält. Seiner von der Regie zugewiesenen Zentralgestalt ist Alfred Kim als Don José mit seinem metallisch-stabilen, nur in der äußersten Höhe in ein gewöhnungsbedürftiges Falsett ausweichenden Tenor insgesamt gewachsen, Milana Butaeva bietet als Carmen einen angemessen herben, gerade auch in der Tiefe starken und glutvollen Mezzosopran, Sharon Kempton ist eine ganz lyrische, fast mädchenhafte MicaDla. Die üppige Chorbesetzung aus Chor, Jugend- und Extrachor des Staatstheaters (Einstudierung: Thomas Lang und Dagmar Howe) überzeugt vor allem auf Seiten der Herren durch Präzision; das Solistenensemble ergänzen Emma Pearson und Betsy Horne als aufgedrehtes Doppel Frasquita und Mercéd´Zs, Thomas Braun als Lillas Pastia, Axel Wagner (Zuniga) sowie Jochen Elbert (Andres). Am Ende Beifall, "Bravo"-Rufe für Sänger und Orchester. Und das zu erwartende "Buh"-Gewitter für die Regie. |
|
Mutter ist an allem schuld Oper: Hermann Schmidt-Rahmers Wiesbadener „Carmen" - Inszenierung erntet für ihre grellen Effekte viele Buhrufe Von Albrecht Schmidt WIESBADEN Friedrich Nietzsche schätzte an „Carmen", der „Oper aller Opern", das Geistreiche, Anmutige und Südländische. Und selbst der Komponist Georges Bizet empfand sein Werk eher spielerisch-schwebend – eine Geschichte mit zwar traurigem Ausgang, aber dennoch ein Kind der Opéra comique. Bis heute gibt es die Sehnsucht vieler Theaterbesucher nach Bizets Oper mit ihrem vor allem durch Filmfassungen geschürten Folklore-Talmi. Hierum schert sich freilich die neue Wiesbadener Produktion nicht: Der Regisseur Hermann Schmidt-Rahmer baut auf eine Traumversion, er interpretiert „Carmen" als Phantasmagorie eines braven Bürgers und überschwemmt seine Inszenierung mit einer ungehemmten Bilderflut, die ihm unsere mediale Alltagswelt mühelos liefert. Don José ist ein naiver Spießbürger, seine Micaëla kein Blondzopfgeschöpf, sondern eine gereifte Ehefrau, die ihm drei fröhliche, im Ehebett herumhopsende Kinder geschenkt hat. Das Familienglück wird jedoch getrübt durch Josés krankhafte, an Hitchcocks „Psycho" erinnernde Abhängigkeit von der Mutter: Sie ist in einem Albtraum als gespenstische Bühnenfigur ständig präsent. Kulminationspunkt ist eine von Buhrufen begleitete, provokant makabre Szene, in der der Traumatisierte die Alte bei lebendigem Leib verscharren will. An derlei surrealer Drastik gibt es keinen Mangel in der Inszenierung: Die Straßenjungen im ersten Akt mutieren zu einer mit Maschinengewehren bewaffneten Kinder-Kampftruppe, die durch Wände und den Bühnenboden hervorbricht. Die Choristen sind stets gewaltbereite Voyeure, die sich in bizarren Verrenkungen verbiegen und zu grotesken Offenbachiade-Collagen formieren. Carmens Schmuggler-Kumpel sind schrille, durchgeknallte Vögel, Drogendealer und aufgetakelte Dirnen. Das Hessische Staatsorchester Wiesbaden (Musikalische Leitung: Emmanuel Joel) und der Chor, Jugend- und Extrachor des Staatstheaters (Einstudierung: Thomas Lang) unterlegen diese prallen Bilder adäquat, mit einer messerscharf-knallig artikulierten Carmen-Musik, aus der üppige Funken schlagen, die sich aber auch durchsichtig zeigt. Die Koordination zwischen Graben und Bühne, vor allem bei der Abstimmung mit dem Chor, wird sich in weiteren Aufführungen festigen müssen. Die Wiesbadener Produktion verzichtet auf die im internationalen Musikbetrieb dominierende, glättende Fassung mit den von Ernest Giraud nachkomponierten Rezitativen und bringt die französisch gesungene (mit Übertiteln übersetzte) Urfassung mit deutschen Dialogen, die Hermann Schmidt-Rahmer aktualisiert und seiner Inszenierung angepasst hat. Bis in die Nebenpartien hinein sind die Rollen großartig besetzt: Der Koreaner Alfred Kim, der den Don José singt, ist ein harmonisch abgerundeter, Brust- und Kopfresonanz übergangslos mischender Tenor, Milana Butaeva eine ideale Carmen, die im spöttischen Ton der Überlegenheit ihren Mezzo samtig-guttural einsetzt. Sharon Kempton als Micaela lässt lyrische Emphase aufblühen, und Ralf Lukas (der Wotan im Wiesbadener Ring) verbreitet als Escamillo baritonalen Höhenglanz. Dem Jubel des Wiesbadener Premierenpublikums über die musikalischen Leistungen stand die schroffe Ablehnung der Regiearbeit gegenüber. Dennoch: Diese Inszenierung voller Überraschungen, Spannung und Zündstoff sollte weiterhin nicht nur Aufsehen erregen, sondern auch die verdiente Anerkennung finden. |
|
Carmen in der Macho-Falle Von Matthias Gerhart Ja, auch die Wiesbadener Operngänger entwickeln noch Emotionen. Wenn beispielsweise Menschen lebend auf der Bühne verbuddelt werden oder es im Bett all zu deutlich zugeht. Hermann Schmidt-Rahmer inszenierte sich mit seiner Deutung von Bizets „Carmen" nicht in die Herzen des Publikums. Auch wenn das große Schild mit der Aufschrift „Rauchen verboten" ausgerechnet in einer Zigarettenfabrik zum Schmunzeln verleitete. Es war einer der wenigen guten Regieeinfälle einer ansonsten eher belanglos und orientierungslos vorantreibenden Inszenierung voller Macho-Gehabe und primitiv gekleideter Menschen. Um so größer war der Gegensatz zu dem, was musikalisch und darstellerisch geleistet wurde. Milana Butaeva war eine gute Carmen. Sie verfügte über jenen leichten Mezzosopran, der die berühmte „Habanera" zu einem echten Hörerlebnis werden lässt; zart und innig, aber auch voller Leidenschaft sprudelnd. Rassige Figur und Haarpracht rundeten das überzeugende Bild der Sängerin ab. Da wird nicht nur ein strammer Sergeant wie José schwach. Alfred Kim übrigens war in dieser Rolle das adäquate Gegenüber Carmens. Er sang mit sicherer und flexibler Stimme und brachte viel Abwechslung und Farbe in seinen Part. Der dritte Sänger, der unbedingt erwähnt werden muss, ist der feurige Stierkämpfer Escamillo, dem Ralf Lukas eine individuelle, aber stark machohafte Persönlichkeit verlieh. Er riss im vierten Akt auch das bis dahin eher zurückhaltend und gepflegt musizierende Orchester mit. Dem Dirigenten Emmanuel Joel schienen zuweilen die Zügel etwas zu entgleiten. Ansonsten aber gelang dem Ensemble das spanische Kolorit der Oper überzeugend. Schon die Vorspiele zeigten, dass man sich umfassend mit der Materie befasst hatte. Anlass zu Diskussionen gab auch der Umstand, dass die Arien und Duette in französischer Sprache gesungen, die gesprochenen Dialoge dagegen in Deutsch vorgetragen wurden. Wenigstens musste man deshalb nicht dauernd auf die Übertitel an der Decke schauen und sich möglicherweise noch den Hals verrenken. Dieses Problem hatten indes die Zuschauer auf dem rechten Bühnenrang. Weil das Geschehen rund um die Station des Sergeanten auf der äußersten rechten Seite der Bühne spielte, hatte man kaum eine Möglichkeit, dies ohne Verrenkungen zu verfolgen. Oder man benötigte eine Gelassenheit wie jener Herr in Reihe drei, der überhaupt nichts sah. „Die Musik ist ja wunderbar", sagte er ganz glücklich, wohl in dem Bewußtsein, bei dieser Inszenierung ohnehin nicht viel versäumt zu haben. |