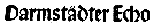|
Auf den Punkt gebracht Ausblick: Doppelpremiere: Glucks „Iphigenien"-Opern im Staatstheater Darmstadt DARMSTADT. Schon immer habe Glucks Musik ihn begeistert, erklärt Generalmusikdirektor Stefan Blunier in einem Gespräch über die beiden Gluck-Iphigenien – „Iphigenie in Aulis (Iphigénie en Aulide)" (1774) und „Iphigenie auf Tauris (Iphigénie en Tauride)" (1779). Sie haben am Wochenende an zwei aufeinanderfolgenden Abenden in der Inszenierung des Opern-Oberspielleiters Philipp Kochheim im Staatstheater Darmstadt Premiere. Glucks Musik mache süchtig, behauptet Blunier und bedauert, dass der Komponist heute immer noch unterschätzt werde. Tatsächlich sehen viele in Glucks Werken Prototypen starrer Klassizität. Diese Sicht wird allerdings Glucks musikdramatischer Sprache nicht gerecht. In Glucks Opern, sagt Blunier, sei das Musiktheater auf den Punkt gebracht. Der Komponist sei ein äußerst sensibler Musiker, der die Charaktere seiner Opernfiguren wie deren Beziehungen untereinander genau durchleuchte. Während „Iphigenie in Aulis" weicher und lyrischer wirke, sei „Iphigenie auf Tauris" viel schroffer, gepaart mit einer „Hyperdramatik", hinter der Blunier „hypergeladene Emotionen" sieht. Verknappung und Kleingliedrigkeit der Musik erhöhten hier die dramatische Wirkung. Selten gehörte musikalische Affekte treten in Glucks „Iphigenie" zutage, denn der Komponist verformt manchmal bewusst den Wohlklang, weil das Orchester das Geschehen kommentiert. In der Aufführung werde man sich auch auf die historische Aufführungspraxis stützen, erklärte Blunier. Zum Teil werden die Streicher mit Barockbögen spielen, auch Naturtrompeten, Barockposaunen und Ziegenfell-Pauken gehören zum Orchester. Vor allem seien die Partien sehr dankbar für die Sänger wie den Chor, meinte Blunier. Wie bringt man nun die beiden „Iphigenien" auf die Bühne? Die aulische Iphigenie soll von ihrem Vater geopfert werden, damit dieser bessere Winde vorfindet, um übers Meer nach Troja in den Krieg zu ziehen. Die taurische Iphigenie muss 15 Jahre später als Diana-Priesterin jeden Fremden töten, der die Insel betritt. Doch ausgerechnet ihr Bruder Orest kommt an Land. Beide Opern, die auf Französisch (mit deutschen Übertiteln) gesungen werden können sowohl einzeln wie auch nacheinander gesehen werden. Schließlich könne man „Iphigenie auf Tauris" als Fortsetzung der „Iphigenie in Aulis" begreifen, da ein Thema von verschiedenen Seiten beleuchtet werde, sagt die Musiktheater-Dramaturgin Christina Meißner, die für den mit der Inszenierung beschäftigten Regisseur Philipp Kochheim am Gespräch teilnahm. Allerdings werden die beiden Iphigenien von verschiedenen Sängern dargestellt. „Iphigenie in Aulis" sei eine junge Frau, die noch nicht viel Schreckliches erlebt habe, sagt die Dramaturgin. Um die beiden Stücke heute besser nachvollziehbar zu machen, habe man den archaischen Stoff in eine Science-Fiction-Zeit verlegt, was vor allem die Kostüme nahe legen, die zusätzliche visuelle Anreize böten. Doch mehr wollte Meißner nicht verraten. Die zeitliche Versetzung würde aber aufgehen, ergänzt Blunier, zumal die Inszenierung auch die Musik mitempfinde. (hz) |
|
|
Götter ohne Aktenkoffer Doppelpremiere am Staatstheater Darmstadt: Philipp Kochheim inszeniert die beiden "Iphigenie"-Opern von Christoph Willibald Gluck |
|
|
Frankfurter Rundschau: Das Staatstheater Darmstadt macht sich um die Operngeschichte verdient. Erst spielt man hier zwei Werke von Claudio Monteverdi, dem Erfinder der Oper; jetzt folgen zwei Opern von Christoph Willibald Gluck, dem Erfinder der "Reformoper". Was hat es denn damit eigentlich auf sich?Philipp Kochheim: Eine solche "Reform" findet eigentlich schon statt zwischen den beiden von uns gespielten Opern, also Iphigenie in Aulis und der fünf Jahre später entstandenen Iphigenie auf Tauris. Die eine ist eine klare Nummernoper, durchsetzt mit Einlagen und Balletten; die andere ist bereits ein nahezu durchkomponiertes Musikdrama. In Aulis mussten wir noch etliche Striche machen, um die Oper dramaturgisch kompakter zu bekommen, Tauris dagegen ist aus einem Guss, ein durchgehendes Meisterwerk. Kein Wunder, dass Richard Wagner sich so sehr für diese Oper begeistert hat! Wo früher die Gesangslinien üppig ausgeziert waren, sind sie nun ganz schlicht, auch das ist ein wesentliches Zeichen der Reformoper. Der Reiz der Barockoper liegt ja nicht zuletzt in der Artistik der Singstimmen. Wenn das nun beim späten Gluck wegfällt: Was tritt an diese Stelle? Die psychologische Durchleuchtung der Figuren. Die Affekte werden hier nicht mehr durch "Kunstanstrengung", sondern ganz direkt als emotionales Erleben auf der Bühne gespiegelt. Gerade Iphigenie auf Tauris rast mit einer enormen Zielstrebigkeit auf die zentralen Konflikte und die Katastrophe zu. Nun lässt man in Darmstadt diese beiden Gluck-Opern nicht direkt aufeinander folgen, um die Entwicklungsschritte des Komponisten hin zum Musikdrama zu zeigen, sondern weil die beiden Werke ja auch inhaltlich zusammenhängen, die so ähnlich klingenden Titel verraten es bereits. Ist es eine Fortsetzungsgeschichte? Ja, das ist es, und der Zusammenhang wurde für mich immer deutlicher, je mehr ich mich damit beschäftigt habe. Aulis ist sozusagen Iphigenies Pubertätsgeschichte unterm Fallbeil. Auf Tauris dann führt sie auf einem sehr ethisch-bewussten Niveau ein Priesterinnenregiment gegen ein brutales Barbarenregime. Vieles von dem, was im ersten Teil angelegt ist, findet seine schreckliche Erfüllung im zweiten Teil. Doch für mich entscheidender als der reine Fortsetzungscharakter ist das, was ich das "bipolare System" nenne. Erst haben wir die hohe Zivilisation der Griechen, dann das Barbarentum - das Bühnenbild der ersten Oper zeigt auch einen klinisch klaren Raum, für die zweite Oper drehen wir es dann um, man sieht die Verstrebungen, eine Zivilisationsschrott-Wüste. Und so unterschiedlich diese Welten auch zu sein scheinen, alles läuft in ihnen immer auf das gleiche hinaus: Das System von Opfer und Krieg funktioniert in beiden Welten gleich - man sieht das ja gut an unser aktuellen Zeit. Kann man als Zuschauer eine der beiden Opern auch isoliert verstehen, oder muss man sie im Doppelpack besuchen? So wie man vom Film "Matrix reloaded" kein Wort verstanden hätte ohne das Vorwissen aus "Matrix"? Sie sind da ja schon ganz tief in unserem Assoziationsraum, woher wissen Sie das? Meinen Sie das Stichwort "Matrix"? (lacht): Genau! Erstaunlich. Zunächst: Mein Anspruch ist schon der, jede Oper für sich verstehbar zu machen. Die Geschichten sind jede für sich abgeschlossen. Ich empfehle allerdings, erst die eine, dann die andere Oper zu besuchen. Der formale Genuss ist nur dann ganz gewährleistet, wenn man beide sieht. Wenn ich nun schon einmal das richtige Schlüsselwort genannte habe: Was hat es mit der "Matrix", einem Science-Fiction-Stoff, auf sich? Als John Dew mich fragte, ob ich diese Regie übernehmen wollte, war der entscheidende Punkt für mich: Wie kann ich heute in unserer zu Tode aufgeklärten Welt auf der Bühne mit dem Mythos umgehen, ohne ihn zu entmystifizieren oder zu denunzieren? Von Göttern mit Aktenkoffern in Holz vertäfelten Räumen hatte ich zumindest die Nase voll. Ich wollte die Geschichte in ihren Koordinaten so belassen, wie sie ist, ohne auf Ritter in Strumpfhosen zurückgreifen zu müssen. Die Frage in Iphigenie in Aulis zum Beispiel ist: Wieso ist ein Vater bereit, sein über alles geliebtes Kind zu opfern? Wir haben alles Mögliche durchprobiert, von islamistischem Terror über eine tödliche Krankheit, nichts hat funktioniert. Dadurch wurden wir aus der Gegenwart geradezu fortgezwungen, und mir kam jener Satz in den Sinn, mit dem die Star Wars-Filme beginnen: Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis. Eine völlig verrückte Perspektive: Wir sehen einen Science-Fiction-Film, aber die Zukunft ist eine längst vergangene Geschichte. Einer solchen Perspektive haben wir uns hier bedient, das ist hier der Hebel. Und einen solchen Hebel brauche ich immer, um Theater zu machen: Ich versuche eine Perspektivverschiebung hin auf das Stück, die mir erlaubt, es jenseits des Reclam-Opernführers zu erzählen. Übrigens: Ihr Chef, Intendant John Dew, mag Götter mit Aktenkoffern, wie man in seinem Wiesbadener "Ring" gesehen hat. Mist. Aber er mag keine Holzvertäfelungen. Glucks "Iphigenie"-Opern kennt heute im Grunde kein Operngänger mehr. Ist es leichter, Opern zu inszenieren, für die keine festen Bilder in den Köpfen existieren? Für mich als Regisseur ist es eigentlich spannender, wenn die Werke präsent sind, weil sich dadurch ein ganz anderer Assoziationskosmos ergibt. Aber egal ob bekannt oder unbekannt: Meine Bilder sollen mit unserer heutigen Welt zu tun haben, nicht zuletzt auch, um ein jüngeres Publikum anzusprechen. Was gerade in Premieren nicht immer funktioniert: Eine Paris Hilton in La Traviata oder ein Michael Moore in Mahagonny wird zumindest vom nicht eben jungen Premierenpublikum einfach nicht erkannt. Dann sehe ich aber schwarz für die Bezüge aus "Star Wars" und "Matrix", die ja nicht eben das übliche Hintergrundwissen der Premierengeneration bilden. Begreifbar wird es auch so. Man muss nicht unbedingt erkennen, dass wir aus Matrix Kostüme und Accessoires entlehnt haben. Und nicht nur das, Sie werden sehen: Der Aufwand wird immens! Doris Dörrie wurde kürzlich in München hart geprügelt für ihre Science-Fiction-"Rigoletto"-Inszenierung. Haben Sie da keine Bedenken? Überhaupt nicht. Wenn ich Skrupel bei Gattungsfragen hätte, dürfte ich nicht Theater machen. Science Fiction hat für mich nichts, was es disqualifiziert für die Kultur. Ganz ausschließen kann man nun also zumindest nicht, dass diese Premiere abläuft wie ihre letzte in Darmstadt mit Mozarts "Entführung". Da rief jemand im Publikum: "Betrug!" Es gibt zwei Sorten von Publikum: Das eine erwartet vom Regisseur, dass er nicht die Oper, sondern den Opernführer auf die Bühne bringt. Das soll jetzt nicht arrogant klingen, aber für diese Leute kann ich nicht arbeiten. Meine Herausforderung ist es, die Stoffe neu zu überprüfen. Das Wort "Betrug" ist jedenfalls ein spannender Stein um einen Prozess des Nachdenkens anzustoßen darüber, was passieren soll und darf. Ich selbst halte mich eigentlich für wahnsinnig altmodisch, weil ich die Geschichten unangetastet lasse und nur das Dekor außen herum anpasse. Und das, so bilde ich mir zumindest ein, immer im Dienste der Menschen auf der Bühne und ihrer zentralen Konflikte. Interview: Stefan Schickhaus [ document info ] Dokument erstellt am 28.03.2006 um 16:04:06 Uhr Erscheinungsdatum 29.03.2006 |
Interview. Philipp Kochheim , 1970 in Hamburg geboren, inszeniert seit Beginn der Intendanz von John Dew am Staatstheater Darmstadt. Zuletzt hat er Ende 2005 mit einer radikal umgedeuteten "Entführung aus dem Serail" das Publikum irritiert.Die beiden "Iphigenie"-Opern von Christoph Willibald Gluck (1714-1787) sind Kochheims fünfte bzw. sechste Darmstädter Inszenierung. Die beiden selten gezeigten, im Abstand von fünf Jahren komponierten Opern haben am kommenden Wochenende Premiere: Am 31. März "Iphigénie en Aulide", am 1. April "Iphigénie en Tauride", jeweils um 19.30 Uhr. ick |