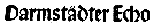|
Medeas Schreckensherrschaft VON HANS-KLAUS JUNGHEINRICH Ja, die archaische Rachefurie Medea ist jeder Aufklärung ein Skandalon. In Luigi Cherubinis Opernversion Médée artikuliert sie sich zudem nicht so sehr als eine mythische Heroine, sondern als kalt berechnende Strategin ihrer Vergeltung aus Eifersucht und Gekränktheit: einer Aufgeklärtheit - die vielleicht auch im 21. Jahrhundert, wo Kinder nach wie vor allzu sehr dem Eltern(un)recht anheimgegeben sind, noch nicht recht angekommen ist - zuwider, sieht sie ihre beiden Kinder als ein ihr entglittenes, dem untreuen Jason zugefallenes Eigentum, dessen Zerstörung vor allem diesen trifft. Cherubinis dreifache Mörderin (zuerst fällt die Nebenbuhlerin ihr zum Opfer) gehört gleichwohl zu den auratischen Opernfiguren (kreiert auch von der Callas). Der französischen Originalfassung nahm sich am Mannheimer Nationaltheater nun Achim Freyer an. Auf Freyers Medea-Bühnegibt es keinen Platz für Kinder Freyers nicht-realistische Ikonographie rückte das Drama ( das man, wenn man will, als einen Vorgriff auf das "Theater der Grausamkeit" einschätzen kann) in eine finster-märchenhafte Irrealität. Den ariosen Exaltationen der Hauptfiguren dienten vier Podeste im Vordergrund. Dort prangten die kulissenhaft phantastischen Kostüm-Attrappen, hinter denen sich die Akteure zu ihren Auftritten aufstellten, wobei angelegt war, dass sie - nahezu unbewegt, nur mit "sprechenden" Händen und Armen - jeweils aneinander vorbei in Richtung Publikum agierten, so dass es keine sich schneidenden Linien von Personenbeziehungen auf der Bühne gab. Die grelle Farbigkeit dieser Einzelfiguren stach vom finsteren, ins Spitzwinklige laufenden Hintergrundrahmen ab, an dessen oberem Rand die Choristen (mit Maskenköpfen und Kunsthänden) sichtbar waren. Der Chor, immer ein etwas heikler Faktor in der Szenographie Freyers (am liebsten würde er, Regisseur und Ausstatter in Personalunion, ihn unsichtbar machen), nimmt so von seinen beiden Funktionen - dramatis persona und antiker Kommentator - nur die letztere wahr. In Freyers wie fast immer faszinierend schlüssig umgesetztem Konzept hatten leibhaftige Kinder keinen Platz: Die automatenhaft tänzelnd posierende künstliche Zweiergruppe in Weiß, sterbend von einem langen roten Handschuh drapiert, mutete umso unheimlicher an. Die merklich von der Atmosphäre der revolutionären Gräueljahre in Paris inspirierte Oper hat großformatige, dankbare Hauptrollen; in Mannheim war Caroline Whisnant eine imponierende Verkörperung der Titelfigur, eindrucksvoll auch mit ihren wie in Stein gemeißelten, idiomatisch mühevoll justierten deutschen Sprechtexten (eine schöne crudité, diese Dialoge der französischen Gesangssprache einfach entgegenzusetzen), erst recht mit dem geradlinig-wuchtigen, in der Höhe voll entfalteten Gesangsduktus. Der bewegliche Tenor von John Horton Murray gab dem Jason eine passend schillernde Typisierung; optisch wurde er mit dem Attribut eines mythologisch unbelasteten (vielmehr: aus ganz anderer Mythologie entnommenen) Panamahuts ins sublim Vergaunerte gelenkt. Als viriler Créon mit fletschender Würde: Thomas Jesatko. Zwei sehr profund besetzte, ergiebige Frauenrollen: Dircé mit Cornelia Ptassek, Néris mit Susan Maslean. Immer wieder eine erstaunliche Erfahrung die plastische, sprechende, klar konturierte Musik Cherubinis mit ihren Beethoven-nahen Attacken, ihrem revolutionsmusikalischen Schwung, auch ihren subtilen instrumentalen Farbkombinationen. Der musikalische Leiter Gabriele Ferro verfügte über einen Dirigiergestus von durchgehaltener Dauerspannung, was, nach einigem Streuverlust, im Orchester zu ununterbrochen gut mittleren Intensitäten führte, noch ein wenig wirkungsbelebt durch Auf- und Niederfahren des Orchestergrabens. Das ebenso seltene wie berühmte Werk trifft am Nationaltheater auf beste Theaterluft und wird vom Publikum begeistert angenommen. [ document info ] Dokument erstellt am 12.04.2006 um 16:56:56 Uhr Erscheinungsdatum 13.04.2006 |
|
MUSIKTHEATER: Achim Freyer zeigt am Nationaltheater Mannheim eine faszinierende Sichtweise von Luigi Cherubinis "Médée" Von unserem Redaktionsmitglied Etwas Furchtbares kommt über den düsteren Himmel. Am Anfang ist es nur ein Rumoren, ein Brodeln und Beben der Gefühle, ein Spiel mit den Möglichkeiten des Weltenlaufs. Violinen huschen. Klanggeister flüstern. Rhythmen springen auf leisen Sohlen gespensterhaft über die Bühnenbretter. Doch plötzlich erhebt sich diese Stimme, der Sopran von Caroline Whisnant, und singt wunderschön: "Ja, ich bin Medea, und ich lasse sie leben." Nein, so etwas wie Zuversicht dringt nicht aus diesen d-Moll-dunklen Vokabeln. Es ist reine Verzweiflung, ein Schwanken zwischen bedingungsloser Liebe und bedingungslosem Hass. Wieder einmal steuern wir auf jenen Punkt zu, den wir psychische Katastrophe nennen: Ich liebe meine Kinder, aber ich hasse ihren Vater, und zwar so sehr, dass sie sterben müssen. Achim Freyer, der Luigi Cherubinis 1797 uraufgeführte, heute aber nur selten gespielte Oper "Médée" nun am Nationaltheater Mannheim zeigt, lässt solchen Momenten eine autonome und totale Strahlungskraft, weil er alles, was den Atem der Worte, Klänge und Gefühle zerstören könnte, auf ein Minimum reduziert. Dass diese radikale Reduktion das Dilemma der Oper, das Abwägen zwischen Hass und Liebe, direkt über dem Publikum ausschüttet, ist eine der Sensationen dieses Abends: Diese Inszenierung muss man lieben oder hassen. Dazwischen ist nur ein schmaler Grat gänzlicher Gleichgültigkeit. Wir erleben einen nackten, schwarzen, dreieckigen Einheitsraum, in dem auf vier Sockeln so etwas wie vier steife Kostüm-Statuen stehen, die hinten geöffnet sind. Über Rampen schreiten die maskierten Sänger-Protagonisten dieser Musiktragödie nach Euripides' "Medeia" zeitlupenhaft in die Statuen hinein und beseelen das Seelenlose zu einer Art Archetypus des Charakters, des Gefühls, des Temperaments oder der hierarchischen Position. Köpfe wackeln. Arme gestikulieren. Hände spielen. Der Rest ist Wort, Wort und Klang und Licht. Klar: Wie das Theater Robert Wilsons, so kommt auch Freyers "Médée" zunächst sehr künstlich und statisch daher. Die Geschichte um die Zauberin Medea, dessen Geliebter Jason sich nach zehn Jahren des Glücks und zwei gemeinsamen Söhnen in die Königstochter Dircé verliebt, worauf Medea sich rächt und am Ende, darin Don Giovanni und Brünnhilde ähnlich, den Feuertod stirbt und ein fanalartiges Zeichen des Untergangs setzt - diese Geschichte lässt Freyer in einem optischen Licht- und Farbenrausch gerinnen (Licht: Andreas Rehfeld). Was Freyer indes wesentlich von Wilson unterscheidet, ist, dass nichts - außer vielleicht die Masken - manieriert ist an seinem Theater. Er geht immer vom Werk aus. Deswegen kommentiert das Volk hier etwa das Geschehen wie ein antiker Chor, gestikulierend, ansonsten aber bewegungslos über der Szenerie thronend. Befreit wird bei alldem nicht nur die Sprache der gesprochenen Dialoge; Freyer verwendet die sehr dichterische Version Georg Friedrich Treitschkes, die den sonoren Sprechstimmen der Sänger entgegenkommt. Befreit wird nicht nur Cherubinis vitale Musik, die in ihrer stilistischen Bandbreite irgendwo zwischen Gluck, Haydn, Weber, Meyerbeer und dem frühen Schubert anzusiedeln ist. Befreit wird vor allem auch der Interpret, dessen Agieren gegen Null strebt. Zunächst aber zu Freyers Weggenossen Gabriele Ferro, der am Pult des Nationaltheaterorchesters und -chores steht. Ähnlich dynamisch, wendig und geistreich wie bei Adam Fischer klingt das, was aus dem Orchestergraben heraus sprudelt und vom Chorhimmel herab rieselt. Jede Note, jede Figur, jedes Motiv und Thema hat Schliff und eine intensive, aber nicht übertriebene Beseeltheit, die freilich im krassen Gegensatz zum Bühnengeschehen steht. Aber von solchen Kontrasten lebt diese minimalistische Maximal-Inszenierung, die statt auf die äußeren Bewegungen der Körper und Dinge auf die inneren setzt, Psychen befragt, Spannungen hervorkitzelt und Stimmen zum Klingen bringt - vor allem die der drei Frauen Médée, Néris und Dircé, die vom neuen Star des Nationaltheaters, Cornelia Ptassek, einerseits in berückender, fast jenseitiger Sopranschönheit gesungen, dann wieder in unerhört deklamatorischer Schauspielermanier gesprochen wird. Was für eine Begabung! Die anderen stehen ihr kaum nach. Caroline Whisnants Titelpartie hat hexerische Dramatik, ohne allzu sehr spitz zu werden und ins Vibrato abzudriften. Auch für sie ein großer Abend, dem sich gleich noch Susan Mclean anschließt, die eine runde, edel tönende Néris gibt. Bei den Männern sieht es weniger glücklich aus. Die Stimme Thomas Jesatkos (Créon) will einfach nicht sitzen, und John Horton Murray (Jason) ist schlicht fehlbesetzt. Eine wesentlich lyrischere Stimme wäre hier nötig gewesen. Am Ende: Kampf der Gesinnungen. Buhs gegen Bravos. So muss es sein nach einer Produktion, die mit ebenso viel Mut wie Vermögen auf die Bühne gehoben wurde. Mannheim hat einen guten Lauf. Etwas furchtbar Gutes kommt da über den Himmel. |
|
Schaufenster der Symbole Musiktheater: Achim Freyer inszeniert Cherubinis „Médée" in Mannheim und lässt die Sänger in Zeitlupe aus der Tiefe des Raums die Bühne betreten und die Arme kreuzen wie Wettermännchen Von Sigrid Feeser MANNHEIM. In Mannheim macht Gesamtkunstwerker Achim Freyer Cherubinis „Médée" zum Schaufenster seines Theaters der Geheimzeichen und Symbole. Viel geschieht nicht in der dreistündigen Aufführung. Es wird französisch gesungen und deutsch gesprochen. Vier Podeste mit aufgeputzten Kostümen stehen da. Die Sänger kommen in Zeitlupe aus der Tiefe der Bühne, treten hinter die Gewänder, kreuzen die Arme wie die Wettermännchen, singen, was sie zu singen haben. Da sie furchterregend grimassierende Masken tragen, klingt ihr Gesang deplatziert. Oben, hinter über Eck angebrachten Vorhängen kommentiert der Chor das grausige Geschehen mit Weh und Ach und hilflos gezeigten Handflächen. Das erzeugt einen merkwürdigen Sog. Doch nach der Gewittermusik zu Beginn des dritten Aktes bricht das Einverständnis auseinander. Dem Katastrophenfinale ist Freyers System der mechanisierten Leidenschaft und der statischen Diskurse nicht gewachsen. Ausgerechnet dort, wo Cherubinis sturmgewaltiger Opernton sich revolutionär Bahn bricht, das Drama der Katastrophe zurast, beginnt die Neuproduktion zu schwächeln. Der von Lichtgewittern umzuckte Abgang der Medea wirkt unfertig. Und die Musik? Genial, mehr als nur ein Bindeglied zwischen Gluck und Mozart. Doch Gastdirigent Gabriele Ferro winkt die Musik nur durch und provoziert die Frage, ob einer der Mannheimer Hauskapellmeister das nicht besser gemacht hätte. |
|
Leidenschaften hinter archaischen Masken Mannheimer Ausgrabungen: Achim Freyer inszeniert Luigi Cherubinis Oper "Médée" am Nationaltheater Von Werner Müller-Grimmel Als eine "völlig neue Art von Opernaufführung" bezeichnet der Maler, Bühnenbildner und Regisseur Achim Freyer seine Inszenierung von Luigi Cherubinis Oper "Médée" am Mannheimer Nationaltheater. Allerdings darf man Zweifel an seiner Überzeugung hegen, die Musik werde dadurch dem Publikum näher kommen als bei der Pariser Uraufführung von 1797. Nach der Mannheimer Premiere mischten sich jedenfalls massive Buhrufe in den Beifall, als das Regieteam auf der Bühne erschien. Freyer, der bei dieser Produktion nicht nur für Regie, Bühnenbild und Kostüme, sondern - zusammen mit Andreas Rehfeld - auch für die Lichtgestaltung verantwortlich zeichnet, hält nichts von Aktualisierung oder Deutungen. Sein ganzes Bemühen geht dahin, Motivationen und Zustände möglichst deutlich zu zeigen. Er möchte Cherubinis Oper nicht als Fall für Kriminalisten und Psychologen aufrollen, sondern sieht sie als musikalisch komplexen Kosmos, der keine einfache Lösung für die Katastrophe bereithält. Für die einzelnen Figuren hat Freyer deshalb archaisch wirkende, mit bunten Papierschnipseln beklebte Masken geschaffen, die teils an Totenschädel, teils an ausgehöhlte Riesenfrüchte, wegen ihres Netzüberzugs aber auch an Insektenköpfe denken lassen. Vorn am Bühnenrand stehen auf verschieden hohen Sockeln wie Statuen fantastische, aus Stoffresten gestückelte Kostüme, die von hinten betreten und bespielt werden können. Langsam nähern sich die Protagonisten von der Hinterbühne auf Laufstegen diesen Puppenhüllen, schlüpfen hinein, formen beim Singen mit Armen und Händen stereotype Zeichen und ziehen sich danach ebenso langsam wieder ins Dunkel zurück. Den Chor (vorbildlich einstudiert von William Spaulding) hat Freyer in langer Reihe oberhalb von zwei hohen Seitenwänden postiert. Von dort oben wird das episch-musikalisch referierte Geschehen nicht nur vokal, sondern auch mit weißen Handschuhen gestisch zeremoniell begleitet: eine belebte geometrische Linienkonstellation über permanenten Farbwechseln der Szene. Je fremder eine Figur sei, desto näher könne man ihr rücken, meint Freyer. Das funktioniert bei Cherubinis "Médée" freilich nur, wenn die Musik die Distanz zu den Figuren überbrückt. Gespielt wird in Mannheim nicht die italienische Fassung mit den vom Schubertfreund Franz Lachner erst 1855 nachkomponiertern Rezitativen, sondern die französische Urfassung mit den deutschen Sprechtexten, die Beethovens Librettist Treitschke für eine Wiener Aufführung beigesteuert hat. Vokal überzeugend bewähren sich Caroline Whisnant als kalkweiß maskierte Médée mit einer Medusenfrisur aus geschleuderten schwarzen Haarblitzen, Susan Maclean als deren Vertraute Néris mit kretisch-antiker Brüsteattrappe, Thomas Jesatko als König Créon und Cornelia Ptassek als dessen Tochter Dircé, während John Horton Murray als feiger Karrierist Jason mit verbeultem Cowboyhut und schief hängender Krawatte deutlich mit Intonationsproblemen kämpft. Hauptakteur in diesem musikalisch genialen, von Zeitgenossen wie Beethoven, Spontini, E. T. A. Hoffmann, Spohr, Weber und Meyerbeer ebenso wie später noch von Wagner oder Brahms grenzenlos bewunderten Drama ist ohnehin das Orchester, das Freyer immer dann, wenn Cherubini ihm alleine das Wort erteilt, bedeutungsvoll beleuchtet hochfahren lässt und so in sein ständig changierendes theatralisches Gemälde integriert. Dass in Mannheim der Cherubinikenner Gabriele Ferro am Pult steht, der an der Stuttgarter Oper bereits Cherubinis Requiem c-Moll und die Oper "Anacréon" vorgestellt hat, ist ein Glücksfall. Auch im breiten, akustisch ungünstigen Graben der Mannheimer Oper ist er hier ganz in seinem Element, modelliert den ungeheuer differenzierten, bei aller Klassizität für seine Zeit eminent kühnen, stets originellen Orchestersatz fein. Nach der fulminanten Ausgrabung von Tommaso Traettas "Sofonisba" vor einem Monat hat sich die Mannheimer Oper mit dieser Produktion bereits zum zweiten Mal in kurzer Zeit als überregional bedeutende Spielstätte zu Wort gemeldet. |
|
Barbarin mit züngelndem Haar Von Siegfried Kienzle
Bewusst museal - Medea (Caroline Whisnant) steht maskiert hinter ihrem Kostüm. Foto: Michel MANNHEIM Klassizistisch museal - so wird die Oper "Médée" von Luigi Cherubini abgestempelt. Dieser Schwäche des Werks will Achim Freyer in seiner Mannheimer Inszenierung dadurch begegnen, dass er sie gleich als Museum drapiert. Auf dem Denkmalsockel stehen die barocken Gewänder wie Skulpturen frontal zum Publikum. Die Kostüme sind fassadenhafte Hohlkörper hinter denen die Sänger stehen - nur ihr Kopf mit unförmig hässlichen Masken ist sichtbar. Allein ihre Arme bewegen sich in Zeitlupe, werden anklagend gen Himmel gereckt oder resignierend gesenkt. Freyer ist sein eigener Bühnenbildner und füllt den Raum mit raffinierter Farbdramaturgie: Schwarz für Medea, die Barbarin aus Kolchis, die verstoßen wird und furchtbare Rache übt. Züngelndes Medusenhaar türmt sich über ihrer Maske. Rot für den lebensgierigen Jason, der Medea die Treue bricht, um sich mit der Königstochter Dircé zu vermählen. Er trägt den Strohhut des Hallodri, hat blutrote Augenhöhlen und roten Schlips. Wenig flexibel stemmt sich John Horton Murray heldentenoral durch die Partie. Silberblau ist König Créon vorbehalten - eindrucksvoll gibt Thomas Jesatko dem Herrscher die baritonale Autorität beim Verdammungsurteil. Für seine Tochter Dircé bietet Cornelia Ptassek die schönste Stimme, aber die kleinste Rolle des Abends auf. Wunderbar kantabel führt das Solofagott durch das Trostlied der Néris (Susan Maclean). Mit dem Blick auf die Médée von Caroline Whisnant rückt zugleich die zwiespältige musikalische Konzeption der Aufführung ins Zentrum: Cherubinis "Medea" wurde durch die legendäre Callas in der späteren italienischen Fassung mit nachkomponierten Rezitativen für das heutige Repertoire gewonnen. Gerade im musikalischen Sprechgesang konnte die Callas ihre Gefühlsskala von Wut, Verzweiflung, Liebesflehen einbringen. In Mannheim greift man auf die Pariser Urfassung von 1797 zurück und lässt die Rezitative in deutschen Versen deklamieren. Musikhistorisch mag das korrekt sein, aber in der Wirkung ist es fatal. So wechseln alle Darsteller vom französischen Gesang ins gestelzte deutsche Aufsagetheater, das bei Whisnant mit ihrem Akzent mühsam radebrechend verstärkt wird. Auch im tremolierenden Timbre fehlen emotionale Energie und farbige Nuancen. Seit der Dirigent Gabriele Ferro vor fünf Jahren in Venedig Cherubinis Anakreon-Oper wieder entdeckt hat, gilt er als Cherubini-Spezialist. Obwohl der Komponist in Ouvertüre und dem Vorspiel zum Schlussakt hitzig frühromantisch attackiert, hält Ferro das Orchester auf kammermusikalischer Sparflamme. Zu den Orchesterstücken blendet Freyer den Zuschauerraum mit einer aggressiven Scheinwerferbatterie und demonstriert die Schärfe, die dem Dirigenten abgeht. Herausragend der Chor, der lemurenhaft von einer hohen Wand herabsingt. Heftige Buhs, aber auch Bravos für die Regie, weil sie eine konzertante Wiedergabe abgeliefert hat. Mannheims Schauspiel wird in zwei Wochen mit der archaischen "Medea" von Hans Henny Jahnn hoffentlich eine furiosere Variante liefern. |
|
Schwäbische Zeitung 2. April 2006 "Medea" in Masken Von Martin Roeber Luigi Cherubinis Opernfassung des alten griechischen Medea-Mythos gehört nicht gerade zu den Rennern des Repertoires. Seine 1797 in Paris uraufgeführte "Médée" ist vor allem in der auf CD dokumentierten Interpretation durch Maria Callas zum Mythos für Opernfreaks geworden. Wenn aber ein Regiemeister wie Achim Freyer sich des Stückes annimmt, dann stößt das natürlich nicht nur bei Kritikern auf überregionales Interesse. Freyers Inszenierung, die am Freitagabend im Mannheimer Nationaltheater ihre umjubelte Premiere hatte, liefert vor allem viel Stoff für Diskussionen. Medea, die Jason zum goldenen Vlies verholfen und ihm zwei Kinder geboren hat, wird von diesem in Korinth zu Gunsten der Königstochter Kreusa (bei Cherubini Dircé) verstoßen. Hin und her gerissen zwischen Liebe zur Familie und Rache tötet sie schließlich die Nebenbuhlerin und die eigenen Kinder. Wenig theatralische Dynamik Eigentlich Stoff für eine hochdramatische, aktionsreiche Oper. Cherubini verzichtet aber fast völlig auf Aktion. Seine Personen "agieren" nicht, sie "musizieren", kommentieren und reflektieren im Gesang die Ungeheuerlichkeit des Vorgangs. Achim Freyer (Selbstauskunft: "Theater ist mein Hobby, Malerei mein Beruf.") setzt noch einen drauf. Auch er verzichtet völlig auf theatralische Dynamik. Seine Begründung: "Aktionismus, Hampeln auf der Bühne, das ist überflüssig." Die Solisten hat er mit urtümlichen Masken ausgestattet. Selbst eine mimische "Aktion" ist damit ausgeschlossen. Gesungen wird von der Bühnenrampe aus, auf Podesten stehend. König Créon trägt eine blaue stilisierte Krone und steht auf dem höchsten Podest. Jason ist mit Hut und Schlips gekleidet: Vorsicht, Macho! Und Médées Kopf ist von wildem Haar umkränzt. Freyer, der auch für Bühne, Kostüme und die ausgeklügelte Lichtregie verantwortlich zeichnet, gibt der Fantasie der Zuschauer eine Fülle von Anregungen zum Weiterdenken. Damit schafft er Freiräume für die Entfaltung der musikalischen Dramatik. Und da hat Luigi Cherubini einiges zu bieten. Kampf gegen Mythos Maria Callas Kein Wunder, dass Kollegen wie Beethoven, Haydn und Brahms ihn in den höchsten Tönen lobten. Dirigent Gabriele Ferro und das Orchester des Nationaltheaters knieten sich mit Engagement und Elan in die dramatisch-aufgewühlte Seelenmusik des Italieners. Der Chor und das Solistenensemble schlugen sich wacker durch die Klippen der stellenweise heiklen Partitur. Vor allem Caroline Whisnant als dramatischer Sopran in der Titelrolle verdient ein Sonderlob. Heroisch kämpft sie gegen den "Mythos Maria Callas" und erreicht nach anfänglichen Schwierigkeiten eine ganz eigene, menschlich anrührende Interpretation der facettenreichen Partie. Am Schluss gab es Jubel für alle Mitwirkenden, durchsetzt mit kräftigen Buhs, die den Beifall wiederum anheizten. (dpa) |
|
Kultur 158, Mai 2006 Nähe durch Distanz Der zeitlos aktuelle Mythos von der kolchischen Priesterin Medea und dem Eroberer Jason, der ihr die Treue bricht, um im heimischen Korinth die Tochter des Königs Kreon zu heiraten, worauf Medea sich grausam rächt, indem sie die beiden gemeinsamen Kinder und die Nebenbuhlerin tötet - diese schon in der griechischen und römischen Antike mehrfach (unter anderem von Euripides und später von Seneca) für das Theater adaptierte Geschichte einer zwischen Mutterliebe und Eifersucht zerrissenen Frau hat Komponisten immer wieder zu musikdramatischer Gestaltung gereizt. Bereits im 17. Jahrhundert wurde sie unter anderem von Cavalli und Charpentier veropert. Zu den bedeutendsten späteren Vertonungen des Stoffs für Konzertsaal oder Bühne zählen Bendas Melodram "Medea" (1775), Mayrs "Medea in Corinto" (1813) und Milhauds "Médée" (1939). Aus jüngster Zeit sind Dusapins "Medeamaterial" (1992) nach Heiner Müller, Liebermanns "Freispruch für Medea" (1995) und Hans Thomallas soeben in Stuttgart uraufgeführtes Musiktheater "fremd" zu nennen. Eine "zentrale" Stellung unter sämtlichen Medea-Stücken der vierhundertjährigen Operngeschichte nimmt nicht nur in chronologischer Hinsicht Luigi Cherubinis "Médée" von 1797 ein. Ihr war von allen auch die bislang nachhaltigste Rezeption vergönnt. Obwohl die Uraufführung im revolutionären Paris eher lau aufgenommen wurde (der pessimistische Schluß paßte schlecht zu opportunen Freiheitshymnen damals gängiger Rettungsopern), kam diese Opéra comique (der Begriff steht für ein - hier freilich jeder Komik entbehrendes - Singspiel mit französischen Sprechdialogen) bald in ganz Europa auf die Bühne und konnte sich selbst nach Cherubinis Tod noch Jahrzehnte im Repertoire halten. Da man die gesprochenen Teile des Librettos von Francois-Benoit Hoffmann mittlerweile als veraltet empfand, wurden sie stillschweigend durch Rezitative ersetzt. Am Mannheimer Nationaltheater hat nun der Maler, Bühnenbildner und Regisseur Achim Freyer mit seiner Inszenierung von Cherubinis "Médée" eine "völlig neue Art von Opernaufführung" intendiert, die er als "ganz eigene Form von Musiktheater" versteht, auch wenn man Zweifel an seiner Überzeugung hegen darf, die Musik werde dadurch dem Publikum näherkommen als einst bei der Uraufführung. Nach der Premiere der Neuproduktion mischten sich jedenfalls massive Buhrufe in den Beifall, sobald der ehemalige Brecht-Schüler auf der Bühne erschien. Freyer, der hier nicht nur wie schon des öfteren für Regie, Bühnenbild und Kostüme, sondern - zusammen mit Andreas Rehfeld - auch für die Lichtgestaltung verantwortlich zeichnet, hält nichts von einer Aktualisierung und schon gar nichts von Erklärungen oder Deutungen. Sein ganzes Bemühen geht dahin, im Theater keine Antworten zu geben, sondern Motivationen und Zustände möglichst deutlich zu zeigen (eine dreibändige Dokumentation über seine kompletten Bühnenarbeiten ist jetzt beim Alexander-Verlag Berlin erschienen). Cherubinis Oper möchte Freyer nicht als Fall für Kriminalisten und Psychologen aufrollen, denn er sieht in ihr einen musikalisch komplexen Kosmos, der keine einfache Lösung für die Katastrophe bereithält. Für die einzelnen Figuren hat er deshalb archaisch wirkende, mit bunten Paperschnipseln beklebte Masken geschaffen, die teils an Totenschädel, teils an ausgehöhlte Riesenfrüchte, we gen ihres Netzüberzugs aber auch an Insektenköpfe denken lassen. Vorn am Bühnenrand stehen auf verschieden hohen Sockeln wie Statuen phantastisch aus Stoff resten gestückelte Kostüme, die von hinten betreten und bespielt werden können. Langsam nähern sich die Protagonisten von der Hinterbühne auf Laufstegen diesen Hüllen, schlüpfen hinein, formen beim Singen wie Puppen mit Armen und Händen stereotype Zeichen und ziehen sich danach ebenso langsam wieder ins Dunkel zurück. Noch marionettenhafter wirken im dritten Akt hinzukommende gipserne Modelle der beiden im Ehestreit instrumentalisierten Kinder mit automatisch bewegten Ärmchen und Köpfen, die beim Mord plötzlich abfallen, worauf sich gräßliche Blutbahnen über die Rümpfe ergießen. Den Chor (vorbildlich einstudiert von William Spaulding, aber nicht immmer der dramatischen Wucht von Cherubinis Partitur gewachsen) hat Freyer in langer Reihe oberhalb von zwei hohen Seitenwänden po stiert, die sich nach hinten keilförmig wie ein Schiffsbug verengen. Von dort oben wird das episch-musikalisch referierte Geschehen nicht nur vokal, sondern auch mit weißen Handschuhen gestisch in Zeitlupe kommentiert - eine belebte geometrische Linienkonstellation über permanenten, meist unmerklichen Farbwechseln der stets in magisches Licht getauchten Szene. Gegen Ende ergänzen gelegentlich Feuerblitze und brennende Fackeln das seltsam-eindrucksvolle Zeremoniell bewegter Skulpturen. Je fremder eine Figur sei, desto näher könne man ihr rücken, meint Freyer. Das funktioniert bei Cherubinis "Médée" freilich nur, wenn die Musik die Distanz zu den Figuren überbrückt. Gespielt wird in Mannheim nicht die italienische Fassung mit den vom Schubert-Freund und späteren Münchner Hofkapellmeister Franz Lachner posthum erst 1855 nachkomponierten Rezitativen, die noch bis 1909 gespielt und von Maria Callas in der Titelrolle unter dem damaligen Newcomer Leonard Bernstein 1953 an der Mailänder Scala fulminant wiederbelebt wurde, sondern die hörbarer am Geist der Pariser Tragédie lyrique von Komponisten wie Rameau, Gluck und Salieri orientierte französische Urfassung. Die originalen Sprechtexte werden allerdings in einer deutschen, einst für die Wiener Erstaufführung entstandenen Übersetzung von Beethovens Librettist Treitschke deklamiert. Ihr dichterisch gehobener Ton kommt Freyers Absicht entgegen, eine Fallhöhe zwischen Musik und falscher sprachlicher Nähe zum Mythos zu vermeiden. Vokal überzeugend bewähren sich Caroline Whisnant als kalkweiß maskierte Médée mit einer Medusenfrisur aus geschleuderten schwarzen Haarblitzen, Susan Maclean als deren Vertraute Néris mit kretisch-antiker Brüsteattrappe (besonders im zauberhaften Ariendialog mit einem Solo-Fagott) sowie Thomas Jesatko als König Créon und Cornelia Ptassek als dessen Tochter Dircé, während John Horton Murray als feiger Karrierist Jason mit verbeultem Cowboy-Hut und schief hängender Krawatte deutlich mit Intonationsproblemen kämpft und der anspruchsvollen Rolle stimmlich nicht gewachsen ist. Hauptakteur in diesem musikalisch genialen, von jüngeren Kollegen Cherubinis wie Beethoven, Spontini, E.T.A. Hoffmann, Spohr, Weber, Meyerbeer und Halévy ebenso wie später noch von Wagner oder Brahms grenzenlos bewunderten Drama ist ohnehin das Orchester, das Freyer immer dann, wenn es alleine das "Wort" hat, bedeutungsvoll beleuchtet hochfahren läßt und so in sein ständig changierendes theatralisches Gemälde integriert. Daß in Mannheim der Cherubini-Kenner Gabriele Ferro am Pult steht, der an der Stuttgarter Oper als deren ehemaliger Generalmusikdirektor bereits das berühmte "Requiem" c-Moll und die Oper "Anacréon" vorgestellt hat, ist ein Glücksfall. Auch im breiten, akustisch ungünstigen Graben der Mannheimer Oper ist er hier in seinem Element. Fein modelliert er den ungeheuer differenzierten, vielgestaltigen, bei aller Klassizität für seine Zeit eminent kühnen, vom Sturm und Drang in romantische Zukunft aufbrechenden Orchestersatz, dessen originelle, unter Kennern immer schon als Geheimtip geltende Qualitäten (Raumwirkungen, dramatische Pausen, unerwartete harmonische Verläufe, raffinierte, zuweilen effektvoll reduzierte Instrumentation, drastische Gegensätze von rasendem Furor, lieblicher Idylle und geheimnisvoll düsterem Grollen) einst selbst bei Berlioz, der Cherubini zeitlebens abhold war, weil jener ihm die Aufnahme ans Pariser Conservatoire verwehrt hatte, nicht auf taube Ohren stießen. Nach der verdienstvollen Ausgrabung von Tommaso Traettas bedeutender "Sofonisba" vor einem Monat hat sich die Mannheimer Oper mit dieser Produktion bereits zum zweiten Mal in kurzer Zeit als überregional bedeutende Spielstätte zu Wort gemeldet. Werner M. Grimmel |