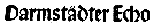|
Viel Zeit, viel Mitleid VON HANS-KLAUS JUNGHEINRICH Tja, der erste Akt des Parsifal! Natürlich gibt es in diesem Bühnenspiel noch ganz andere interessante Mysterien. Doch ein unter Opern-Insidern gerne berätseltes Mysterium im Mysterium ist die Frage, wie lange dieser Akt bei den berühmten Dirigenten denn so dauere. Beim frühen Boulez anderthalb Stunden, bei Toscanini gut zwei. Kurios der Fall Michael Gielen: Eigentlich einer von der schnellen Truppe, versuchte dieser Toscanini-Fan seinem Idol nachzueifern, schaffte aber bei aller Bemühung um Gravität nur gerade eben eins fünfundvierzig. So etwa auch die Dauer beim gereiften Boulez des ersten Bayreuther Schlingensief-Jahres 2004, so dass man registrierte: typisch Altersstil. Umso überraschender ein Jahr später, wie der dann noch reifere Boulez dann doch wieder mehr zu seiner jugendlich drahtigen Anderthalbstündigkeit hindriftete. Paolo Carignani stellt sich der Aufgabe des Ruhe Bewahrens Ach, wie entzücken den Wagnerkenner und Dirigenten-Charakterologen solche Zeitbeobachtungsspiele. Der Parsifal-Kopfakt bietet sich dafür durch eine exorbitante Länge an, die freilich noch um etliches hinter den Formaten des ersten Götterdämmerungs- und des finalen Meistersinger-Aktes zurückbleibt. Doch beim ersten Parsifal-Aufzug, dem gnadenlosen Sitzfleischprüfer, gibt es die berühmt-berüchtigte Gurnemanz-Erzählung, den Gottseibeiuns aller an Action Fixierten. Und überhaupt kommt's nur zu einem Minimum von Handlung. Eher stellt sich der exaltierte Wagner das Problem, wie man einen Eindruck von raummusikalischer Großarchitektur herstellen kann durch raffinierte Dehnung und Erfüllung von Zeit. Baumaterial dieses ins Riesige ragenden Zeit-Doms ist also eine vielfältig modellierte und modifizierte Langsamkeit. Dass ausgerechnet der Virtuose Toscanini hier als unerreichter Zelebrant von Langsamkeit figurierte, ist bezeichnend für den Parsifal-Stil, der fast gänzlich die Neurasthenien der Tristan-Musik abgestreift hat. Paolo Carignani, der Maestro des neuen Frankfurter Parsifal, ist sich dessen genau bewusst, und er stellt sich der Aufgabe "Ruhe bewahren!" mit Mut und Hingabe. So gestaltet er das erste Orchestervorspiel mit der rituellen Bedächtigkeit, die fürs Ganze ein minuziös umsichtiges Sezieren in liturgischer Zeitlupe verheißt. Dazu kommt's dann aber doch nicht, weil mit dem Einsatz der Vokalstimmen eine andere Dynamik greift - die der atmenden Zusammenhänge und des sinnvollen Textvollzugs etwa. Auch meidet Carignani mit guten interpretatorischen Gründen die pathetischen Wallungen und Ausbremsungen eines Knappertsbusch. Somit kommt auch er im legendären ersten Akt gerade eben mal auf eins fünfundvierzig, und das ist ziemlich genau die aus der Differenz der Extreme sich ergebene Durchschnittslänge! Derlei wird bei ihm aber nicht hergestellt durch einen gemütlichen Einheitsfluss, sondern eher mit Stückelungen, die winzige Tempoveränderungen stärker als sonst ausspreizen. Schon im Vorspiel evozieren ja die kleinen, unterteilenden Dirigierbewegungen weniger formende Genauigkeit des breit ausladenden Erzählens als ein oft nachgebendes, zu Rubato neigendes und in den Konturen mitunter unscharf verfließendes Flimmern. Eindringlich geht's vor allem da vonstatten, wo Gesang waltet, also beim großen Duett Kundry/Parsifal im Mittelakt mit exzellierenden Farbabtönungen. Das klang wirklich enorm, auch im "sprechenden" Orchesterduktus. Überhaupt präsentiert Carignani einen viel "schöneren" Parsifal als etwa Gielen, und manchmal wird des wundersamen Blühens und der balsamischen Mildtätigkeit sogar zuviel verabreicht wie in den streicherseligen Piano-Wundern des dritten Vorspiels, das die Schilderung wüsten und einödischen Irrens nachgerade gänzlich eingebüßt hat. Klarer schien das szenische Konzept verwirklicht. Christof Nel war am Hause von Bernd Loebe berufen, die ganz großen Brummer (Tristan, Frau ohne Schatten) zu inszenieren. Im Parsifal hat er nun sein Meisterstück gegeben. Eine Interpretation, die, kühn jüngere Traditionen verlassend, die Rezeption der Weihe- und Erziehungsoper in Neuland vorantreibt. Und dabei auf ein äußerst wichtiges, aber oft vernachlässigtes Grundmotiv Wagners rekurriert: auf die Reaktivierung und Restituierung des Mitleids. Nicht vergessen, aber fürs erste beiseite gelegt ist mithin die Gralsgemeinschaft als faschistoider Männerbund. In Nels Ritterschaft herrschen allerwegen Mitleid und Zuwendung in vielen auffälligen Details, nicht zuletzt bei der sorgenden Pflege um den moribunden Schmerzensmann Amfortas. Dabei geht es durchaus aber auch etwas undurchsichtig und geheimnisvoll zu. Ein kollektives Trippeln und Rennen gemahnt an ein Trainingslager. Und am Ende des ersten Aktes formieren sich die Mannen lanzenbewehrt kriegerisch zum Aufbruch. Das alles geschieht hinter bühnenhohen Bretterzäunen, die eher an ein Camp denken lassen als an massive Burgarchitektur. In ruhevollem Rhythmus gleitet das wuchtige Brettergefüge drehbühnenbewegt an den Blicken vorbei, und lange bleibt der an diesem von Jens Kilian visualisierten Wandgeheimnis und seinen Lichtlücken haften, bis sich mit überraschender Plötzlichkeit ganz neue Raumbilder eröffnen, etwa der weißgedeckte Quadrattisch, an dem Titurel und Amfortas finster einander gegenüber sitzen oder, im Schlussakt, der aufgestellte Katafalk mit dem toten Altkönig und den feindselig ihre Speere wider den unwillig todeswunden Amfortas ausstreckenden Gralsmännern. Nicht alles kann Nel taufrisch neu erzählen, aber Entscheidendes. So im zweiten Akt, nach dem putzigen Bordell mit den flugs aus einer grauen Reinigungskolonne zu rötlichen Grisetten mutierenden Blumenmädchen, den Verführungsversuch, hier als pas des trois mit dem Kundry zunächst wie eine Puppe manipulierenden Klingsor. So auch den ergreifend durch eine Gruppe von jugendlichen Frühlingsmenschen imaginierten Karfreitagszauber. Und vor allem den Opernschluss, deutlich markiert als "ökumenischer" Exodus des den Gral vor sich in alle Welt hintragenden König Parsifal, dem die Gemeinschaft zögernd folgt. Mitleid, eine auch ins Freie und Weite wollende Kraft. Authentische Raumklangwirkungeines großen Werks Auch sängerdarstellerisch hatte der spannende Abend eine gute Fasson. Stuart Skelton, schauspielerisch auf weite Strecken zum gutmütig-tolpatschigen Toren hingelenkt, unterstrich mit nicht sehr großer Stimme die lyrischen Facetten mehr als bramarbasierendes Heldischtun. Michaela Schusters etwas uneinheitliches Timbre maß sich der Zwittrigkeit der Rolle an und blieb bei den expressiven Ausbrüchen (Schluss 2. Akt) keineswegs ängstlich in der Reserve. Jan-Hendrik Rootering, zyklopisch von Gestalt und Stimme, hatte zumal im dritten Akt die sanftmütige Wildheit eines Auerochsen. Alexander Marco-Buhrmesters Amfortas zog alle Register fiebrigen Sündenpfuhlleidens, ohne die kultivierte Bariton-Contenance ausspracht zu lassen. Charakteristisch getroffen auch Titurel (Magnus Baldvinsson) und Klingsor (Paul Gay). Mit den groß besetzten Chören und dem somnambulen Altsolo (Bockyoung Kim) erzielte Carignani auch authentische Raumklangwirkung. Eine insgesamt wuchtige Aufführung, die mit dem Bayreuther Schlingensief/Boulez-Ereignis als neuerlicher Durchbruch für ein die Geister herausforderndes Werk unbedingt mithalten kann. [ document info ] Dokument erstellt am 24.04.2006 um 16:30:43 Uhr Erscheinungsdatum 25.04.2006 |
|
DER TAGESSPIEGEL In geheimer Mission Von Christine Lemke-Matwey Früher oder später ist jeder Regisseur reif für Wagners „Parsifal". Früher oder später wollen sich alle an der pseudochristlichen Waberlohe des Bühnenweihfestspiels erhitzen, an seinem leitmotivischen Rätselraunen – und der bahnbrechenden Verlogenheit der Menschheitserlösungsmystik à la Schopenhauer auf den Grund gehen. Und fast alle scheitern, notgedrungen. Ob Bernd Eichinger an der Berliner Lindenoper zu einem fragwürdigen „Ich lese, was da steht"-Werktreue-Begriff Zuflucht nimmt, ob Christoph Schlingensief die Bayreuther Bühne mit allem Mythenmüll der Welt vollstopft, oder ob Kundry bei Peter Konwitschny in München gegen die geballte Misogynie des Stücks aufstehen darf: Diese Oper schafft uns mehr als alle anderen. Wenn Christof Nel und sein Bühnenbildner Jens Kilian jetzt in Frankfurt an der Seite von Generalmusikdirektor Paolo Carignani zum Versuch ansetzen, treten sie in große Fußstapfen. Denn wem wären hier nicht noch Ruth Berghaus, Axel Manthey und Michael Gielen präsent, ihre grandios-zeichenhafte Recherche in Sachen Erlösung versus Erotik. Natürlich hinkt dieser Vergleich: Zwischen den beiden Aufführungen liegen über 20 Jahre – und Carignani ist Italiener. Man muss nicht bis zu Toscanini zurückgehen, um zu ahnen, was das heißt: Leiden (mitleiden?) in Echtzeit, Wundenlecken und rituelle Gralsspeisung, als würd’s nicht gezeigt, sondern getan. Qualvollst langsame, stockende, nicht selten ersterbende Tempi also, gerade in den nie enden wollenden Rekapitulationen des ersten Aktes wie im finalen Enthüllungsgeschehen des dritten: Jan-Hendrik Rooterings Gurnemanz widmet sich seines Amtes mit langem Bass-Atem, ohne allerdings gewissen Eintönigkeiten im Ausdruck zu entgehen. Gern gibt sich auch der Klang des Frankfurter Museumsorchesters entkernt, leichenfahl, programmatisch ausgezehrt. Der Zuhörer aber merkt die Absicht und ist verstimmt: Die Gralsgesellschaft, sie siecht dahin, längst ein Reich der untoten Heiligen, ein in Selbstmitleid (!) ertrinkendes, mümmelndes Männerhospiz. Die Aufwallungen (echter? falscher?) Leidenschaft, die Carignani im zweiten Akt den hinreißend frisch agierenden Mohnblumenmädchen (Kostüme: Ilse Welter) nebst Kundry angedeihen lässt, vermögen dagegen nicht allzu viel auszurichten. Oder ist’s Konzept, dass das eine unberührbar neben dem anderen steht, die weibliche Venus-Falle neben dem gralsritterlichen Speer, vor allem: der überreich glitzernde chromatische Wohllaut der Partitur von 1882, ihr Streben hin zu einer „Emanzipation der Dissonanz", neben den martialisch glockengeschwängerten Crescendi des Jüngsten Gerichts? Christof Nel legt diese Vermutung nahe, wenn er Kundry an Parsifals Erkennen im Kuss jämmerlich zerbrechen lässt. Nel hat – das zeigen seine Frankfurter „Salome" oder seine „Frau ohne Schatten" – eine stark psychoanalytische Schlagseite. Diese freilich kommt hier nur bedingt zum Tragen. Bei Kundry, die ganz vom Verstummen im dritten Akt her gelesen wird und im zweiten als Marionette Klingsors herhalten muss, um letztlich als autistisches Bündel an der Rampe zu landen (beredt, bisweilen in der Tongebung fast zu spröde: Michaela Schuster). Bei Parsifal, der in einem Pas de deux mit dem erlegten Schwan wie auch während der ersten Gralsspeisung sehr wohl begreift, im Grunde also ein Opfer von Gurnemanz’ Selbstgerechtigkeit wird (konditionsstark, höhensicher: Stuart Skelton). Und auch was das freudianische Verhältnis Titurel / Amfortas betrifft: Das ist der Vater in Wagnermaske (Markus Baldvinsson), der den Sohn (Alexander Marco-Buhrmester) regungslos weiter in den Schmerz treibt. Der Rest des lang und länger sich reckenden Abends liefert erschreckend viel Wörtliches: Der Gral ist ein silberner Kelch, das Abendmahl zitiert Leonardo da Vinci, und der Damenchor singt aus dem dritten Rang. Jens Kilian hat einen Raum geschaffen, der das Dilemma – unfreiwillig oder nicht – präzise auf den Punkt bringt: In immer neuen Kreis- und Schlangenlinien dreht sich ein riesighoher Lattenzaun. Eine Trutzburg, ein geheimdienstliches Verlies. Mal sieht man nur Schatten huschen und kaltes Neon blitzen, mal wird der Blick freigegeben: auf eine gähnend leere, finstere Mitte, das fehlende Herz. Hier weiß niemand mehr, wo das Heil wohnt und was all die Rituale bedeuten. Weitermachen, lautet die Devise. Bis endgültig nichts mehr geht. |
|
Die Welt ist ein Mahlwerk: "Parsifal" in Frankfurt von Uwe Wittstock "Die Bestimmung der deutschen Literatur", schrieb der Frühromantiker Friedrich Schlegel, sei es, "durch Universalität zur Religion zur gelangen". In einer Zeit, in der das Vertrauen zur christlichen Heilslehre brüchiger wurde, gehörte es für ihn zu den Aufgaben der Poesie, eine Kunstreligion zu errichten, die als neues Fundament der Glaubens dienen konnte. Wie kein anderer hat der Spätromantiker Richard Wagner mit diesem ästhetischen Programm ernst gemacht und ist so zum wohl deutschesten Künstler seiner Zeit geworden. Und in keiner seiner Opern folgte er jenem Programm so entschlossen wie im "Parsifal". Fast termingerecht, nur gut eine Woche nach Karfreitag, hatte Wagners "Bühnenweihfestspiel" jetzt unter der Regie von Christoph Nel an der Frankfurter Oper Premiere. Doch die Inszenierung wird nicht vom Regisseur, sondern weitgehend vom Bühnenbild Jens Kilians bestimmt. Eine gigantische Trommel aus schwarzen, schmalen, hohen Stelen dreht sich auf der Spielfläche langsam wie ein alles beherrschender, alles erdrückender Mühlstein. Meist gewährt die kreisende Stelenwand den Figuren als Existenzraum lediglich einen schmalen, ständig vom Absturz in die Finsternis (des Orchestergrabens) begrenzten Streifen am vordersten Bühnenrand. Das Leben: die minimale Spanne vor dem unaufhaltsamen Zermahlenwerden. Nur zu verständlich, wenn in dieser Mahlwerk-Welt die Sehnsucht nach Erlösung zu der Achse wird, um die sich alles dreht. Sobald von ihr die Rede ist, öffnet sich die Stelentrommel und gibt tiefe Räume frei. Wagner hat Parsifal zum Heiland seiner Kunstreligion stilisiert, der die Wunden der Menschheit zu schließen vermag. Der Australier Stuart Skelton spielt ihn zu Anfang mit einer obelixhaften Tumbheit, später als triumphalen Siegfried. Was so falsch nicht ist, da Parsifal als "reiner Tor" unter die Gralsritter tritt - denen der Gral durch "heil'ge Speisung" wie ein Zaubertrank besondere Kräfte verleiht. Der Höhepunkt der Frankfurter Inszenierung ist die Verführungsszene zwischen Kundry (Michaele Schuster) und Parsifal. Christoph Nel gibt ihr, anders als Wagner, nicht mythologische, sondern psychologische Dimensionen. Er läßt Kundry zunächst wie eine Bauchrednerpuppe auf dem Schoß des Teufels Klingsor (Paul Gay) sitzen. Klingsor führt ihr beim Liebeswerben um Parsifal die Arme, er dirigiert sie wie eine Marionette, und Gay verleiht ihm ein dazu passendes zuhälterhaftes Lächeln. Doch mehr und mehr erwacht in Kundry echte Leidenschaft für Parsifal, sie tritt aus ihrer puppenhaften Steifheit heraus, und es ist großartig zu beobachten, wie Gays Klingsor hin- und hergerissen wird zwischen der Hoffnung auf Parsifals Niederlage und der Eifersucht auf die erregten Gefühle Kundrys. Um irgendeinen Makel an den Qualitäten des Frankfurter Orchesters zu entdecken, bräuchte es bessere Ohren als die meinen. Paolo Carignani hat es auf einen wunderbar zarten, wahrhaft verklärenden Ton eingestimmt. Nicht nur die genannten Sänger, auch Alexander Marco-Buhrmester als Amfortas und Jan-Hendrik Rootering als Gurnemanz sind eindrucksvoll. |
|
Kein Ankommen, keine Antworten Christof Nel inszeniert Richard Wagners "Parsifal" an der Oper Frankfurt Von Götz Thieme Landschaft mit entfernten Verwandten: Vor kreisender Lattenwand, durch deren Ritzen Lichter, Schemen, Aussichten auf tiefste Räume blitzen, tappt einer. Ist es nicht Gurnemanz, der, die Haare kinnlang, schon immer die Geschichte von Klingsor erzählt hat? Und dort hinten die matten Ritter, sind es nicht die Monsalvat-Helden? Lange zur Opernfamilie auch gehört Amfortas, der, den Wundverband um den Bauch gewickelt, angeschleppt wird, ein siecher Gralskönig. Verwandt sind einem die Gestalten, doch fremd, immer fern. Richard Wagners Rätselwerk, der "Parsifal": heilige Messe, Lustgrottenthriller, Karfreitagswunder. Szenische Lösungen bleiben vorläufig - aufgehoben ist alles in der Musik. Christof Nel, wahrlich kein dekorativer Regisseur, hat in Frankfurt nicht versucht zu zeigen, was unschaubar ist. Erstaunlich geradeheraus, mit genauem Blick auf den musikalischen und den Libretto-Text, erzählt er von Elend und Erlösung, vom Laster der Lust - und dreht sich dabei stets im Kreise, linksherum. Die Doppeldrehbühne der Frankfurter Oper, mit 38 Metern Durchmesser die größte Europas, ist fast Markenzeichen der Intendanz von Bernd Loebe: die Regisseure nutzen sie extensiv und häufig. Nicht immer gelingen ihnen schöne Durchblicke wie in dem von Jens Kilian gestalteten "Parsifal"-Grundriss, einem grauschwarzen Bretterzaunrund, durch das eine breite Schneise geschlagen ist, die wiederum im Kreis einer kleineren Drehbühne mündet. Nicht immer gehen die szenischen Lösungen mit der Musik zusammen. Den Choralgesang "Nehmet vom Brot" am Ende des ersten Aktes singen die Ritter in einer Reihe rampennah vor der Zaunwand: weniger ideal für die Verblendung der Stimmen kann eine Aufstellung nicht sein. Nels Stärke liegt bei der Zeichnung der Protagonisten, scheitert aber am sich der Individualisierung widersetzenden Gurnemanz-Sänger Jan-Hendrik Rootering, der routiniert, wenig bewegt und bewegend agiert und singt. Sein verquollener Bass verliert bereits in leichter Höhe Klang und Volumen, die Ds im Karfreitagszauber wackeln und verdünnisieren sich in unzauberischer Karfreitagswunderbeschwörung. Nel setzt ganz auf sein junges Quartett, die Gegenspieler Kundry und Parsifal, Amfortas und Klingsor. Im Zentrum des Abends Michaela Schusters "Höllenrose", die Wanderin zwischen den Welten, die hier wie aus der Geschichte gepurzelt aus dem Omatäschchen Balsam fummelt, um den Königswundbrand zu lindern. Ihr ist alles wissende Verwunderung, verlegener Eigensinn. Hoch aufgerichtet sitzt sie an der linken Seite und sieht vor ihrem inneren Auge wohl Schauerliches. In Schusters Miene, den schimmernd-traurigen Augen liest man alles, was sie singend verschweigt: Müdigkeit vom ewigen Weg, Sehnen und Erlösungshoffnung. Das zieht sich in einem die Kehle zuschnürenden Augenblick zusammen, wenn sie, alt geworden, vor dem zurückgekehrten Parsifal kniet, den Gurnemanz tauft und salbt. Wie ein kleines Kind schaut sie zum Speerbringer auf, nestelt an ihrem Kleid: ich auch, ich auch, Erlösung, schreit der stumme Körper. "Liebe - Glaube -: Hoffen?", Christof Nel hat das Fragezeichen in Wagners Satz inszeniert: "Es gibt kein Ankommen. Suche heißt der Weg. Eine Antwort auf die Frage nach dem Ende der Leiden existiert nicht." Am Ende schwankt Parsifal, trotz hell erblondeter Dürer-Locken ein früh resignierter Jüngling, den Gralskelch hoch erhoben, den Rittern einsam davon. Stuart Skeltons kraftvoller, aber noch etwas unsteter, im Forte entkernter Tenor passt zu diesem taumelnden Toren, der wissend, allzu wissend geworden ist. Amfortas, von Alexander Marco-Buhrmester fabelhaft sicher, aber wenig schmerzzerrissen gesungen, hat sich inzwischen ermattet die Wunde mit dem wieder erlangten Schwert schließen lassen. Paul Gay gibt dem Klingsor junge stimmstarke Figur, Abgründiges liegt noch außerhalb der Möglichkeiten des Rollendebütanten. Aber als schattenhafter Kundry-Lenker wird er zum hoffmannschen Coppelius: zu Beginn der Szene mit Parsifal führt er der auf seinem Schoss sitzenden widerwilligen Verführerin lockend die Arme - eine brillante, zwingende Idee. Die Inszenierung hätte durch eindringlichere musikalische Spannungsschübe aus dem Graben sicherlich gewonnen. Das bestens disponierte Frankfurter Museumsorchester bekam vom GMD Paolo Carignani wenig die Erzählstrecken überwölbende Tragkraft, fast wirkungslos die dramatischen Aufgipfelungen der Verwandlungsmusiken - symptomatisch für den stimmungsmatten Abend die monochrom flachen Glocken: da ist man inzwischen klangreicheres Getön gewöhnt. |
|
Hinter Gittern Selbst ein Bühnenweihfestspiel ist nicht gefeit gegen profane Nöte: Finanzknappheit zwang die Frankfurter Oper vor zwei Jahren dazu, die geplante Neuinszenierung von Richard Wagners "Parsifal" zu verschieben und das Werk bloss konzertant aufzuführen. Jetzt ist die szenische Realisation zustande gekommen - eine "Parsifal"-Deutung, die sich betont nüchtern gibt und optisch wie musikalisch auf klare Strukturen setzt. Konkret gezeigt wird zunächst, dass die Handlung in einer abgeschlossenen Welt spielt, zu der die Frauen keinen Zutritt hatten. Während des Vorspiels zieht eine Gruppe von Männern aus dem Zuschauerraum Richtung Bühne, die Frauen bleiben nach Umarmungen winkend zurück. Jens Kilian hat um die Bühne einen riesigen schwarzen Bretterzaun errichtet, der sich bald schneller, bald langsamer dreht und zwischendurch immer wieder zum Stehen kommt, während sich der Raum in die Tiefe öffnet. So genutzt, ist die Drehbühne mehr als ein Mechanismus. Zum einen nimmt sie den Rhythmus der Musik auf, zum andern macht sie anschaulich, wie die Welt der Gralsritter hermetisch in sich selber kreist. Ob von Parsifal ein Neubeginn zu erwarten ist? Wohin er am Ende, als Nachfolger des Amfortas, mit der Gralsschale schreitet, bleibt offen. Schwarz-Weiss-Kontrast Bühne und Kostüme (Ilse Welter) werden von hartem Schwarz-Weiss-Kontrast bestimmt. Gedämpfte Farbtöne sind der büssenden Kundry und Gurnemanz vorbehalten, feurig rot leuchten die grotesk aufgebauschten Kleider der Blumenmädchen. Wo Natur sichtbar wird - mit den Frauen, Kindern und Sträusschen auf der Blumenwiese -, wirkt sie wie eine Traumvision. Ganz anders als Hans Hollmann in seiner jüngst wieder aufgenommenen, nebulös stilisierten Zürcher Inszenierung setzt Christof Nel die Handlung bildhaft konkret in Szene, mit Gralsschale, langer Abendmahlstafel, sterbendem (menschlichem) Schwan, blutendem Amfortas und kämpfenden Riesen im Klingsor-Schloss. In aller Deutlichkeit gezeigt wird dabei - dies ist die zweite Konstante in Nels Inszenierung -, dass die Gralswelt entgegen den Aussagen von Gurnemanz durchaus von Gewalt bestimmt ist und dass diese immer wieder auf Kundry zielt, die als Büsserin von den Knappen bedrängt, als Verführerin von ihrem Meister Klingsor gelenkt wird und schliesslich stirbt. Am Entwurf des Rollenbildes dürfte die Psychologin Martina Jochem wesentlichen Anteil gehabt haben, doch seine vielschichtige plastische Ausgestaltung ist das Verdienst der darstellerisch und stimmlich gleichermassen intensiven Michaela Schuster. Der Regisseur erzählt in kontinuierlichem, spannungsvollem Fluss. Einzig Parsifals Einzug im Klingsor-Reich fällt unnötig hürdenreich aus. Doch vor allem versteht sich Nel auf die Vergegenwärtigung von Situationen und Figuren. Distanz und Nähe, Motorik und Gestik: Alles ist bei ihm genau bemessen. Und wenn Parsifal - der mit einer angenehm hellen, dem Schlussakt jedoch nicht ganz standhaltenden Tenorstimme aufwartende Stuart Skelton - etwas weniger profiliert wirkt als seine Mit- und Gegenspieler, so kann man dies auch mit dem Anderssein des durch Mitleid wissend werdenden reinen Toren rechtfertigen. Atmosphärisch geschlossen Bei Alexander Marco-Buhrmesters Amfortas aber sitzt jede Geste, jeder Ton seines kraftvollen kernigen Baritons. Markant auch die Stimmen des Zauberers Klingsor (Paul Gay) und des noch im Sterben unerbittlich herrischen Königs Titurel (Magnus Baldvinsson), natürlich ebenmässig der Erzählduktus von Jan-Hendrik Rooterings Gurnemanz. Sie alle haben in Paolo Carignani einen Begleiter, der den Orchesterpart ruhig fliessen lässt, die weiten Spannungsbögen kontinuierlich aufbaut, die Solistenstimmen nicht zudeckt, sondern trägt. Und der Klang des Frankfurter Museumsorchesters, mehr erdig-körperhaft denn luzid-schwebend, fügt sich mit dem Bühnengeschehen zu einem Ganzen von dichter atmosphärischer Geschlossenheit. Marianne Zelger-Vogt |
|
Psycho-Drama um Gralsritter Christoph Schlingensief hat ihn zwar in allerlei szenischem Gerümpel ertränkt, doch außerhalb Bayreuths gibt es ein Leben für "Parsifal". In Frankfurt etwa, wo jetzt Christof Nel mit einer gedanklich nachhaltigen Inszenierung aufwartet, bei deren Premiere am Ende Beifall und Jubel überwogen. Der Regisseur hat nicht nur den christlichen Urgrund dieses Bühnenweihfestspiels stärker herausgestellt, sondern auch den Blick auf die Psyche leidgeprüfter Helden geschärft - bei großem Mitgefühl für die Frau in der geschlossenen Männergesellschaft, für Kundrys geschundene Seele. Dabei kann sich Nel nahezu blind auf Paolo Carignani verlassen, der das permanente klangliche Dunkel ebenso zielstrebig erkundet, wie er mit dem hervorragend disponierten Museumsorchester die dramatischen Anstiege meistert. Hochklassig auch die Solistenriege mit starken Gastsängern wie Alexander Marco-Buhrmester, Jan Hendrik Rootering oder Stuart Skelton und einer überaus erfreulichen Ensemble-Präsenz. Das wir von Gaffern umzingelt werden, ja selbst welche sind, darüber lässt Nel schon im Vorspiel nicht im Unklaren, bei dem eine Besuchergruppe auf die wie von hohen Palisaden umgebene Bühne drängt. Diese Touristen wirken wie Störenfriede im auratischen Wagner-Gottesdienst. Vielleicht will Nel auf den musealen Aspekt hinweisen. Denn viele Szenen gefrieren zum Tableau, wie Bilder einer Ausstellung. Jens Kilians Bauten, den Bühnenraum vergrößernd und einengend, spiegeln gleichsam der Helden Innenleben, die mehr oder minder gravitätisch auf der dauerhaft sich drehenden Bühne wandeln, aber dennoch nicht vorwärts kommen. Stecken die Gralsritter zunächst im Zirkusdress (Kostüme: Ilse Welter), so wechseln sie später von der Rüstung zum Allerweltsanzug, die Knappen muten dagegen wie Ministranten an. Der an einer tiefen, nicht heilen wollenden Wunde leidende Amfortas wie sein Vater Titurel und Parsifal in weißen Linnen: Allein Gralsritter Gurnemanz, zeitlos kostümiert, scheint außerhalb dieser Gesellschaft zu stehen, obwohl er in langwierigen Monologen alles über sie weiß. Jan-Hendrik Rooterings nobler Bassbariton bringt sie wie aus der Distanz eines Berichterstatters - es sind irgendwie nicht seine Geschichten, auch wenn sie ihn sehr bewegen. Schließlich ist für die emotionalen Momente der Amfortas des Bayreuth-erfahrenen Alexander Marco-Buhrmester zuständig, ein starker Bariton, der Mitgefühl unmittelbar einfordert. Sein Vater Titurel (Magnus Baldvinsson mit tragfähigem, mahnenden Bass), der einst den Leben spendenden Gral samt Speer empfangen hat, hofft ebenfalls auf jenen tumben Tor, der Erlösung bringen soll. Doch der sich gleich als wilder Knabe einführende Parsifal (gute Idee: Den von ihm per Pfeil erlegten Schwan verkörpert die Tänzerin Rebecca Egeling) scheint gar nicht interessiert an den Ritualen der Ritterschaft. Er schaut weg, wenn die Ritter Leib und Blut Christi empfangen, deren Männerchor bewusst an die Liedertafel gemahnt: Ein wenig Ironie schadet auch einem Bühnenweihfestspiel nicht. Denn ansonsten singen die Kinder-, Damen- (meist aus dem Off) und Männerchöre intonatorisch so exzellent wie eh und je (Einstudierung: Alessandro Zuppardo, Apostolos Kallos). Ironisch angespitzt ist auch der Auftritt feinstimmig betörender Blumenmädchen wie Britta Stallmeister, Annette Stricker, Kirsten Grotius, Barbara Zechmeister, Lisa Wedekind und Yvonne Hettegger, Wagners Frauenbild im Visier: Erst müssen sie in grauen Loden den Boden schrubben, dann entpuppen sie sich als knallrote, auf Abenteuer erpichte Revue Girls. Doch die große Verführerin ist hier Kundry, wie eine Marionette an Klingsor gebunden, den abtrünnigen Ritter, der Amfortas den Speer stahl und die Wunde beibrachte. Paul Gay legt da Zuhälter-Züge an den Tag - mit betont schmierig-elastischer Bass-Stimme. Wie Michaela Schuster die Leiden der Kundry von der magischen, aber bei Parsifal erfolglosen Verführerin zur irren geschundenen Kreatur entwickelt, das hat Ibsen-Format. Dabei durchlebt sie ihre Rolle so stark, dass selbst ihre Sopranstimme in weiträumigem Vibrato enervierend auszuschwingen scheint. Ihr Kuss bewirkt bei Parsifal nur leidenschaftliche Erkenntnis, als habe er wie weiland Adam und Eva vom Apfel genascht. Aus ist es mit dem tumben Tor-Dasein. Er bannt Klingsor, nimmt ihm den Speer ab und kehrt auf leidensvollen Umwegen zur Ritterschaft zurück, wo er eine wie wahnsinnige Kundry antrifft. Der Amfortas erlösende Speer macht ihn zum König, der im unspektakulären Karfreitagszauber wie im Bild gerahmte Stationen seines Lebens erinnert und den Gral am Ende auf schmalem Pfad in alle Welt trägt. Ob nun ungestüm, ignorant, nachdenklich oder von großem Mitgefühl: Stuart Skeltons Tenor beherrscht die vielen Nuancen zwischen lyrisch und kernig - und gewinnt auf ganzer Linie. Wider mangelnde Textverständlichkeit hilft ein Sprachband. Unmittelbar schlagen dagegen die Musik und Carignanis sängerdienliches Dirigat fünfeinhalb Stunden in Bann. In feinen Legatobögen, motivischen und figürlichen Entwicklungen ganz der Klangfarbe verpflichtet, erkennt man, dass selbst in Wagner die gewisse Italianata steckt . Frankfurt hat einen Parsifal, der sich im Gegensatz zu Bayreuth nicht nur hören, sondern auch sehen lassen kann. KLAUS ACKERMANN |
|
Ein Hauch von Neu-Bayreuth Nel inszeniert, Carignani dirigiert Richard Wagners "Parsifal" in Frankfurt Von Axel Zibulski
FRANKFURT Bühnenhoch, schwarz und undurchdringlich steht der Zaun der Gralsburg. Wenn er sich in Christof Nels Frankfurter Neuinszenierung von Richard Wagners "Parsifal" unter regem Einsatz der Drehbühne verschiebt, gibt er einen kreisrunden Raum frei, der in Form und Kühle ein wenig an die Neu-Bayreuther Ästhetik Wieland Wagners denken lässt. Mit dieser "Parsifal"-Premiere hat die Oper Frankfurt jetzt nachgeholt, was bereits vor zwei Jahren geplant war, als aus ökonomischen Gründen die Neuinszenierung gegen eine konzertante Aufführung des "Parsifal" ausgetauscht wurde. Jetzt, bei der szenischen Premiere, musste man den psychologisch exakten und feinen Blick, den Nel in Frankfurt beispielsweise in seinen Inszenierungen von Puccinis "Madame Butterfly" oder Wagners "Tristan und Isolde" zeigte, allerdings weitgehend vermissen. Nel zelebriert Wagners Bühnenweihfestspiel. Mit Abendmahl und Gralsschale, mit Speer und Schwan, der hier in Gestalt einer Tänzerin auf die Bühne flattert. Das Blut des Tieres ist es, mit dem sich Parsifal gleich nach seinem unsensibel-waffenstrotzenden Auftritt fast reuig beschmiert und sogleich ausschaut wie der verwundete Amfortas, der in Frankfurt wie zuletzt in Bayreuth von Alexander Marco-Buhrmester expressiv leidend und zugleich ergreifend sonor gesungen wird. Stuart Skelton als Parsifal ist der einzige Sänger einer Hauptpartie, der bereits bei der konzertanten Premiere mitwirkte; er zeigt einen mittlerweile stabiler und fülliger gewordenen Tenor und fügt sich als rauschgoldblond-reiner Tor (Kostüme: Ilse Welter) ins dominante Schwarz und Weiß der Gralsgesellschaft (Bühne: Jens Kilian) sofort nahtlos ein. Kundry bleibt mit Kleid und Handtasche ein hier ganz bürgerlicher Fremdkörper; Michaela Schuster singt sie herb und mit oft unscharfer Artikulation. Nels Regie kann es nicht vermeiden, die Grenze zum Rührseligen, zum Kitschigen mindestens zu streifen: Ständig wird sich, und zwar schon zu den Klängen des Orchestervorspiels, in die Arme gefallen oder an den Händen gehalten, die "entsündigte Natur" des Karfreitagszaubers wird nicht nur von Kerzen, die das zuvor prägende Neonlicht aufwärmen, sondern gar von einer Gruppe Kindern illustriert. Gerade hier vermisst man seitens des Frankfurter Museumsorchesters eine ausgeprägter tönende Farbenpracht. Fast wirkt es, als ob das überdeutliche Bemühen des Frankfurter Generalmusikdirektors Paolo Carignani um eine noch so feine Staffelung der langsamen Tempi den frei atmenden Zugriff auf die Partitur etwas gebremst hätte: Insgesamt vermeidet Carignani die Extreme, ist vom zügig-bündigen "Parsifal"-Dirigat eines Pierre Boulez kaum weniger entfernt als von den breiten Tempi eines James Levine. Bedauerlich, dass die Frankfurter Chöre ein wenig unter ihrem gewohnten, gewiss hohen Niveau bleiben; gerade deren Herren klingen streckenweise recht inhomogen. Umso ausgewogener die rot-verführerische Blumenmädchen-Schar Klingsors, der von Rollendebütant Paul Gay teils angestrengt attackierend gesungen wird. So bleibt in diesem Frankfurter "Parsifal" Jan-Hendrik Rootering eine Klasse für sich: Trotz kleinerer Alterstrübungen seines Basses ist er ein glaubhaft wissender und mitfühlender Gurnemanz, der zudem als einziger auf der Bühne so exakt artikuliert, dass der Blick auf die Übertitelungsanlage schlicht entbehrlich bleibt. Starker Beifall für die Sänger - für Carignani und das Orchester vereinzelte, für die Regie kräftige "Buh"-Rufe. |
|
Mythos ohne Raum und Zeit Von Michael Dellith Was kann Wagners Opus summum heute noch bedeuten? Ist das „Bühnenweihfestspiel" ein in seiner Aussagekraft kaum mehr relevantes Relikt aus dem 19. Jahrhundert, die Kopfgeburt eines genialen Tonschöpfers, der mit seinem letzten Bühnenwerk der Idee der Kunstreligion ein klingendes Denkmal setzen wollte? Oder grenzt es gar an Blasphemie, wie Kritiker behaupten, wenn Wagner den christlichen Erlösungsgedanken mit seiner Predigt der Keuschheit und Entsagung verknüpft? Und wie soll man den „Parsifal" inszenieren? Historisch-authentisch mit grünem Wald und echtem Schwan? Oder vollkommen überfrachtet, wie es Christoph Schlingensief für Bayreuth tat? Christof Nel hat sich für seine Frankfurter Regiearbeit von all dem rezeptionsgeschichtlichen Ballast frei gemacht. Er inszeniert streng am Text entlang, ganz im Tempo der Musik, und gewinnt so eine zwingende Deutung. Er erzählt in klarer Eindringlichkeit eine Geschichte – wenn man so will: den Mythos des Parsifal, losgelöst von Raum und Zeit. Entsprechend reduziert fällt auch das düstere Bühnenbild von Jens Kilian aus: eine bis auf ein paar Requisiten wie Kelch, Tisch und Lanze leere Drehbühne, begrenzt durch einen überdimensionierten schwarzen Lattenzaun, deren Lamellen gelegentlich den Blick auf das Innere der Gralsburg freigeben. Die Gralsritter leben in einem von der Außenwelt abgeschlossenen Raum, wobei die sich langsam drehende Rotunde natürlich auch für die Aufhebung der Zeit steht, die in dieser Oper eine zentrale Rolle spielt. Nel betrachtet die Protagonisten auf der Bühne nicht als allegorische Figuren. Für ihn sind sie vielmehr Menschen aus Leib und Blut, von Kostümbildnerin Ilse Welter in Straßenkleidung oder schwarz-weiße Gewänder gesteckt, Menschen mit einem Gefühlsleben, das sich in Bewegungen und Gesten äußert – wieder einmal ist es der psychologische Blick des Regisseurs, der das Erzählte im Einklang mit der Musik erhellt. So gerät etwa die Abendmahlsszene zum Schluss des ersten Aufzugs in der schlichten Darstellung der Zeremonie zu einem der ergreifendsten Momente der Aufführung. Die Kunst der Entschleunigung, den erhabenen Ausdruck ohne falsches Pathos zu vermitteln, das ist auch Paolo Carignani am Pult des hervorragend disponierten Museumsorchesters geglückt. Ihm gelang gleichsam die Quadratur des Kreises: die Musik trotz der Vorschrift, stets langsamer zu werden, immer in Fluss zu halten. Seine ruhigen, schwingenden Dirigierbewegungen (für den ersten Akt nahm er sich etwa eine Stunde und 45 Minuten Zeit) ließen Wagners unendliche Kantilenen atmen. Der Klang konnte sich formen, mit schlanker Intensität in sanfter Wärme erblühen und so die Sänger auf der Bühne partnerschaftlich tragen. Mit souveräner stimmlicher Statur gab Jan-Hendrik Rootering den Gurnemanz in der ganzen Fülle des Wohllauts. Seine Bass-Kollegen Magnus Baldvinsson als Titurel und Paul Gay in der Rolle des Klingsor überzeugten durch ihr kerniges, substanzvolles Timbre. Alexander Marco-Buhrmester sang den leidenden Amfortas mit starker Emphase, und Stuart Skelton in der Titelpartie, die der Australier bereits 2004 bei der konzertanten Aufführung des „Parsifal" glänzend ausfüllte, gefiel mit leichter Bariton-Färbung, was der Figur einen virileren Charakter gab. Grandios verkörperte Michaela Schuster die zum Tod verdammte Verführerin Kundry, die Klingsor willfährig ergeben ist. Ihr Mezzo eröffnete wahre Abgründe. Stimmlich hervorragend auch die Blumenmädchen in ihren flammend roten Rüschen-Kleidern, sehr präsent die von Alessandro Zuppardo und Apostolos Kallos detailliert vorbereiteten Chöre. Am Ende verdienter Premierenjubel, der die wenigen Buhs für das Regieteam untergehen ließ und der noch einmal kräftig aufbrandete als Carignani seine exquisiten Musiker aus dem Orchestergraben auf die Bühne holte. |
|
„Parsifal" in der Oper
Foto: Monika Ritterhaus ZUM SCHLUSSAPPLAUS KAM auch das Orchester auf die Bühne. Ein eher ungewöhnlicher Vorgang, aber damit konnte man einmal sehen, welch gigantischer Personalaufwand mit Richard Wagners „Parsifal" verbunden ist. Der hatte nun in der Frankfurter Oper Premiere. Um die 300 Menschen waren allein inklusive der drei Chöre auf der Bühne und im Orchestergraben am Gelingen des „Bühnenweihfestspiels" beteiligt, das 1882 in Bayreuth uraufgeführt wurde. In Frankfurt hatte es zwei Jahre gedauert, bis die Inszenierung von Christof Nel stand – der finanzielle Aufwand war für diese Vorlaufzeit verantwortlich.Aber auch ansonsten ist das Werk nicht ohne und vor allem etwas für echte Fans. Wer sich darauf einlässt, muss vor allem eines mitbringen: Sitzfleisch. Zwar fanden auch in Frankfurt zwischen 17 und 23 Uhr zwei Pausen statt, doch dazwischen gab es Oper satt in jeweils nahezu voller Spielfilmlänge. Dabei ist die Handlung recht kurz erzählt. Gralskönig Amfortas ist von Klingsor, dem die Zugehörigkeit zur Gralsgemeinschaft verweigert wurde, schwer verwundet worden und kann nur von einem „reinen Toren" aus Mitleid mit dem heiligen Speer erlöst werden, mit dem Jesus am Kreuz in die Seite gestochen wurde. Geheimnisvolle Rituale, mystische Andeutungen Wie es das Schicksal will, kommt Parsifal des Weges und verirrt sich bei seiner Wanderung auch auf Klingsors Zauberschloss, wo sich der Speer befindet. Von Kundry, einer Gralsbotin, geküsst, erwacht Parsifal aus seiner Unwissenheit, entreißt Klingsor den Speer, wird selbst zum König gesalbt und heilt Amfortas. Die Oper ist aufgeladen mit allerhand mystischen Andeutungen und Ritualen. So wird allein das „Liebesmahl" im ersten Aufzug zu einem dämonischen Zeremoniell des Männerbundes. Im Zentrum die Enthüllung des Grals, dessen bloßer Anblick Amfortas höllischen Schmerz bereitet. Christof Nel hat seine Produktion sehr behutsam und eng an der Musik ausgerichtet, die Bühne von Jens Kilian besteht aus einem riesigen Lattenzaun, der immer neue Blicke auf die Szenen zulässt. Mal umschließt er den Wald vor der Gralsburg, mal öffnet er sich hin zum Zauberreich Klingsors. Generalmusikdirektor Paolo Carignani und seinem Orchester ist eine Interpretation zu verdanken, die sich immer wieder neu entwickelt und auf die zahlreichen gewandelten Atmosphären einstimmt. Michaela Schuster bietet eine fast übermenschliche Leistung Unter den Solisten sticht vor allem Michaela Schuster hervor, die mit fast übermenschlicher Leistung und großer Stimme die Rolle der Kundry übernommen hat. Ungewöhnlich gehaltvoll ist sie vor allem in den tiefen Regionen, ihre Stimme besitzt gleichermaßen Wärme und hell schimmernden Glanz. Den Parsifal verkörpert Stuart Skelton mit schlankem Tenor, Jan-Hendrik Rootering ist ein gehaltvoller Gurnemanz, Alexander Marco-Buhrmester gibt als Amfortas mit durchsetzungsfähiger Stimme sein Frankfurt-Debüt. Daniel Honsack |
|
Musiktheater: Christof Nel inszeniert, Paolo Carignani dirigiert Richard Wagners „Parsifal" an der Oper Frankfurt Von Heinz Zietsch FRANKFURT. Von der Seite im Zuschauerraum kommen Männer und Frauen. Sie verabschieden sich voneinander. Nur die Männer betreten die Bühne. Als eine Frau es wagt mitzukommen, wehrt ein Mann sie ab. Denn nur Männern ist es gestattet, die Welt der Gralssritter zu betreten. Jens Kilian hat an der Frankfurter Oper für den „Parsifal" des Regisseurs Christof Nel eine abgeschottete, kaum zu durchdringende Gralsburg aus Bretterwänden geschaffen, die eine Rotunde bilden. Licht aus Neonröhren schimmert durch, und die Drehbühne kreiselt langsam dazu. Sie dreht sich recht oft in dieser Inszenierung von Richard Wagners Bühnenweihfestspiel – ein recht einfallsloser Kunstgriff, um die aktionsarmen Stellen zu unterlaufen, was jedoch auf Dauer ermüdend wirkt und den Zuschauer nervt. Am Ende der mit zwei Pausen fünfeinhalb Stunden dauernden Premiere am Sonntagabend bekommt das Regieteam die Quittung: einige Buhs waren zu vernehmen, die wohl eher dem Bühnenbildner galten. Die musikalische Seite, vor allem das Dirigat des Generalmusikdirektors Paolo Carignani, sowie die Sänger und der Chor wurden vom Publikum mit begeistertem Beifall und vielen Bravos bedacht. Christof Nel erzählt die Geschichte von Wagners Gralsmythos als zeitloses Sinnbild von Leid, Mitleid und Liebe szenisch nach und nimmt das Stück wie es ist: als ein Werk der Kunst-Religion. Parsifal fängt den Speer nicht auf, sondern breitet wie der Gekreuzigte die Arme aus und macht so Klingsor machtlos. Es gibt also nichts Neues aus der Gralsburg. Mitunter gelingen dem Regisseur schöne, fast nazarenisch wirkende Bilder, wenn Kundry Parsifal – wie in einem hell beleuchteten Fenster- oder Bilderrahmen – die Füße wäscht, wenn zum Karfreitagszauber im Schnee junge Mädchen zum Zeichen des Wunders Blumen tragen oder sich die Bretterrotunde nach hinten weitet, sobald Gurnemanz erklärt, dass die Zeit zum Raum wird. Der Bühnenraum wird von Olaf Winter nicht ohne Raffinesse ausgeleuchtet. Stilisiert wirken die Kostüme von Ilse Welter in der Vermischung von Mittelalter, Mönchsgewand, Ritterrüstung und Kleidung der fünfziger Jahre. Die Gralsherrscher Amfortas und Titurel sowie Parsifal tragen weiße Gewänder. Wie biedere Nachkriegshausfrauen in armselige Lodenmäntel gehüllt, säubern zunächst die Blumenmädchen den Boden: Mauerblümchen, die noch nicht ihre Pracht entfaltet haben. Doch dann entblättern sie sich, zum Vorschein kommt roter Blütenzauber, der an Klatschmohn erinnert. Das ist zwar anmutig anzusehen, aber keineswegs erotisch betörend. Das passt wohl auch zum Regiekonzept von Nel, der Kundry weniger als sinnlich-triebhafte Gestalt, sondern vielmehr als sorgende, dienende Mutter sieht. Michaela Schuster, der vormals schon als Mitglied des Darmstädter Opern-Ensembles eine große Karriere vorausgesagt wurde, begeistert in Frankfurt das Publikum als Kundry. Sie fasziniert als grandiose Sängerin und Darstellerin, die jeder Nuance nachspürt und mit ihrer breit gefächerten Stimmpalette – satten Tiefen und brillanten Höhen – zum Ausdruck bringt. Wunderbar wie sie den Wandel der Kundry nachzeichnet, deren kluge Hellsichtigkeit sie schließlich in den Wahn treibt. Überhaupt bringt die Frankfurter Aufführung beachtliche Stimmen auf die Bühne: Jan-Hendrik Rootering ist da zuerst als sängerisch stets präsenter Gurnemanz zu nennen, Alexander Marco-Buhrmester als Amfortas, Paul Gay als Klingsor, der oft hinter Kundry steht und sie so seinen Machenschaften unterwirft, schließlich Stuart Skelton in der Titelpartie, dessen stimmliche Kräfte im dritten Akt etwas nachlassen. Was der Szene an Sinnlichkeit mangelt, das steuert Paolo Carignani am Pult des Frankfurter Museumsorchesters bei. Derart farbig, glutvoll, süffig und in den Orchesterstimmen ausdifferenziert hat man die „Parsifal"-Partitur bisher wohl kaum gehört – sozusagen erfrischend durch die Brille eines italienischen Dirigenten gefiltert. Wie er die endlosen Melodien auffächert und geradezu Takt für Takt steigert und dann noch eins draufsetzt, um Sinnliches förmlich übersinnlich werden zu lassen, das ist großartiges musikalisches Theater aus dem Orchestergraben. |
|
Erlösung am Main Bei der Inszenierung von Wagners "Parsifal" muss sich jeder Regisseur entscheiden: Soll ein Erlösungsdrama vorgeführt werden, handelt es sich um einen Erkenntnisprozess der Hauptfigur oder geht es einfach um die Ablösung einer alten Gesellschaftsform durch eine neue? Diese Fragen sollte jede Parsifal-Inszenierung, wenn schon nicht beantworten, so doch zumindest stellen. Jetzt ist Christof Nels "Parsifal" an der Oper Frankfurt zu sehen. Von Jörn Florian Fuchs Den Parsifal zu inszenieren, das ist wahrlich kein Pappenstil. Immerhin gilt es - je nach Dirigat - mindestens knappe vier, maximal gut fünfeinhalb Stunden Text und Musik auf die Bühne zu bringen. Die Geschichte, die Wagner im Parsifal erzählt, ist zwar eigentlich recht einfach, aber die Aus-Deutung des Geschehens stellt ein Problem dar: wird hier ein pseudo-christliches Erlösungsdrama vorgeführt, handelt es sich um einen mitleidsethischen Erkenntnisprozess der Hauptfigur oder geht es einfach um die Ablösung einer alten Gesellschaftsform durch eine neue? Diese Fragen sollte jede Parsifal-Inszenierung, wenn schon nicht beantworten, so doch zumindest stellen. An der Oper Frankfurt hat sich Christof Nel Wagners Bühnenweihfestspiel gewidmet und dabei kurzerhand und kurzsichtig die Weihe, das Fest und eigentlich auch das Spiel gestrichen. Übrig bleibt die Bühne. Die besteht aus riesigen verschieb- und vor allem drehbaren Lamellengittern, davor, darin oder dahinter agiert das Ensemble. Dieses wird zu Beginn angeführt von Gurnemanz, der in einem legeren, grauen Schmuddelanzug daherkommt, das unvorteilhaft geschnittene Bekleidungsstück scheint einem Flohmarkt zu entstammen. Kaum singt er von "Schlafhütern", da drehen sich die Lamellen müde und bringen schwarz gekleidete Ritter à la Star Wars hervor, gefolgt von grellweißen Knappen, die alle einen Knieschutz tragen, wohl vor allem deshalb, weil sie an diesem Abend zahlreich Gelegenheit zum Niederknien haben, allerdings ohne wirkliche Andacht. Kundry, die wilde Reiterin, schreitet herbei, sie wirkt wie eine leicht verlebte Mittfünfzigerin, das aus Arabien mitgebrachte Heilkraut für den schmerzleidenden Amfortas nimmt sie aus ihrem Lederhandtäschchen. Und dann kommt der Erlöser, erlegt ein schneeweiß gekleidetes Mädchen - den Schwan - und sieht in seinem hellen, labbrigen Anzug aus wie der kleine Bruder von Gurnemanz. Nur hinsichtlich der Frisur unterscheiden sich die beiden: Gurnemanz trägt einen leicht ergrauten Prinz-Eisenherz-Schnitt, Parsifal stylt sich semmelblond. Wer ist der Gral? Das sagt sich nicht, sagt Wagner, und Nel verweigert jegliche klare Antwort, setzt stattdessen auf szenische Verwirrung und ein akustisch sicher nicht uninteressantes Raumkonzept. Enthüllt werden in der erste Gralsszene gleich zwei Pokale, sie liegen auf einem großen Tisch unter einer großen Tischdecke. Ein Pokal bleibt leer und genau dieser wird von den Gralsrittern herumgereicht, ein anderes Gefäss ist aus Glas, gefüllt mit einer roten Flüssigkeit. Die kraftspendende Ernährung der Gemeinschaft geschieht durch Musik: die Stimmen aus der Höhe erklingen tatsächlich aus der Höhe, aus dem dritten Rang des Frankfurter Opernhauses. Dort öffnet sich eine Tür, ein Scheinwerfer strahlt nach vorn und an diesem Licht und der Musik laben sich die Ritter - sie blicken verzückt nach oben zum Scheinwerfer. Bis zum offenen Ende - Parsifal schreitet auf der sich beständig drehenden Bühne langsam von dannen - verwandeln sich die Blumenmädchen von mausgrauen zu mäßig erotischen Verführerinnen in Carmen-Kleidern, führt Klingsor die Urteufelin Kundry wie eine Marionette zu Parsifal oder blitzen immer wieder ein paar Lichter durch die Lamellen. Die heterogenen Regieeinfälle und Bilder erleuchten sie nicht. Die szenische Oberflächlichkeit wird vom Dirigat Paolo Carignanis bestens unterstützt, ihn interessieren weniger die Tiefenschichten des Werks, stattdessen er poliert Wagner auf Hochglanz, mit ein paar Unebenheiten sowohl bei den Streichern wie beim Blech. Statt der für die Binnenspannung des Parsifal unverzichtbaren "Endlosbögen", zerteilt Carignani die Musik in Blöcke oder setzt - etwa bei den Verwandlungsmusiken - fast schon expressionistische Symphonik ein. Sängerisch kann Frankfurt immerhin punkten: Jan-Hendrik Rootering ist ein ausgezeichneter Gurnemanz, Alexander-Marco Buhrmester ein klangschön leidender Amfortas, Stuart Skelton ein durchgehend präzise intonierender Parsifal. Die Kundry der Michaela Schuster besitzt wunderbare Tiefe, in den Höhen neigt sie manchmal etwas zum forcieren. Am Ende mischten sich in den Applaus ein paar deutliche Missfallensbekundungen für den Dirigenten, einige heftige Buhsalven galten dem Regieteam, das seine Hausaufgaben nicht gemacht hat. Vielleicht hätte ein bisschen mehr szenische Analyse geholfen. |
|
Dreifache Erlösung "Parsifal"-Inszenierungen in Leipzig, Frankfurt (Main) und Erfurt Von Roberto Becker Wenn Richard Wagners "Parsifal" auf dem Premierenplan steht, wird man an den Opern nervös. Nicht nur, weil man dafür ein standfestes Sängerensemble, ein großes Orchester und einen Dirigenten mit Wagner-Feeling braucht. Wagner hat sein letztes Musiktheaterwerk für die spezielle Akustik des Bayreuther Festspielhauses gedichtet und komponiert. Sein Verdikt, "Parsifal" nur dort aufzuführen, konnte seine Witwe Cosima 30 Jahre durchhalten. Weil Wagner seinen "Parsifal" nicht einfach als Musikdrama, sondern als ein "Bühnenweihfestspiel" bezeichnet und gemeint hat, haben es aber nicht nur die musikalischen Klippen, sondern vor allem die religiösen Intentionen in sich. In säkularen Zeiten lässt sich der Erlösungsjob des reinen Toren Parsifal kaum ungefiltert in Szene setzen. Der verzicht nämlich bewusst auf die sexuelle Seite seiner Natur, um die daran leidende Frau Kundry und Amfortas, den schwer an Leib und Seele verletzten König dieser merkwürdigen Rittergesellschaft, zu erlösen. Da diese Herren von Zeit zu Zeit einen Blick auf jenes Gefäß brauchen, in dem das Blut des Christenheilands aufbewahrt wird, fragen ambitionierte Regisseure gerne nach dem metaphorischen Potenzial einer zunehmend auf leere Rituale fixierten Gesellschaft. Ruth Berghaus, Harry Kupfer, Peter Konwitschny, aber auch Sebastian Baumgarten oder David Alden haben da Meilensteine der Interpretation beigesteuert. Selbst der Grüne Hügel in Bayreuth ist mit Christoph Schlingensiefs multireligiös aufgebrochenem Happening inzwischen mitten im Leben eines lebendigen, hinterfragenden Theaters angekommen. Die drei jüngsten Produktionen in Leipzig, Erfurt und Frankfurt (Main) folgen diesem Weg nicht mehr. Die Leipziger Übernahme von Roland Aeschlimanns Genfer Inszenierung und die Erfurter Version von Intendant Guy Montavon und dem Schweizer Maler René Myrha erzählen die Geschichte lediglich nach. Die Protagonisten (in beiden Fällen eher mäßig einfallsreich geführt) bewegen sich in einer stark dominierenden Bildwelt. In Leipzig sind es abstrakte geometrische Formen, der Gral ist ein Kristall in einer obskuren Röhre, in der auch Parsifal verschwindet, nachdem er den Speer im Gralsbezirk abgeliefert hat. Dass es sich nicht sagt, was der Gral denn sei, scheint hier das Motto der Inszenierung. Erfurt bietet weniger ein Bilderrätsel, als einige bunte Riesencomics mit Kundry oder Amfortas, stilisiertem Speer und Schwan zwischen dunklen Seitenwänden. Der Gral sieht hier immerhin aus wie ein veritabler Kelch. Dass Montavon am Ende das gesamte Personal einschließlich des Bösewichtes Klingsor zu dessen letzter Enthüllung zusammenführt, bleibt dann eine Vision, die nicht über das Werk hinaus geht. Dass man sich dem "Parsifal" aber auch ohne die Absicht, ihn auseinander zu nehmen, gewinnbringend annähren kann, bewies Christoph Nel in Frankfurt. Dabei nahm er das Werk in seinem religiösen Impetus ausgesprochen ernst, lotete den aber so scharfsinnig aus, dass dieser Gral als Idee von innen zu leuchten begann. Nel hinterfragte die Rituale von Abendmahl und Fußwaschung, er ließ seine Kundry vorführen, was Verflucht- und Verzweifeltsein für einen Menschen heißt. Und wie Nel mit den Blumenmädchen umgeht, mit deren Hilfe Klingsor Parsifal verführen will, das allein schon zeigt die Überlegenheit dieser Inszenierung. Man sieht, was man hört: dass ihnen gerade ihre Männer getötet wurden. Ihre Blütenpracht ist daher zunächst unter tristen Mänteln verborgen. Beim Karfreitagszauber dann, bei dem es um symbolisches Erblühen geht, wird das durch das Erscheinen von lauter Schwangeren und Maria-gleichen Müttern mit Kindern in Szene gesetzt. Im letzten Bild lässt Nel seinen Parsifal den Gral aus jenem meist von einem riesigen Bretterverschlag verdeckten Gralsbezirk heraustragen. Vielleicht ein Ende? Waren doch die Frauen schon am Anfang von den Männern wieder aus dem Saal gewiesen worden. Oder es ist ein Anfang von etwas Neuem ohne die Ritter? Man weiß es nicht, aber die szenische Spannung, die Nel erzeugt hat, wirkt lange nach. Vom interpretatorischen Ansatz und in der szenischen Ausführung verweist Christoph Nel die beiden anderen Inszenierungen auf die Plätze. Das liegt auch daran, dass die Frankfurter Oper geradezu eine Referenzbesetzung (etwa mit Alexander Marco Buhrmester als Amfortas und Jan-Hendrik Rootering als Gurnemanz) aufbieten kann. Vor allem aber die Kundry, Michaela Schuster, dürfte im Moment nirgendwo zu überbieten sein. Ihr Psychogramm und ihre stimmliche Gestaltungskraft hinterlassen den stärksten Eindruck. Mehr als nur wacker schlugen sich als Parsifal neben Stuart Skelton auch Stefan Vinke in Leipzig und Thomas Mohr in Erfurt. Wie überhaupt die ausgewogene Besetzung, die Erfurt aufbieten konnte (Carola Guber als Kundry, Alfred Pesendorfer als Gurnemanz), für ein Haus dieser Größe überraschte. Die Leipziger Produktion wiederum bezieht ihren Reiz, neben respektablen Protagonisten, vor allem aus dem großen Atem, den das Gewandhausorchester unter Ulf Schirmer entfaltete. An diese spannungsvolle Geschlossenheit reichte auch Paolo Carignani mit dem Frankfurter Museumsorchester über weite Strecken heran. Naturgemäß hat da ein Orchester, dass mit Gästen (der Thüringen Philharmonie Gotha-Suhl) erst verstärkt werden musste, um auf Parsifal-Stärke zu kommen, einen viel schwereren Stand. Und doch war der Erfurter Aufführung anzumerken, dass vor allem GMD Walter Gugerbauer dafür alle Kräfte des Hauses mobilisieren konnte. |
|
Oper Frankfurt „Zum Raum wird hier die Zeit": jene Botschaft aus dem Parsifal liegt als Fluch über jedem Vorhaben, szenisch wie musikalisch, den Parsifal, Richard Wagners Erlösungsoper par excellence, in ausgedeutete Bilder zu bannen. Dem klanglich vielschichtig durchsetzten Werk, das mit einer Fülle von Zeitmaßen durchwoben ist, den pulsierenden musikalisch Parsifalschen Atem zu entlocken, gilt als Prüfstein für jeden Dirigenten heutzutage. Schon Eduard Hanslik resümierte am 25. Juli 1882 nach seinem Bayreuther Besuch, dass die auffallend langsamen Tempi, jede Szene zu lang ausgesponnen und alles maßlos sei, vom Größten bis zum Kleinsten, von dem feierlichen Liebesmahl bis zu dem unmöglichen Kuß der Kundry. Alles verkümmere im Flugsand instrumentaler „Unendlichkeit". „Damals wie heute stellt sich die Frage, wie löst man szenisch die Übermacht jener unendlichen Melodien und Seinszustände. Bühnenbildner Jens Kilian, hat für den Frankfurter Parsifal ein riesiges hölzernes Räderwerk erfunden, als könnte man, wenn man es von oben betrachtet, in ein tickendes Uhrwerk schauen. Die großen Zaunlatten schieben sich aneinander vorbei oder drehen sich labyrinthisch ineinander. Sie heben die Zeit auf. In den freigewordenen Gängen und Räumen erlebt die mystische Handlung der Gralsritter archaische Wirkung. Es scheint, als ob die inneren Seelenräume der Musik auf- und zugeschlossen würden. Ein Räderwerk der Zeit, in dem ein jeder sich gefangen wähnt. Ob Ritter oder Höllenrose Kundry, sie suchen nach der Erlösung. Christoph Nel hat es sich leicht gemacht. Er setzt das in Bilder, was Richard Wagner niedergeschrieben hat. Sein Konzept wirkt, immerhin hatte er zwei Jahre Zeit zur szenischen Umsetzung, altbacken. Seine Figuren schlittern an einer wirklichen glutvollen lebendigen Zeichnung der Charaktere vorbei. Sie werden zur Karikatur der Figuren, die Richard Wagner mit tiefer innerer Spannung und konfliktbeladen bedacht hat. Frauenfiguren verkommen bei Nel immer zu liebedienerischen, hysterischen Weibern. So auch seine Kundry. Sie wird reduziert, hat kaum menschlich liebenswerte Züge. Sie stampft und strampelt mehrmals hin und her, als ihr der Kuss von Parsifal verwehrt wird. Den heilenden Balsam streckt sie in einem Handtäschchen Gurnemanz entgegen. Dem Mythos Gralsfindung und Erlösungsgedanke nimmt Nels flache Personenregie entscheidende Kraft und Utopie. Seine Gralsritter liegen betend auf dem Boden eher dienernd als dienend. Wer jemals in Italien Wagners Zaubergarten gesichtet und gerochen hat, weiß was uns der Bayreuther Meister mit der Erfindung der sinnlichen Blumenmädchen sagen wollte: Erlösung, Auflösung, gänzliche Erlösung ist nur dem verheißen, der den machtvollen sinnlichen Verführungen Stand hält. Parsifal lässt sich nicht betören von den in graue Mäntel gehüllte, blutschrubbenden Kriegsbräuten. Ihrer Mäntel entledigt, werden sie zu schönen mohnfarbenleuchtenden Blumenmädchen, die über Parsifal herfallen. Kostüme, Ilse Welter: Eines der betörendsten Bilder der Aufführung: am hohen Bretterzaun liegen die Hüllen der Blumenmädchen. „Kannst du uns nicht lieben und minnen, - wir welken und sterben dahinnen". Langsam ziehen sie sich nach Parsifals Liebesverzicht zum Sterben in die große freie Schlucht des Bühnenraums zurück. Großartig! Hat Wagner ein Paradies ohne Frauen geschaffen, wie uns Nel Glauben machen will? Nein! Ohne Kundry keine Gralsritter, kein Parsifal, keine Männerwelt. Melanie Diener ist jene strampelnde Kundry, die mit betörend schöner Stimme, rauschhaften Urklängen ihrer „Urteufelin" existenzialistische Lebendigkeit einhaucht. Überhaupt hat dieser Frankfurter Parsifal eine höchst erstaunliche wagnererfahrene Solistenriege aufzubieten. Ruhig, mit gewaltiger Besonnenheit und stimmlichem Format, brilliert Jan-Hendrik Rootering als Gurnemanz. Paul Gays Klingsor hat gesangliche Bayreuth-Qualitäten und sein spannungsreiches, kraftvolles Spiel mit Kundry gehörte neben der Blumenmädchenszene zu den Höhepunkten des Abends. Stuart Skeltons Parsifal geriet in seinem Spiel durchgängig gelungen. Stimmlich überzeugte er nicht immer mit einer geschmeidig tenoralen Biegsamkeit. Alexander Marco Burmester gelang ein baritonal gut ausgeleuchteter Amfortas. Die Blumenmädchen, hervorragend solistisch besetzt, bestachen mit makelloser klanglicher Diktion. Auch die verschiedenen Chöre (Alessandro Zupardo, die zum Beispiel aus dem obersten Rang des Hauses subtil schillernd erklangen, verdienen Lob. Paolo Carignani steuerte zusammen mit dem Frankfurter Museumsorchester sein „Parsifalschiff" durch alle Schluchten, Zeitmaße und irisierenden Klangschichten. Musikalisch „Schwüles Kreischen, weihrauchdüftelnde Sinne - Reize, zuckersüßes Bimbambaumeln", wie Nietzsche den Parsifal empfand, mochte sich dennoch nicht einstellen. Dazu schwebte dieser Parsifal zu nahe am Boden. Barbara RÖDER |
|
Frankfurt `Parsifal' Boasts Heroic Tenor, Suits, Plastic Armor April 26 (Bloomberg) – The Frankfurt Opera's new ``Parsifal'' is remarkable in a German context: a detailed staging that tells the story as it is written. Christof Nel, often ferociously deconstructive, has delved into Wagner's 1882 work and come up with a treatment that is both profound and literal. The spear is a spear, the grail is a grail and Kundry drops dead when she's meant to. The only aberration is the swan shot by Parsifal in the first act, here another white-clad young squire with Roald Dahl-style wings. But then, in our age of bird flu, a moth-eaten swan's corpse from the props department evokes all the wrong associations. Nel blends ancient with modern, mystery with clarity. These knights wear suits beneath their breast plates, yet Mass with the Holy Grail is the most important thing in their lives. Jens Kilian's sets and Olaf Winter's lighting combine to create a sparse world of ambivalent spaces. Slatted walls reach from floor to ceiling, turning in unpredictably sinuous curves on the revolving stage to reveal half- glimpses of goings-on in the cloistered world beyond. Women have no place here, as a cluster of supernumerary spouses are firmly instructed by their departing husbands during the prelude. Nel makes less of this than he could, confining himself to an obvious show of discomfort when Kundry hands over her Arabian balsam in a handbag that none of the knights wants to hold. Swan Shots Parsifal, the unknowing innocent who progresses from swan- shooting to holy quest, rescuing the spear from Klingsor and returning to heal the chronically ailing Amfortas and take over leadership of his moribund order himself, remains white-clad throughout. Every space, from the forest clearing at Montsalvat where Amfortas bathes and the swan gasps its last to castrated Klingsor's magic castle, is suggested by adroit placing of the slat walls and subtle shifts in lighting. Klingsor's knights are automated chess- piece robots, his flower girls subhuman creatures with scarlet baby-doll frocks beneath army coats (costumes: Ilse Welter). There is more than a touch of Star Wars in the plastic armor, and a decided touch of 2001 in the Act I Grail ceremony, though arguably George Lucas and Stanley Kubrick were both just copying Wagner. No matter; the joy of this staging lies in its subtle unfolding, the earnest detail of its characterizations and its inner harmony. Nel's staging wouldn't have nearly as much impact as it does without Paolo Carignani. He is a formidable Wagner conductor, with a clear analytical view of the work and a transparent approach to the architecture that still offers space to breathe with the singers and to glow with luminous intensity in the orchestral interludes. Superb playing from the Frankfurt Museum Orchestra supports a fine young cast. Tender Notes In the title role, tenor Stuart Skelton is about as good as Parsifal gets, with beautifully modulated phrasing, effortless power, crystal-clear diction and tender top notes. Add to that a tall, solid frame and you have a Wagnerian hero. The rest of the cast is almost as remarkable. Alexander Marco- Buhrmester's Amfortas is earthy and elemental, a physical performance with a youthful passion that adds a new poignancy to the part. Paul Gay's Klingsor is a man at the height of his powers, keen and dangerous, lean and thrilling. Michaela Schuster is a Kundry who is plausible both as sultry seductress and suffering soul, a woman driven by circumstance to extremes. And Jan Hendrik Rootering's Guremanz is the still pole at the center of the drama, phlegmatic and wise. In a context of increasingly silly ``Parsifal'' productions around Germany (rotting hares and naked voodoo rites in Bayreuth, human vivisection and time travel in Berlin, Kundry as the Virgin Mary in Munich and so on), Frankfurt offers an alternative to anyone simply out to see the piece. |