|
Oper Frankfurt VON HANS-JÜRGEN LINKE Caligulas Wahnsinn kulminiert in einigen Sätzen, denen man Allgemeingültigkeit nicht absprechen kann. "Die Menschen sterben und sind nicht glücklich" ist einer davon, ein anderer "Regieren ist Stehlen". Die mörderische Tyrannei des berüchtigten römischen Kaisers ist nicht zuletzt Ergebnis des maßlosen Herumexperimentierens mit derart unausweichlichen Wahrheiten. Möglicherweise ist auch der Tod seiner geliebten Schwester Drusilla ein Auslöser für Caligulas ins Kosmische überdehnte existenzielle Ratlosig- und Selbstherrlichkeit. Aber hier beginnt das Feld haltloser psychologischer Spekulation, und es ginge eindeutig zu weit, den Massenmörder Caligula zum Helden eines verständnisvollen Dramas zu machen. Kein Hauch einer Rechtfertigung Das tut Hans-Ulrich Treichel auch nicht in seinem an Camus angelehnten Libretto für Detlev Glanerts jetzt in Frankfurt uraufgeführte Oper Caligula. Obwohl beide, Librettist und Komponist, mit unverstelltem Problembewusstsein zu Werke gegangen sind und obwohl die Dramatik in Glanerts Musik keiner äußeren Handlung folgt, sondern allein auf Wahrnehmungen und psychische Vorgänge der Zentralfigur gemünzt ist, enthält das Stück keinen leichtfertigen Hauch einer Rechtfertigung von Gewaltherrschaft; es gilt der Satz, mit dem Cherea, der Kopf der Verschwörer, Caligula konfrontiert: "Du bist wie niemand sein darf." Die Uraufführung war ein außerordentlicher Publikumserfolg, und die zwei gewichtigsten Gründe dafür haben Treichel und Glanert produziert. Denn Musik und Libretto sind von einer außerordentlichen Klarheit und Dichte. Die dramatische Konstruktion ist filigran und nachvollziehbar; die Musik spart einerseits nicht mit Effekten und Extremen, folgt andererseits aber der verbalen Gestaltung abwegiger Machtausübung derart aufs Wort, dass man hier das Wort kongenial verwenden kann. Es sind stets Satzmelodie, Sprechrhythmus und deren Variationen und Übersteigerungen, die den Gestus der Musik bestimmen, und wahrscheinlich ist dies das Schlüsselwort für die enorme Wirksamkeit von Detlev Glanerts Musik: ihr Gestus. Sie entfaltet ihn auf drei Ebenen, der der einsamen Figuren (Caligula allein und in seinen Dialogen), der eines Solistenensembles (die Verschwörer) und der des Chors; alle drei Ebenen sind eng miteinander verzahnt und korrespondieren wie in einem fest gespannten Netz, das jede Bewegung als Gesamtbewegung darstellt. Glanerts Instrumentation ist auf die Exponierung der tiefen Blechinstrumente und der hohen Holzbläser zugespitzt, und auch die Dynamik steuert immer wieder die Extreme an. Nirgends gibt es eine gravitätische oder wattige Mitte, aus der heraus Ruhe ins Geschehen gebracht würde. Die einerseits extrem geführte, andererseits gerade dadurch so klar gebaute Musik war bei dem von Markus Stenz (GMD des koproduzierenden Opernhauses in Köln) geleiteten Museumsorchester in besten Händen: Man hört förmlich das Ergebnis einer möglicherweise manchmal entnervenden, aber im Ergebnis außerordentlich gelungenen Probenarbeit. Engagement und Präzision finden sich in glücklicher Verbindung - so präsent und klangbewusst hat man dieses Orchester zuletzt nicht immer erleben können. Die Verdienste von Christian Pades Inszenierung sind nicht zu unterschätzen. Das Stück hätte, bei vordergründigerer und populistisch eingefärbter Sicht, durchaus Chancen für gefällige politische Stellungnahmen enthalten. Dass Caligula beispielsweise als einzige verbliebene Unerreichbarkeit den Mond zu lieben scheint und ihn geschenkt bekommen, sich mit ihm vermählen, ihn beherrschen will, hätte man ohne weiteres mit der technologisch grundierten Mondsucht aktuellerer Herrscherfiguren in Beziehung setzen können; dass Caligula seine Macht betätigt, indem er sich läppisch und trivial als Venus inszeniert, Hof und Volk zur Anbetung nötigt und dafür Geld einsammelt, ist ein prägnantes Bild für bestimmte Tendenzen in der Medienwelt. Solche zeitdiagnostischen Einfärbungen werden durchaus als Interpretationsmöglichkeiten angeboten, aber nicht aufgedrängt. Die Inszenierung gestattet sich keine voreiligen Vereinfachungen, sondern bleibt vornehm und mehrdeutig. Sie kann sich dabei auf die wirkungssicher ausgearbeitete, analog zur Musik mit extremen ästhetischen Maßnahmen gestaltete Bühnenwelt Alexander Lintls stützen. Er entwirft einen Innenraum der Machtausübung, der mit hohen Wänden, überraschenden Lichteffekten, krassen Schwarz-Weiß-Kontrasten und manchmal der Primärfarbe Rot wenig Wert auf menschliches Maß legt und mit seiner streng geometrischen Binnenstruktur der existenziellen Heimatlosigkeit Caligulas eine angemessene Umgebung liefert. Der Chor, geleitet von Alessandro Zuppardo, trägt das Gewicht, das die Oper ihm beimisst, mit Beweglichkeit und musikalischer Präsenz. Feinmechanische Unruhe Die Beurteilung der Sänger muss sich, wegen des absichtsvoll un-melodiösen Charakters der Partien, aufs Dramatische beschränken. Ashley Holland gibt den Caligula wie das Massenzentrum einer aus der Bahn geworfenen Welt und vermag stimmlich der hohen Dauerbelastung der Titelfigur eine lückenlose Eindringlichkeit zu geben, was eine enorme physische und künstlerische Leistung ist und entsprechend vom Premierenpublikum gefeiert wurde. Michaela Schuster ist eine gemessen agierende Caesonia, die kunstreich eine Balance hält zwischen Selbstinszenierung und Selbstaufgabe. Countertenor Martin Wölfl als Caligulas Sklave Helicon liefert die spannungsreiche Studie einer lässigen, mit Ambivalenz grundierten Unterwürfigkeit. Das hochkarätig besetzte fünfköpfige (mit abnehmender Tendenz) Verschwörer-Ensemble arbeitet mit uhrwerkhaft feinmechanischer Unruhe und großer Kompetenz. So dass die Gründe für den erstaunlichen Uraufführungserfolg sich recht glücklich auf die Schultern aller Beteiligten verteilen - nach Maßgabe einer kompromisslosen künstlerischen Klarheit in Text und Musik. [ document info ] Dokument erstellt am 08.10.2006 um 17:00:02 Uhr Letzte Änderung am 08.10.2006 um 17:07:54 Uhr Erscheinungsdatum: 09.10.2006 |
|
OPER Ein Glücksfall des zeitgenössischen Musiktheaters: Detlev Glanerts Inszenierung von "Caligula", die jetzt in Frankfurt uraufgeführt wurde. Es geht um den Schrecken von Diktaturen, um Fundamentalismus - und um einen Blick in das Hirn eines Tyrannen. Von Elmar Krekeler Was geschieht uns, wenn unsere Werte nichts mehr gelten? Wenn unserer Welt die Mitte genommen ist, wir aus der Welt gefallen sind, uns jene Drift erfasst, die wir seit dem 11. September ahnen und die uns über den Rand unserer bisher bekannten Zivilisation hinaus zu treiben droht? Wenn alles bisher unerschütterlich Feste in unendliche Bewegung gerät? Musiktheater ist - vorsichtig formuliert - eine eher langsame Kunstgattung. Bis sich Fragestellungen, wie die nach einer Zeit am Ende aller Werte, nicht nur in Interpretationen, sondern Uraufführungen spiegeln, vergeht gern reichlich Zeit. Diktatur in der Oper Insofern ist Detlev Glanerts Camus-Oper "Caligula", die jetzt in Frankfurt uraufgeführt wurde, ein ausgesprochener Glücksfall der Antizipation weltgeschichtlicher Zeitläuft. So aktuell, so universell wie dieser Vierakter, an dem der 48jährige Henze-Schüler seit zehn Jahren herumdenkt, war Musiktheater in Deutschland selten in letzter Zeit. Jedenfalls der Papierform nach. Glanert adaptierte, zusammen mit Hans-Ulrich Treichel, Camus' gleichnamiges, erstes existenzielles Theaterstück, das zwischen 1937 und 1945 entstand. Und mitten in den Schrecken der europäischen Diktaturen und ihres Endes Beginn und Ende der Schreckensherrschaft des römischen Kaisers Caligula spiegelt. Caligula als Fundamentalist der Freiheit Glanerts Oper beginnt mit einem Schrei. Caligulas inzestuös geliebte Schwester Drusilla ist tot. Das hat dem jungen Kaiser, der bis dahin ein vorbildlicher Herrscher war, die Mitte genommen. Von der Drift, der Erschütterung dieses Ereignisses über den Rand seines Selbst hinausgeworfen, verschwindet Caligula und kommt verdreckt und verändert wieder. Ist nun ein Fremder, ein Fundamentalist der Freiheit. Drusillas Tod hat ihn, den Mann ohne Mitte, gelehrt: Die Welt ist ohne Bedeutung, und die Menschen, hat er festgestellt, sterben unglücklich. Caligula will die Menschheit befreien. Will sie mit der kalten Logik der Diktatoren nach seiner Façon glücklich machen, was in eben jener kalten Logik seines Denkens bedeutet: er will, er muss sie umbringen. In vier Etappen führen Glanert und Treichel diesen absichtsvollen Abstieg in den finstersten Wahnsinn vor. Und man sieht ihn, hört ihn von Innen, diesen Abstieg. Glanerts Oper wird laut ausschließlich aus dem Weltinnenraum Caligulas. Und nichts anderes als diesen Weltinnenraum sieht man auf der Frankfurter Bühne. Alexander Lintl gibt dem Haupt- und Staatskammerspiel den Rahmen des Innern einer Kasbah, eines Festsaals der Trauer. Blick in das Hirn des Tyrannen Man blickt nicht nur ins Hirn des Tyrannen, man hört hinein. Man hört ihn, sein Inneres. Glanert entwickelt aus einem über sieben Oktaven geschichteten 27tönigen Akkord, aus einer Melodielinie, einem rhythmischen Modell, was der fiebrigen, die Aggregatzustände ständig wechselnden, geradezu körperhaft anwesenden Partitur eine erhebliche Zwangsläufigkeit gibt. Glanert macht einen fast mitfühlen mit Caligula. Sein Herz schlägt. Sein Hirn rappt. Immer wieder glitzert der Mond (wie er seit vierhundert Jahren ungefähr glitzert). Mal weillt es ein bisschen, mal wagnerts, brahmst es. Und doch fällt nichts auseinander in diesem sehr rhythmischen, sehr eigenständigen, sehr reißenden Fluss namens Caligula. Dessen fehlende Mitte spiegelt Glanert in einem mittelosen Orchester, einem Orchester ohne Mittelinstrumente. |
|
Macht tanzt im Röckchen Ein Schrei gellt durch das Frankfurter Opernhaus, wuchtig ballt sich das Orchester zusammen, um allmählich in einer Art Herzschlag-Rhythmus nervöse Ruhe zu finden. Schon der erste Eindruck von Detlev Glanerts Oper "Caligula" verrät: Den satten Theatereffekt scheut der 1960 geborene Komponist und Schüler von Hans Werner Henze nicht, wenn er seine Hauptfigur, den römischen Kaiser Caligula, auf die Reise einer Selbstbespiegelung schickt. Spiegel sind es auch, die Regisseur Christian Pade anfangs dem Hauptdarsteller Ashley Holland an die Hand gibt; in gut zwei Stunden wird es eine groteske, absurde, abgründige Reise werden. Keine wirkliche Handlung bieten Glanert und sein Librettist, doch packendes Musiktheater, an dessen Ende der Komponist fast einhellig bejubelt wird. In einer fast permanenten Bühnenpräsenz, ganz ähnlich der Elektra bei Richard Strauss, exponiert Glanert diesen Caligula; das Spiel beginnt mit dem Tod der Schwester Drusilla, der die historische Figur einst zum Despoten gemacht haben soll. Doch ein Historien-Drama sieht man nicht: Schließlich hat Hans-Ulrich Treichel sein Libretto "frei nach Albert Camus’ Schauspiel" gehalten. Dort ist Caligula weniger als historische Figur, sondern als Typus dessen, der grenzenlose Macht hat, angelegt. Und so ist auch Pades Inszenierung in der geometrisch-abgezirkelten Ausstattung von Alexander Lintl weitgehend abstrakt gehalten. Dabei geht es im Detail durchaus handfest zu, wird vergifteter Wein gereicht, erfahren an Ketten hereingeführte Dichter ihr Todesurteil mit der Trillerpfeife, wie überhaupt gelegentlich anfallende Leichen einfach durch eine Klappe im Boden entsorgt werden. Vier Akten umfasst das Machtspiel in all seinen absurden Auswüchsen. Das kann gelegentlich bizarr wirken, wenn die Hofschranzen devot vor dem Tyrannen kuschen, und hat selbst Züge einer absurden Komik, die gerade Treichels exzellentes Libretto unterstreicht: Man huldigt dem Kaiser sogar, wenn er im farbigen Röckchen auftritt, weil er glaubt, Venus zu sein, und den Mond heiraten will. In dieser völlig grotesken Szene kommt die ganze Wandlungsfähigkeit von Ashley Hollands Bariton in der gewaltigen Titelpartie zum Tragen, der den Despoten hier wunderbar lächerlich falsettieren lässt. Glanerts Musik ist wirkungsvoll, indem sie die letztlich spätromantische Ästhetik mit modernen Effekten versetzt. Ihre strenge, aus einem 25 Töne starken Akkord entwickelte Konstruktion klingt in ihrer hoch farbigen Instrumentierung keinen Augenblick kopflastig. Caligulas Gattin Caesonia ist im vierten Akt sogar eine regelrechte Arie gegönnt, die Michaela Schuster leidenschaftlich wie eine Verismo-Nummer aussingt; ein sattes Duett zwischen beiden fehlt ebenso wenig wie voluminöse Chor-Drastik. Dirigent Markus Stenz, Generalmusikdirektor in Köln, bekräftigt mit dem Museumsorchester, dem hier die Mittelstimmen der Bratschen fehlen, die Ausdrucksextreme nachdrücklich, der vorzügliche Countertenor Martin Wölfel als Sklave Helicon ergänzt die vokale Seite bestens. Das Ende: Wieder ein Schrei, dazu Caligulas Ausruf "Noch lebe ich!". Da mussten viele erst einmal durchatmen - manche vielleicht auch, weil eigentliche Avantgarde andernorts stattfindet. AXEL ZIBULSKI |
|
Sonntagsbraten statt Trockenfutter Von Volker Milch
FRANKFURT Sie springt den Hörer förmlich an, die neue Oper von Detlev Glanert: Mit einem markerschütternden Schrei, der nicht mehr menschlich zu sein scheint. Der römische Kaiser Caligula hat seine geliebte Schwester Drusilla verloren und wird versuchen, in vier Akten die Unlogik zu bereinigen, dass der Rest der Welt weiterlebt. Der Operntext von Hans-Ulrich Treichel basiert auf dem Caligula-Drama von Albert Camus. Der Kaiser, der in einem Crescendo des Zerstörungswahns schließlich auch seine Gattin Caesonia ermordet, ist so etwas wie ein negativer Held des Absurden, ein Amok laufender Sisyphos. Der verstörende Schrei des Anfangs führt den Hörer ein wenig in die Irre: Es ist keineswegs eine Schock-Ästhetik, die dem Werk des erfolgreichen Opernkomponisten zugrunde liegt. Detlev Glanert, 1960 geboren, gehört zu einer jüngeren Komponisten-Generation, die sich die Freiheit des schönen Klangs nimmt und auf so manche Material-Erkundungen der Nachkriegs-Musikgeschichte ganz einfach pfeift. Vokales Trockenfutter ist also in diesem Fall nicht angesagt, statt dessen ein saftiger Sonntagsbraten aus Arioso und Ensembles. Das kommt, zusammen mit dem üppigen Orchesterklang, vom Kölner Generalmusikdirektor Markus Stenz in der von seinen Henze-Dirigaten schon vertrauten Delikatesse zubereitet, beim Uraufführungs-Publikum bestens an und führt zu Ovationen - bei Novitäten dieser Art ja bekanntlich keineswegs eine Selbstverständlichkeit. "Caligula" ist ein koproduziertes Auftragswerk der Opern Frankfurt und Köln. Man kann davon ausgehen, dass Detlev Glanerts Umgang mit der menschlichen Stimme ziemlich deckungsgleich mit dem ist, was der Frankfurter Intendant Bernd Loebe von zeitgenössischer Oper in dieser Hinsicht erwartet: Singbares für seine bekanntermaßen exquisiten Besetzungen. Im Einführungs-Gespräch zwischen Komponist und Intendant vor der Uraufführung bestätigte sich diese Allianz, und Glanert selbst schätzte sich glücklich wie weiland Kollege Mozart, da er die Partien seinen Interpreten förmlich in die Kehlen hineinkomponieren durfte. Ein bisschen Hybris gehört wohl naturgemäß dazu, wenn man sich an große neue Oper wagt - das antike Sujet an sich versucht ja schon den Anschluss an eine für die Gattung grundlegende Traditionslinie, auf der wir Poppea, Nero und andere römische Fieslinge und Heroen treffen. Der berüchtigte Caligula wurde auch schon mal in der Barockzeit Opernstoff. Aus der mythischen Sphäre lässt mit Medea, auch sie Psychopathin nach Liebesverlust, eine ähnlich manische, zu vielen Opern-Ehren gekommene Mörderin grüßen. Aus der Historie wird bei Glanert nicht nur das Psychogramm eines Despoten, sondern eine Studie über existenzielle Einsamkeit überhaupt. Das Ungeheuer seziert er dabei keineswegs nur kalt, sondern gibt ihm in seiner veritablen Monster-Partie durchaus die Möglichkeit, mit baritonalem Wohllaut für Sympathie und Verständnis zu werben. Das macht der Bariton Ashley Holland so überzeugend, dass seine Leistung so manche pathetische Fragwürdigkeit dieses opulenten Opernabends in den Hintergrund treten lässt. Glanerts Traditionsbezug ist nicht nur im Plot von geradezu trotziger Deutlichkeit, sondern auch in der Struktur des mit seinen vier Akten und zwei orchestralen Intermezzi symmetrisch angelegten Werks. Sein Glaube an die Möglichkeit großer Oper in dieser Form bestätigt sich zum Beispiel in der Chor-Szene des zweiten Akts, die dem Hörer noch einen Adrenalin-Schub mit in die Pause gibt. Die a-cappella-Mehrstimmigkeit des 4. Akts zaubert fast eine sakrale Aura. Aber nicht nur in der Vokalbehandlung verfügt Glanert souverän über die Tradition. Er lässt auch das üppig besetzte Orchester für einen Klangrausch sorgen, der immer wieder an Richard Strauss erinnert. Kern des Werks ist ein aus 25 Noten sich zusammensetzender "Caligula-Akkord", aus dem Glanert die ganze Oper ableitet. Was sich nach Cluster anhört, führt immer wieder zu den schönsten Dur-Wirkungen, und Glanert ist so weit Meister seines Fachs, dass das Durchkonstruierte der Konstruktion nicht anzumerken ist. Durch die Reduktion der Mittelstimmen erreicht er im Orchestergraben einen aparten "Extremismus", in dem sich immer wieder ein bedrohlich pulsierender Herzschlag durchsetzt. In ihren besten Momenten gewinnt die Oper im Vokalen eine an Alban Berg gemahnende, gewiss auch den Qualitäten des Librettos zu verdankende Intensität. Im Pathos der vollsaftigen Partitur lauert aber auch kolossaler Kitsch, der dann doch wieder an der Möglichkeit großer Oper in dieser unverkrampft süffigen Form zweifeln lässt: Es bleibt ein Unbehagen an der Konsonanz. Glaubwürdigkeit wächst dem Werk aus dem Engagement großartiger Sängerdarsteller in Christian Pades Inszenierung zu: Allen voran der Bariton Ashley Holland mit enormem Durchhaltevermögen in der Titelpartie und Michaela Schusters warm timbrierte Caesonia. Der Countertenor Martin Wölfel springt dagegen, ganz artifizielle Kälte, als böser Puck durch die Handlung: Helicon, Caligulas Sklave. Alexander Lintl (Bühnenbild und Kostüme) mischt in der Kleidung Gegenwart mit historischen Bezügen - ein Hauch von Toga und Sandale darf es im Chor dann doch sein. Christian Pades Inszenierung hat - wie in Frankfurt schon seine Sicht von "The Turn of the Screw" - viele suggestive Momente, am eindrucksvollsten vielleicht in der Einsamkeit Caligulas, dessen Gesicht in einer Linse grotesk vergrößert erscheint. In den Massenszenen dagegen denkt man gelegentlich an die Trivialrezeption des Caligula-Stoffes. Ein bisschen Blut und Spiele darf man der Gattung Oper freilich gönnen. |
|
Freiheit heißt Vernichtung Von Michael Dellith Als Inbegriff des grausamen Gewaltherrschers, der in der willkürlichen Ausschöpfung seiner Amtsgewalt seine Senatoren reihenweise foltern und hinrichten ließ und sich brutalsten sexuellen Ausschweifungen hingab, ist er in die Geschichtsbücher eingegangen. Klar, dass eine legendenumrankte Figur wie der römische Gottkaiser Caligula reichlich Stoff für wissenschaftliche, aber auch belletristische Aufarbeitungen gab, vom monumentalen Sandalenfilm bis zum skandalumwitterten Musical. Albert Camus freilich, der vor dem totalitären Hintergrund eines Hitlers, Stalins und Mussolinis 25-jährig mit „Caligula" sein erstes Bühnenstück schrieb, das der Glanert-Oper zugrunde liegt, interessierten weniger die schlagzeilenträchtigen Exzesse. Vielmehr versinnbildlicht für ihn der Diktator, der nach dem Tod seiner inzestuös geliebten Schwester Drusilla die Sinnlosigkeit des Lebens erkennt und zum Tyrannen wird, die philosophischen Kernthesen des Existenzialismus: Die Menschen sterben und sie sind nicht glücklich. Der Mensch ist ein Witz, die Welt absurd. Der Komponist Glanert geht mit seinem Librettisten, dem Romancier Hans-Ulrich Treichel, der den Dialogen viel poetische Kraft verleiht, noch einen Schritt weiter. Er hat mit „Caligula" nicht nur eine Oper über das Innenleben, den Seelenzustand einer einzigen Figur geschrieben, sondern darüber, wie der Anspruch eines Einzelnen auf absolute Wahrheit und totale Freiheit eine regelrechte Dramaturgie der Vernichtung auslöst. Diese Stationen lassen sich in Glanerts vieraktiger Oper mit stringenter Logik nachvollziehen. Dass dies auch noch unter einem großen Spannungsbogen geschieht, ist in erster Linie der Musik des Henze-Schülers zu verdanken, der Wert auf melodisch-gestische Kantabilität legt, rhythmische Kraft von zuweilen Orffscher Qualität entwickelt und bei allem erstaunlichen Reichtum an Klangfacetten in fast Ravelscher Orchestrierungskunst auf stete Transparenz und Durchhörbarkeit setzt. Dazu kommt die visuelle Kraft der eindringlichen, doch was die Schock-Effekte anbelangt, wohltuend zurückhaltenden Inszenierung Christian Pades – sieht man einmal von dem allzu plakativen Schrei zu Beginn und am Ende der Oper ab. Auch Bühnenbild und Kostüme von Alexander Lintl in ihrer zeitlosen Aktualität und dem im existentialistischen Schwarz gehaltenen Bühnenkasten, der gelegentlich dramaturgisch geschickt eingesetzte Fensteröffnungen freigibt, fügten sich stimmig in das Konzept. Hervorragende Arbeit leistete der Neue-Musik-Kenner Markus Stenz am Pult des Museumsorchesters, das unter seiner umsichtigen, souverän-konzentrierten Leitung atmosphärisch dicht gestaltete. Grandios in der nuancenreichen Darstellung und sängerischen Flexibilität der Bariton Ashley Holland in der zentralen Partie des Caligula, ihm zur Seite Michaela Schuster mit warm und ausdrucksstark timbriertem Mezzo als anhängliche Caesonia und der gewandte Countertenor Martin Wölfel als zwielichtiger Sklave Helicon. Von starker Präsenz war auch Jurgita Adamonyté, die erstmals an der Frankfurter Oper gastierte, in der Hosenrolle des Scipio. Gregory Frank und weitere erfahrene Ensemblemitglieder wie Hans-Jürgen Lazar und Barbara Zechmeister ergänzten trefflich das Solisten-Team. Auch der von Alessandro Zuppardo subtil vorbereitete Opernchor trug mit seinen mystisch anmutenden Gesängen einen nicht unerheblichen Beitrag zum positiven Gesamtergebnis bei. „Caligula", das steht fest, ist eine Oper, die es nicht verdient, nach ihrer Uraufführung in der Archiv-Schublade zu verschwinden. Sie hat das Zeug zum Repertoirestück. |
|
Habt doch Mitleid mit Diktatoren Von Heinz Zietsch FRANKFURT. Mit einem Schreckensschrei beginnt und endet die Oper „Caligula" von Detlev Glanert, die am Samstag in der Oper in Frankfurt als Koproduktion mit der Kölner Oper uraufgeführt wurde. Das Publikum applaudierte lange und nicht ohne Begeisterung für das zweidreiviertel Stunden dauernde Werk nach dem gleichnamigem Schauspiel von Albert Camus, das Hans-Ulrich Treichel zu einem Libretto umgeformt hatte. Endlich ein modernes Musiktheaterstück, das fast schon wieder auf traditionelle Weise mit der alten Opernform arbeitet – wie gehabt: mit durchaus ansprechender Musik, die auch vor tonalen Anklängen nicht zurückscheut, die sogar mit arienhaften Melodien aufwartet, sich beim Jazz und der zeitgenössischen Popularmusik bedient, diese aber so kunstvoll verbrämt, dass man die Anleihen bis hin zum Rap, etwa wenn sich mehrere Personen angeregt unterhalten, gar nicht als solche wahrnimmt. Vor allem aber, was bei vielen modernen Opern nicht selbstverständlich ist, dass der Zuschauer zu mehr als siebzig Prozent versteht, was gesungen wird. Dennoch ist man froh darüber, den Text per Schriftzug am oberen Bühnenrand mitverfolgen zu können. Im alten Rom lässt Regisseur Christian Pade die Geschichte um Caligula nicht spielen, das war ja auch bereits bei Camus nicht so gedacht, sondern in der Gegenwart. Dennoch bedient sich Ausstatter Alexander Lintl einiger Anleihen aus der römischen Antike, denn die Bühne gleicht einer Katakombe mit Oberlicht und Luken einerseits, aber auch einem modernen Hochsicherheitsgefängnis mit schweren Stahltüren andererseits. In der Mitte ein Kasten, der einer Bühne ähnelt, auf der sich Caligula anfangs die vielen Spiegel die ihn umgeben, herunterreißt, nachdem er vom Tod seiner von ihm inzestuös geliebten Schwester Drusilla erfahren hat, die gleichsam als Mondgesicht per Video zu sehen ist. Für Caligula ist dieser Kasten eine Art Seelenraum, dort inszeniert er sich selbst als Venus. Er ist ein verrückter Kaiser, der danach trachtet, sich mit dem Mond zu vermählen, der sich als Gott verehren lässt und auf der Suche nach der Wahrheit und der Freiheit seine Mitmenschen verachtet und umbringt. Denn was ist das für ein Leben, fragt er sich, in dem man unglücklich ist und sterben muss? Die Menschen revoltieren schließlich gegen diesen Tyrannen, doch der ruft am Ende „Noch lebe ich", als könne man seiner Tyrannei selbst heute nicht mehr Herr werden. Camus behandelt in seinem Schauspiel auf philosophisch-spitzfindige Weise die Absurdität des Lebens. Und diese Sicht greifen Glanert und sein Librettist Treichel umstandslos auf. Genau hier liegt der Knackpunkt: Vor sechzig Jahren hätte man diesen Blick auf die Absurdität des Daseins noch akzeptiert. Doch heute scheint dieser Blickwinkel nicht mehr einsehbar zu sein und höchst fragwürdig dazu. Denn ohne ironische Distanz, die das Absurde überspielt, wirkt die Geschichte so, als wollte sie verständnisvoll um Mitleid mit den Diktatoren werben. In der heutigen Zeit mit Erscheinungen des Terrorismus und des Fundamentalismus, die selbst westliche Demokratien gefährlich nahe an diktatorische Maßnahmen herantreiben, ist diese naiv-arglose wie kritiklose und philosophisch verbrämte Sicht auf einen plumpen unmenschlichen Tyrannen politisch äußerst problematisch, zumal außerdem im Programmheft behauptet wird, Caligula sei im Grunde seines Herzens gar nicht so böse, sondern suche nur nach dem Absoluten von Wahrheit und Freiheit. So fragwürdig Glanerts Oper vom Stoff her sein mag, so packend wurde sie realisiert. Markus Stenz, Generalmusikdirektor der Kölner Oper, dirigierte das Werk äußerst umsichtig, achtete stets auf die Balance der Dynamik und darauf, dass die Sänger nicht zugedeckt wurden, allen voran Ashley Holland in der Titelpartie, die viele stimmliche Nuancen und Darstellungskünste abverlangt, und Michaela Schuster als Caligulas Frau Caesonia, deren Mezzosopran sich gerade in dieser Rolle wie ein flexibler dramatischen Sopran anhörte. Geschmeidig auch der Countertenor Martin Wölfel als Helicon, dem bedingungslosen Vertrauten Caligulas. Faszinierend außerdem die Leistung des Chors, der zudem als Bewegungschor choreografisch bestens geführt wurde. |
|
Größenwahn und Tyrannei Von Frieder Reininghaus "Caligula" - der Name des spätrömischen Kaisers steht für Grausamkeit und Cäsarenwahn. In den Kontext seiner Zeit und ihrer totalitären Erfahrungen stellte zum Beispiel Albert Camus sein Drama Caligula. Es bildet die Vorlage für eine neue Oper des 1960 geborenen Komponisten Detlev Glanert, der schon öfter - nach dem Vorbild seines Lehrers Hans Werner Henze - nach Literaturvorlagen komponiert hat. Nun hatte seine Oper in Frankfurt Premiere. Keineswegs zufällig setzte sich Albert Camus in den späten 30er und den frühen 40er Jahren mit dem durchgeknallten römischen Kaiser Caligula auseinander. Es entstand ein Drama in der Zeit, in der die großen Diktaturen Europas zum Höhepunkt ihrer Machtentfaltung und Gewaltentfesselung gelangten, dann teilweise rasch kollabierten. In der 1945 uraufgeführten Version des Stücks geht es um Anpassungswilligkeit, opportunistische Ergebenheit und die bis zur Selbstverleugnung reichende Loyalität der Paladine - und einen Führer, einen "Sonnenkönig", der alle Mitmenschen wie Planeten und Trabanten auf Umlaufbahn um seine egozentrische Person bringt. Die erste Fassung des Werks enthielt biographische Fermente aus den Biographien Hitlers und Stalins, Details aus dem Kreml und der Reichskanzlei (Camus muss sehr gutes Material besessen haben, vielleicht von dem aus der UdSSR ausgebürgerten "abtrünnigen" Leo Trotzkij). In der endgültigen Fassung versuchte der Dichter dann aber, das Funktionieren von Diktaturen und Diktatoren allgemeiner zu fassen und psychologisch in den Griff zu bekommen. In dieser Grundlinie folgt ihm der Librettist Hans-Ulrich Treichel und der Komponist Detlev Glanert. Glanert schrieb eine versierte Theatermusik, die sich ihrer Effekte sicher sein darf (und die vom Frankfurter Premierenpublikum in vollen Zügen goutiert wurde): Da insistiert der pochende Herzschlags eines herzlosen Caligula in den Zwischenaktmusiken auf dem Primat der "Innenansicht" von Machtverhältnissen. Ein extremer Schrei des Protagonisten angesichts des Tods seiner über alles geliebten Schwester kündigt die Exzesse an und kehrt am Ende wieder, wenn der Kaiser einem Attentat zum Opfer fällt: nur zwei Jahre liegen dazwischen - eine Zeitspanne, die Abertausende Opfer forderte, das Imperium außer Rand und Band brachte. Den Extremsituationen trägt die Tonspur Rechnung mit der Orchesterbesetzung, in der alle mittleren Instrumente fehlen - es gibt keine Bratschen, keine Holzbläser in mittlerer Lage. Glanerts Tonsatz bekennt sich zur Tradition deutscher expressiver Musik mit mannigfachen Anspielungen auf Richard Strauss, Gustav Mahler, Franz Schreker und andeutungsweise sogar die "Mondnacht" von Eichendorff und Schumann. Eher ist seine Partitur geeignet, Schönheitssehnsucht und gleisnerische Glücksversprechungen Caligulas zu illustrieren als mit kaltem Blick die Unsäglichkeit menschlicher Überheblichkeit und staatlichen Terrors "auszudrücken". Die schwelgerischen Intensitäten aber kostet Markus Stenz mit dem Frankfurter Orchester nach besten Kräften aus. Michaela Schuster erhebt die gegenüber dem Unrecht stumpfe opportunistische Kaiserin zu einer wirklich zentralen Rolle; konsequent ist, dass auch sie sich wie ein Lamm schlachten lässt. Ashley Holland gebärdet sich in der Titelpartie wie der junge Rainer Werner Fassbinder, die Kraft der Stimme hält mit den Kraftgebärden der Darstellung des hochintelligent-feinsinnigen Zynikers nicht ganz mit. Enttäuschend fiel die "Caligula"-Bildsphäre von Alexander Lintl aus, in deren bauhausgeprägter Abstraktion sich Caligula als Venus-Transe ebenso hervorhebt wie ein Arsenal formschöner Marterwerkzeuge für die Huldigungsdichter und andere hündische Untertanen. Die Inszenierung vermeidet jeden Bezug zu Despotien und Mediensonnenstaatstendenzen der Gegenwart und folgt darin dem Zug zu Begütigung, der in Libretto und Musik bereits massiv angelegt ist. Die Anstößigkeit Caligulas wurde auf bemerkenswerte Weise gebändigt. |
|
Frankfurt/Main (Urafführung)Detlev Glanert CALIGULA Die Opern des Komponisten Detlev Glanert sind bisher durch die Bearbeitung wichtiger und interessanter Stoffe aufgefallen, so "Der Spiegel des grossen Kaisers" nach Arnold Zweig, das Judendrama "Joseph Süß", "Scherz, Satire, Ironie und tiefere Bedeutung" (komische Oper nach Grabbe) und auch die Kinderoper "Die drei Rätsel", die eben in Deutschland und Italien nachgespielt wird. Bei seinem neuen Bühnenstück "Caligula", ein Auftragswerk der Opern Frankfurt und Köln, muss diesbeüglich zumindest ein Fragezeichen gesetzt werden. Zwar kann auch hiermit "Namen" aufgewartet werden wie Albert Camus, nach dessen gleichnamigen Theaterstück Hans-Ulrich Treichel das Libretto frei verfasst hat. Aber alle Opern über römische Kaiser gleiten oft unfreiwillig in Komik ab, da sie meist wahnsinnig gewordene Imperatoren zum Subjekt haben. Wie auch Königshäuser nach den römischen Reich bringt es die Abkapselung des 'erwählten' Hauses wie hier des julisch-claudischen mit sich, dass es bei seinen Gliedern verstärkt zu Inzest gekommen ist, so bei Caligula mit seiner Schwester Drusilla, mit deren Tod die Glanert-Oper einsetzt. Der Wahnsinn kommt bei Caligula nur in anderer Form zum Tragen als z.B. bei Nero. Da stellt sich mir wirklich die Frage: muss derartiger Wahnsinn immer noch philosophisch aufgeplustert werden, und das Lachen über die Auswüchse kann einem ja angesichts der Anzahl der daraus resultierenden Toten im Gesicht gefrieren. Würde denn jemand so einfach eine Oper über Hitler schreiben? Glanert betont, dass er sich mit dem Stoff auseinandergesetzt hat, aber jetzt mal dahingestellt, inwieweit ihm der Stoff vom Auftraggeber vorgegeben war, er hat inzwischen eine solche Kompositions-Routine, dass er wahrscheinlich alles in Musik umsetzten könnte. Im Körper des Caligula sei für ihn seine gesamte Caligula-Musik involviert. Das hebt diese (Un)Person wirklich noch in höchste Höhe. Und wie ist diese Musik? Sie zerfällt in zwei Grundmuster. Zum einen in das mehr rezitativische, das viel mit überraschenden Orchester-Einsprengseln arbeitet, ansonsten die ganze Pallette der Perkussivinstrumente ins Spiel bringt, während die Gesangsstimmen oberhalb des konventionell Erwartbaren geführt werden. Auf der anderen Seite eine vieleicht als Venus- und Mondmusik zu bezeichnende eigentlich sehr tonale Musik, die sich mit ihrem Flimmern und Glimmern eindeutig auf R.Strauss bezieht. Diese Verästelungen und minimalistischen Differenzierungen sind zwar höchst virtuos vor allem bei den Streichern eingesetzt, können aber für sich nichts originär Innovatives reklamieren. Am origenellsten noch ein zwischendurch placierter abgrundtief herber Sound, bei dem auch Bassposaunen resp. Wagnertuben zu wuchtiger Geltung kommen. Uberspitzt könnte man sagen , bei den eher rhytmisch-rezitativen Teilen bezieht sich Glanert auf Strawinki und H.W.Henze, bei den lyrisch-kontemplativen auf Strauss/Zemlinski/Schreker. Aber trotzdem hat er wieder den Beweis erbracht, dass er exzellent für Riesenorchester die traditionelle Oper aufleben lassen kann, der Dirigent Markus Stenz hebt sie aus der Taufe, und dabei denkt man nur manchmal, vielleicht könnte es noch gleissender, noch wuchtiger klingen, denn zeitweise wirkt der Sound eher stumpf. Trotzdem kann dem Museumsorchester ein grosser Abend bescheinigt werden, und Stenz hat sicherlich seinen Anteil daran. Auf der Bühne wird das Drama subtil und psychologisch ausgespielt (Regie: Christian Pade). Oft hat man mehr den Eindruck eines Kammerspiels denn grosser Oper. Das Bühnenbild und Kostüme Alexander Lintls sind auch eher dezent, der Palast fast abstrakt-klassischder kleine mittige Raum, in dem auch Videos projiziert werden, Spiegel auftauchen etc. wirkt mystagogisch. Wenn die Verurteilten auftauchen, drücken sie die Wände, des Palastes ein, sonst ist der gute Chor oft als geisterhafte Stimmen von aussen wahrzunehmen. Ashley Holland singt und spielt den Caligula aussergewöhnlich gut, sein Bariton ist ein Juwel an Wohllaut und auch in den Ausbruchstellen immer dosiert und nobel eingesetzt. Michaela Schuster als Caesonia hält ihm auch an Schönstimmigkeit die Waage, als sklavisch ergebene erscheint sie auch im Kostüm immer bizarrer und sexier. Der Helicon wird vom erstklassigen Countertenor Martin Wölfel im biederen Bayerndress verkörpert. Cherea ist der gewohnt starke Gregory Frank, der Caligula in geschliffener Weise mit seinem Bass Paroli bietet. Ein lyrischer junger Scipio ist Jurgits Adamonyte, die mit schönquellendem Mezzo besticht, und auch der Mucius des Hans-Jürgen Lazar setzt sich brillant expressiv in Szene. Die Halbschwester Livia (Barbara Zechmeister mit aufblühendem Timbre) wird zu Beginn von Caligula vergewaltigt, übt sich sodann nur noch in vorauseilendem Gehorsam. Vier gute Dichter bei einem Wettbewerb, die von Caligula mit Trillerpfeife abgewürgt werden, sind Constantin Neiconi, Michael Schulte, Jin Soo Lee und Matthias Holzmann. Friedeon Rosèn |
|
Solitudine di un imperatore Grande successo della prima mondiale dell'opera "Caligula" di Detlev Glanert all'Oper Frankfurt. Fedele al dramma di Camus, il libretto di Hans-Ulrich Treichel sottolinea gli aspetti esistenziali del personaggio e la sua solitudine. La partitura di Glanert coniuga un linguaggio moderno con elementi in continuità con la tradizione melodrammatica. Ottimi tutti gli interpreti diretti da un convincente Markus Stenz.
Nell'eterogeneità di colori e umori orchestrali, che variano dal tragico al grottesco, Glanert compone una partitura saldamente ancorata alla tradizione, per la struttura musicale caratterizzata da lancinanti squarci lirici di sapore berghiano, per le forme chiuse ripensate in chiave moderna e per il sapiente uso di mezzi musicali in funzione drammaturgica. Centrale il ruolo del coro, sia come commento interiore ai deliri di Caligola, sia come catalizzatore di spettacolo in linea con la grande tradizione melodrammatica. Ottimi gli interpreti, su cui dominano il Caligola di Ashley Holland, la dolente Cesonia di Michaela Schuster, l'Elicone di Martin Wölfel e lo Scipione di Jurgita Adamonyte. Ammirevole pure la prova del coro. Markus Stenz dirige con grande dedizione, trovando un miracoloso equilibrio fra l'ottima Frankfurter Museumorchester e i cantanti. La regia di Christian Pade, pur non priva di spunti efficaci, non riesce a rendere appieno la ricchezza espressiva del testo. Accoglienza entusiastica al compositore, al direttore e agli interpreti. Stefano Nardelli |
|
All'opera a Colonia L’eterno "Caligula" Detlev Glanert elabora dal dramma di Camus di Gianluigi Mattietti Allievo prediletto di Hans Werner Henze alla Musikhochschule di Colonia Detlev Glanert ha ereditato dal maestro una spiccata inclinazione per il teatro musicale, che lo ha portato a essere uno degli operisti più importanti in Germania (Scherz, Satire, Ironie und tiefere Bedeutung ha avuto già 80 rappresentazioni). Ora, coprodotta dai teatri di Francoforte e di Colonia, è andata in scena Caligula, opera, decisamente riuscita, costruita come un perfetto meccanismo teatrale. A colpire il compositore era stata la struttura del dramma di Camus (da cui è tratta) dove tutto promanava da un solo personaggio: "Caligola non è un pazzo, ma una creatura razionale che fa degli esperimenti con gli esseri umani, come Hitler o Stalin. Caligola crea il suo laboratorio umano dove forza i personaggi a reagire come agen-ti chimici, e questi non hanno alternativa che la morte". Glanert ha tradotto la centralità drammaturgica della figura dell’imperatore in un accordo di 29 note da cui viene tratto anche tutto il materiale musicale per gli altri personaggi, come se essi fossero anche musicalmente solo emanazioni della sua mente. Gli umori di Caligola, i suoi pensieri, si trasformavano così in una musica cupa, tormentata, dalla forte carica abrasiva (messa bene in risalto dalla direzione di Markus Stenz), con un’orchestrazione che riduceva al minimo gli strumenti dal registro medio (eliminando le viole), tutta concertata nei registri estremi. Ma una musica solidamente composta, nella quale si coglieva il gusto per l'intenso lirismo, per il gesto tematico mahleriano, per i raffinati impasti timbrici raveliani. Glanert è anche riuscito a creare una tensione supplementare aggiungendo dei suoni registrati, all’inizio e alla fine di ogni atto, che riproducevano il battito cardiaco e il respiro di Caligola, e poi il coro fuori scena, bellissimo, che prolungava i suoi pensieri. Il baritono Ashley Holland ha interpretato un imperatore dalla voce robusta, di forte presenza scenica ottimamente contrappuntato dagli altri personaggi: tra cui spiccavano la maestosa e commovente Cesonia del mezzosoprano Ursula Hess, il controtenore Martin Wolfel nei panni dello schiavo Elicone, Pristina Wahlin in quelli di Scipione. L’allestimento di Christian Pade, con scene e costumi di Alexander Lintl, immergeva la vicenda in uno spazio senza tempo delimitato da fondali neri, con un cubo girevole nel quale venivano costruite le diverse scene, punteggiato, da elementi crudeli (schiavi in gabbia, cadaveri sanguinanti sui divani) e da fulminei movi-menti di massa, imprevedibili, come i pensieri di Caligola. |
|
mundoclasico.com Calígula, el amor, la frivolidad y el desgarro total José Luis Ruano 'Calígula' es la ópera comisionada por la Opera de Frankfurt y de Colonia, estrenada mundialmente esta temporada en Frankfurt, con música del compositor Detlev Glanert y con libreto de Hans-Ulrich Treichel, basado en el drama teatral Calígula de Albert Camus, estrenado en 1945. Esta ópera es, en palabras del compositor, su primera composición lírica y trata sobre la vida interior y los sentimientos interiores de un sólo personaje, y sus consecuencias en el mundo exterior. Estos dos planos, el de la reflexión interior y el del mundo circundante donde acontecen las crueldades de Calígula, son los límites entre los que oscila como péndulo la música y la acción teatral. Un grito desgarrador marca el comienzo y el fin de la ópera, la desgarradura total del mundo interior. Calígula muere dos veces, la primera cuando se extingue el alma en su pecho ante el insoportable dolor causado por la muerte de su hermana-amante Drusila: la muerte es la que destruye la unidad armónica de los amantes, esto lo contemplamos en la primera imagen teatral. Y al final de la ópera, cuando la muchedumbre lo golpea y apuñala.
Hans-Jürgen Lazar, Gregory Frank, Barbara Zechmeister, Dietrich Volle (Lepidus), Michaela Schuster, Jurgita Adamonytė, Martin Wölfel y Ashley Holland Fotografķa © 2006 by Monika Rittershaus Cuatro actos ilustran el teatro de la crueldad y el absurdo existencial. El primero tiene por motivo la desesperación de Calígula originada por la muerte de su hermana y su convicción del absurdo de la vida. El segundo acto es el juego de Calígula con sus súbditos, que concluye con su credo, Calígula reconoce como único principio el desprecio. El tercer acto es una gran fiesta en honor a Venus: Calígula es ahora Venus, la metamorfosis en la divinidad amorosa es la visión y proyección psicológica del deseo subconsciente de Calígula. En Venus cree reconocer a su hermana Drusila y sentirse más cerca de su espíritu. El acto final no puede inevitablemente ser más que la muerte de la bestia. La vuelta de Calígula con un perturbado espíritu es el comienzo de un gran experimento. En palabras de Christian Pade: "él tiene que seguir en vida sin conocer la razón, igual que tampoco hay una razón para morir". Con estas especulaciones existenciales se debate Calígula en su fuero interno y decide convertir su imperio en un grandioso laboratorio de pruebas. Helicón pregunta como Pilatus "¿Qué es la verdad, Calígula?", y él responde:"Los hombres mueren y no son felices". La locura del yo da paso a la absoluta libertad del individuo Calígula que es vivida matando, violando y aterrorizando a sus súbditos. Alcanzar lo imposible al borde de lo absurdo, Calígula le piede a Helicón le traiga la luna. La cena de los conspiradores en el segundo acto es la primera degustación del teatro de la crueldad. El emperador irrumpe en medio de los senadores y patricios que en prueba de su fidelidad beberán la sangre de esclavos, Livia cae bajo las garras de Calígula y es violada con fría desigualdad en presencia de su marido. Los senadores vomitan ante tal repugnante espectáculo. Su próxima víctima es Mereia, al que obliga tomar veneno. El tercer acto es una fiesta en honor a Venus proclamada a voces por Caesonia y Helicón, aquí Calígula -transformado en una blue drag queen- induce a una danza ritual a corte y esclavos. El hastío que invade a Calígula es distraído por sus poetas a los que retiene encadenados. Convierte la invención poética en una tortura, el emperador proclama una competición literaria: el tema, la muerte, el tiempo de exposición, un minuto. Todos los poetas fracasan y como es práctica en estos casos, son condenados a ejecución inmediata. Tan solo Scipio, un joven patricio, aplaca por pocos instántes la sed de emoción del insano. Aquí se desarrolla un diálogo incipiente y cierta interacción de personajes que queda irresulta al paso de la siguiente escena. Es caso ya decidido que esa misma noche se ponga fin a la bestia. Pero antes cometerá con sus propias manos el último crimen, estrangula a su esposa Caesonia que en una desesperada muestra de su amor le entrega su vida.
Hans-Jürgen Lazar y Michaela Schuster Fotografía © 2006 by Monika Rittershaus Este es un momento de recogimiento fenomenalmente comentado orquestalmente, y tanto Schuster como Holland crean una atmósfera mezclada de intensidad y desesperación, son los últimos momentos ante la muerte, una escena que invade por su gran impacto teatral y musical. Los conspiradores han lanzado a sus perros sanguinarios, la muchedumbre golpea y apuñala al emperador. Sus últimas palabras, "Aún vivo", ponen fin al drama. Mejor empezar por lo que funcióno y después seguir por lo que no funcionó. El virtuoso espectáculo de teatro, conjugado con la detallada régie de Christian Pade, son muestra de la gran capacidad de esta casa en temas de Musiktheater moderno. Los decorados se fijan plásticamente como réplica de la situación vivida en cada escena, las vídeo-proyecciones reflejan la rápida dinámica de pensamientos de Calígula. En la primera escena, y por su puntual aplicación, son un medio sabiamente utilizado. Los vestuarios se adaptan como segunda piel al rol-carácter desempeñado: algunos van vestidos más villanos, otros -los esclavos, por ejemplo- muestran en su desnudez la vulnerabilidad del individuo expuesto al puro azar y arbitrariedad, Caesonia siempre tiene un aire de distinguido glamour, Calígula irrumpe con demostrativa brutalidad demostrando una virilidad despótica. La coreografía alcanzó un depurado y perfecto ensamblaje entre música, acción y palabra. En suma, un altamente sofisticado producto de Musiktheater.
Michaela Schuster, Ashley Holland y 'Chor und Statisterie der Oper Frankfurt' Fotografía © 2006 by Monika Rittershaus Pero precisamente el desarrollo teatral en cuatro actos abre sus cráteres, el espectador se convierte en fugaz visitante de las diversas estaciones de Calígula echando en falta un hilo de la acción dramática que nos hiciese llegar a entrar de lleno en el íntimo laberinto de horrores del in-humano emperador. Es más, los otros personajes que circulan como órbitas azarosas en torno al ego-Calígula, difícilmente consiguen crear una identidad e independencia propias, sólo Caesonia y en ciertos momentos Scipio consiguen traspasar su condición accidental para entrar en el juego teatral de caracteres. El tema de fondo con el que me estado debatiendo es el porqué de la figura y el personaje de Calígula ahora, qué quiere decirnos Glanert con este carácter. ¿Hay algún correlato que lo haga enlazar con nuestra actualidad, es decir, que haga hacernos ganar una valiosa reflexión o que nos de acaso la clave a entender el mundo de irracionalidades que nos ha tocado vivir? ¿Dónde esta el juego metafórico que encapsule la trama con los universos simbólicos del presente? Musicalmente hablando, la partitura de Glanert es una verdadera joya de composición por tratarse de un trabajo compositivo depurado, pulcramente estructurado con una sabia instrumentación, brillante orquestación y con verdaderos momentos de belleza lírica. Detlev Glanert, discípulo de Henze, es un compositor inspirado, de una sólidez compositiva del todo sin par. En su ópera encontramos el monólogo del anti-héroe con ecos de un invisible coro, dúos, tercetos, números de conjunto, interludios orquestales de intensidad lírica insospechada, explosiones orquestales vertiginosas y momentos de intimidad sentida. Glanert no se puede clasificar entre los compositores vanguardistas recalcitrantes y radicales, más bien se encuentra dentro de los moderados vanguardistas, y ello también lo saben agradecer los músicos y el público, al que musicalmente impresionó la frescura y vitalidad de la obra. Hay que decir que mucho del éxito musical se lo debemos a la implacable visión sonora y lectura cristalina de Markus Stenz, ensalzada por la fina calidad tímbrica instrumental, aquí pulida nota por nota, compás por compás, con planos sonoros perfectamente diferenciados. Stenz es el actual Kapellmeister de la Gürzenich Orchester además de GMD (Generalmusikdirektor) en Colonia, todo un especialista en temas de música contemporánea. Ashley Holland demostró una vigorosa robustez baritonal y cumplió con su exigente parte, y por momentos nos hizo sumergirnos en el inconsciente del emperador. A su lado, Michaela Schuster encarnó un rol que conjugó magníficamente con el claroscuro de su voz, deleitando y arrastrando a la audiencia. Su dúo con Ashley fue un momento inspirador. Tanto Martin Wölfel (Helicón) como Jurgita Adamonyte (Scipio), contratenor y alto respectivamente, insuflaron vida a sus papeles que, aunque secundarios, fueron de una excelente factura musical. Los secundarios de Gregory Frank, H-J. Lazar, Volle y Zechmeister llevaron adelante su parte cantada excelentemente, pero en cuanto a su acción dramática, como ya apunté más arriba, quedaron poco implicados en el curso de los acontecimientos. Coro y orquesta cumplieron perfectamente su difícil papel, producto de los alardes sinfónico y camerístico que se alternan en el flujo musical de la partitura de Glanert, sutilmente equilibrado en manos del perfeccionista Markus Stenz. Caluroso pero más bien moderado el triunfo y aplauso en esta tercera representación. Esta producción de los teatros líricos de Colonia y Frankfurt subirá también al cartel en Colonia en los próximos meses. Frankfurt, 15.10.2006. Oper Frankfurt. Calígula, ópera en cuatro actos de Detlev Glanert con libreto de Hans-Ulrich Treichel, basado en el homónimo drama de Albert Camus. Estrenada el 7.10.06 en la Oper Frankfurt. Escenografía y dirección teatral: Christian Pade. Decorados y vestuarios: Alexander Lintl. Dramaturgia: Norbert Abels. Luminotecnia: Olaf Winter y Joachim Klein. Elenco: Ashley Holland (Caligula, emperador); Michaela Schuster (Caesonia, su esposa); Martin Wölfel (Helicon, esclavo); Gregory Frank (Cherea, procurador); Jurgita Adamonytė (Scipio, un joven patricio); Hans-Jürgen Lazar (Mucius, senador); Dietrich Volle (Mereia/Lepidus, noble romano); Barbara Zechmeister (Livia, esposa de Mucius); Constantin Neiconi, Michael Schulte, Matthias Holzmann, y Jin-Soo Lee (cuatro poetas). Coro estable de la Ópera de Frankfurt (Alessandro Zuppardo, director) y Frankfurter Museumsorchester. Dirección musical: Markus Stenz. Aforo 95% |



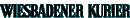


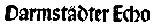



 Nell'opera di Glanert, andata in scena in prima assoluta a Francoforte, protagonista è la solitudine. Il bel libretto di Treichel, fedele al dramma di Camus, tratteggia la tragica parabola esistenziale dell'imperatore romano. La morte della sorella e amante Drusilla lo rende consapevole del destino degli uomini ("Gli uomini muoiono e non sono felici") e segna l'inizio della sua sfida esistenziale. Nell'incessante richiesta allo schiavo Elicone di portargli la luna, c'è il senso della sua utopia: "Portami l'impossibile e tutto sarà possibile", che mette a nudo la tragica solitudine di Caligola nei due passaggi emotivamente più forti dell'opera (il contrasto con il giovane Scipione e l'ultimo scambio la moglie-madre Cesonia).
Nell'opera di Glanert, andata in scena in prima assoluta a Francoforte, protagonista è la solitudine. Il bel libretto di Treichel, fedele al dramma di Camus, tratteggia la tragica parabola esistenziale dell'imperatore romano. La morte della sorella e amante Drusilla lo rende consapevole del destino degli uomini ("Gli uomini muoiono e non sono felici") e segna l'inizio della sua sfida esistenziale. Nell'incessante richiesta allo schiavo Elicone di portargli la luna, c'è il senso della sua utopia: "Portami l'impossibile e tutto sarà possibile", che mette a nudo la tragica solitudine di Caligola nei due passaggi emotivamente più forti dell'opera (il contrasto con il giovane Scipione e l'ultimo scambio la moglie-madre Cesonia).


