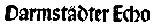|
Anders als die Normalbürger DARMSTADT. In seiner Jugend war ihm Wagner besonders nahe, denn der Bass-Bariton Ralf Lukas, Sohn eines Organisten, wuchs in Bayreuth auf. Als Statist hatte er schon während seiner Gymnasialzeit bei den dortigen Festspielen mitgewirkt und lernte so auch Chéreaus „Ring"-Inszenierung kennen. Zur Musik selbst kam er durch die Mitarbeit bei einer Theatergruppe an seiner Schule. Nach erstem Gesangsunterricht mit vierzehn Jahren studierte er nach dem Abitur an der Hochschule der Künste in Berlin. Zwischen 1987 und 2002 gehörte Lukas dem Ensemble der Deutschen Oper in Berlin an, wo er heute noch seinen Wohnsitz hat. Seit er zwischen 1999 und 2001 den Wotan im „Ring" in Münster (Westfalen) übernommen hatte, ist er ein international gefragter Wagner-Sänger, sei es bei den Salzburger Festspielen, an der Bayerischen Staatsoper München oder an der Metropolitan Opera in New York. Im vergangenen Jahr gab er sein hoch gelobtes Debüt als Donner bei den Bayreuther Festspielen. Und in John Dews Wiesbadener „Ring"-Inszenierung (2003–2005) sang Lukas ebenfalls den Wotan, wobei seine noble Baritonstimme und seine vorzügliche Textverständlichkeit gerühmt wurden. Der Darmstädter Intendant John Dew hat jetzt für seine Inszenierung von Wagners „Fliegendem Holländer" Ralf Lukas mit der Titelpartie betraut. Zum ersten Mal habe er diese Rolle 2002 in Würzburg gesungen, erzählt der sympathische Künstler in einem Gespräch. Damals habe Katharina Wagner, die Tochter des Bayreuther Fespielchefs Wolfgang Wagner, Regie geführt. Wie ist jetzt in der Darmstädter Aufführung die Figur des Holländers angelegt? „Der Holländer ist anders als die anderen", erklärt Lukas. So passe er gut zur Senta, denn auch sie sei anders als die Normalbürger. Er sei ein Fremder, ein Getriebener, ein Suchender, ein Leidender an seiner Existenz, sagt der Bariton weiter. Weil der Holländer nicht sterben kann, sucht er eine Frau, die ihn liebt bis in den Tod, denn dann erst wird er vom Schicksal des ewigen Umhergetriebenseins erlöst. Senta fühlt sich durch den Holländer in eine ausweglose Situation gebracht und stürzt sich deshalb ins Meer. In Darmstadt wird sich Dew auf die Urfassung stützen, die noch nicht den musikalischen Erlösungsschluss kennt, sondern eher abrupt endet. Um diesen Spannungsbogen zu halten, wird das Stück ohne Pause gespielt und voraussichtlich knapp zweieinhalb Stunden dauern. Das Bühnenbild, erklärt Lukas, sei abstrakt, die Kostüme wirkten historisch stilisiert. Beeindruckt ist der Sänger von der starken Lichtregie und vom guten Arbeitsklima am Staatstheater. Dew hat Wagners „Holländer" zuletzt im März 2004 am Theater in Saarbrücken inszeniert. Premiere Am Samstag (31.) ist die erste Aufführung von Wagners Oper „Der fliegende Holländer" um 19.30 Uhr im Großen Haus des Staatstheaters Darmstadt (Premieren-Abo PM, PM+). Lukas Beikircher dirigiert, das Bühnenbild stammt von Thomas Gruber, die Kostüme von José Manuel Vázquez. (hz) |
|
|
Wagner für Kinder Von Sonja Jordans DARMSTADT. Im Zuschauerraum des Darmstädter Staatstheaters ist es plötzlich still. Wo eben noch rund 200 Kinder lachten und durcheinander redeten, ist nur noch die Stimme des Dirigenten Lukas Beikircher zu hören, der im Orchestergraben mit seinen Musikern spricht. Er hebt die Arme, und kraftvoll schwillt die Musik an. Die ersten Takte aus Richard Wagners „Der fliegende Holländer" füllen den Raum. Fasziniert lauschen die Kinder der wuchtigen Musik. Schüler verschiedener Altersklassen aus Bensheim, Gernsheim und Darmstadt erlebten gestern Vormittag eine Bühnen- und Orchesterprobe des „Holländers" im Staatstheater Darmstadt. Die jüngsten unter ihnen sind Grundschüler, die ältesten Gymnasiasten, die sich das Thema für ihren Unterricht selbst ausgesucht haben. Alle haben Wagners Oper zuvor im Unterricht behandelt. Für viele Kinder ist es der erste Besuch in einem Theater. Mit der Einladung beging Darmstadt den Welttheatertag, den das Internationale Theaterinstitut seit 1961 feiert. „Oper und Theater kommen heutzutage bei vielen Kindern und Jugendlichen zu kurz", sagt Theaterintendant John Dew. „Eltern nehmen ihre Kinder nicht mit ins Theater, weil sie denken, es schickt sich nicht." Dabei, sagt Dew, ließen sich selbst kleine Kinder für die Oper begeistern. „Dass nur die Schule sich dieses Themas annimmt, ist nicht richtig." An diesem Vormittag sind es ausschließlich Schüler und Lehrer, die Zeugen der Probe werden. „Wir bearbeiten diese Oper im Unterricht, sehen uns die Probe an und werden im April in eine Aufführung gehen", sagt Lehrerin Kristiane Klockenbring, die mit einer vierten Grundschulklasse aus Bessungen im Theater ist. Dass die Geschichte des Fliegenden Holländers und die schwer verständliche Kunstsprache Wagners für die knapp Zehnjährigen ungeeignet sein könnte, glaubt Klockenbring nicht. „Das Interesse der Kinder an Theater und Oper ist vorhanden, sie müssen nur kindgerecht herangeführt werden." Daran arbeite die Schule. „Damit die Kleinen genau wissen, was auf der Bühne passiert, haben wir die Oper zuvor auf CD angehört, über die Entstehungsgeschichte und den Komponisten gesprochen." Theaterpädagogin Susanne Bánhidai hat den Kontakt zwischen Schulen und dem Staatstheater hergestellt. „Wir erklären den Schülern, wie lange es dauert, bis ein Stück aufgeführt werden kann, wer daran mitwirkt und wie viel Arbeit dahinter steckt." So werde das Interesse am Theater geweckt. Auch Bánhidai ist nicht der Meinung, dass der Fliegende Holländer für Kinder schwer nachvollziehbar sein könnte. „Gerade an der Geschichte des Holländers sind Kinder geistig nahe dran", sagt die Theater-Mitarbeiterin. „Sie kennen die Thematik aus Kinofilmen oder Science-Fiction-Geschichten." Intendant Dew erklärt den Kindern, welchen Schwierigkeiten sich ein Regisseur zu stellen hat. „Beim Holländer kommt natürlich ein Schiff vor. Dieses allerdings auf die Bühne zu bringen, ist nicht ganz so einfach." Also entwarf der Bühnenbildner Thomas Gruber eine große Treppe, die den Eindruck erwecken soll, sie gehöre zu des Holländers Segler. Musikdramaturgin Karin Dietrich erklärt dem Publikum unter anderem, wie an einem Theater gearbeitet wird und ab wann Orchester und Sänger erstmals zusammen arbeiten. „Mir gefällt die Musik", sagt die zwölfjährige Annika, nachdem sie die ersten Takte des „Holländers" gehört hat. „Trotzdem sehe ich mir lieber ein Musical an, das kann ich besser nachvollziehen, und die Sprache ist einfacher." |
|
|
Große Oper statt Seminar Von Elfriede Schmidt Mit einem kräftigen „Hojoje!" geht der norwegische Seefahrer Daland mit seiner Mannschaft an Land, trifft dort auf das unheimliche schwarze Geisterschiff des „Fliegenden Holländers", der einem Fluch zufolge nur alle sieben Jahre eine Küste anfahren darf und nach einem „liebend Weib" sucht, das ihm treu ist bis in den Tod und ihn damit erlöst. Sterben wegen eines Mannes? „Käme nicht in Frage", wehrt sich die resolute Vassilaki Eleftheria aus dem VHS-Qualifizierungskurs für Migrantinnen gegen einen solchen Opfertod und ist jetzt gespannt, wie das Alber Concert Theater München die frühe Oper von Richard Wagner am kommenden Sonntag (18.) um 20 Uhr auf der Rüsselsheimer Theaterbühne in Szene setzt. Die VHS hatte die Pianistin und Musikschuldozentin Anna-Maria Haas für die Einführung der Kursteilnehmerinnen in die Oper engagiert. Statt EDV, Pflegeseminare und Praktika im Hotel- und Gastgewerbe hörten die insgesamt zwölf Frauen jetzt große Oper, hörten neben Sentas berühmter Ballade vom Fliegenden Holländer und Orchesterpassagen auch Ausschnitte aus den Männerchören und am Ende Sentas hochdramatischen Liebesschwur, mit dem sie sich über die Klippen stürzt und den Holländer erlöst. An zwei Vormittagen erläuterte Haas in den VHS-Räumen im Landrat-Harth-Heim etwa die Rolle der Senta, zu der sie als Vergleich den nicht weniger dramatischen Liebestod der Carmen in Bizets gleichnamiger Oper heranzieht: In der Romantik mit ihrer visionären Sagenwelt Senta als ein Opferlamm, dort im späteren Realismus die starke, selbstbewusste Zigeunerin, die die persönliche Freiheit und Entscheidung über alles setzt. Gestern erläuterte die Referentin weitere Besonderheiten dieser Oper, in der Wagner nach der Leitmotivtechnik vorgeht, indem er den Personen jeweils eine bestimmte, immer wiederkehrende Melodie zuordnet. Wie in jeder Oper mit ihren gesungenen Dialogen geht es in dem Dreiakter um große Gefühle, um Liebe, Opferbereitschaft, Reichtum (den sich Sentas Vater Daland vom Holländer erhofft) und die Vision der jungen Senta, die den Holländer zunächst auf einem Gemälde in der Spinnstube und wenig später leibhaftig vor sich sieht und so fasziniert ist, dass sie darüber den Verlobten Erik völlig vergisst und, um ihre Hingabe zu beweisen, sich opfert und mit dem Aufschrei „Hier steh ich treu bis in den Tod" ins Meer stürzt. Zwei Ziele verfolgt die VHS mit diesem von der Arbeitsagentur bezuschussten Qualifizierungsprojekt für arbeitslose Migrantinnen: die Vermittlung von Bildung und Kultur innerhalb von Integration und den Abbau von Hemmschwellen vor den Kulturtempeln. Eine einzige der Frauen, die aus Spanien, Italien, der Türkei und aus Griechenland kommen, hat bisher das Theater schon einmal besucht bei einer Kabarettveranstaltung mit Kaya Yanar. Gestern gab Anna-Maria Haas darum praktische Tipps für einen Theaterbesuch, wies auf Informationsblätter und die Tageszeitung hin und riet dazu, sich das Bühnenbild und die Bühnendarsteller samt Kostümen und Maske genau anzusehen und daraus Schlüsse zu ziehen. „Der Holländer ist meist grau geschminkt, beim Erik wäre grüne Kleidung denkbar", sagt Haas und geht auf die Entstehungszeit der Oper ein, die ganz am Anfang von Wagners Schaffen steht und auf eine dramatische Schiffsfahrt des Komponisten bei Gewitter und Sturm zurückgeht. |
|