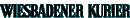|
Mozarts Oper "Idomeneo" in Wiesbaden VON BERNHARD USKE Die wichtigste Nachricht zuerst: keine abgeschlagenen Götterköpfe auf der Bühne, keine Beleidigung von Propheten. Die Premiere von Wolfgang Amadeus Mozarts Idomeneo ging, ohne dass die Gemüter sich stärker erhitzen mussten, über die Bühne des Wiesbadener Staatstheaters, Cesare Lievi setzt ungerührt seinen hiesigen Mozart-Zyklus mit der 1780 entstandenen opera seria des 25-jährigen Komponisten fort. Die hat sich, wie die gesamte Geschichte der Oper bis herauf zu Wagner, des heidnischen Götterinterventionismus gern bedient, um spannungsreiche- sei's schuldbeladene, rachelüsterne oder hoffnungssehnende - Artikulationen zu erzielen: Der auf der Bühne nicht anwesende, außerirdische Dritte als Würze für die bessere Schmackhaftigkeit der ansonsten oft etwas farblos bleibenden Stoffe. Gut, dass wir ihn haben, den vergangenen heidnischen Götterhimmel: abschwellend sind die göttlichen Bocksgesänge, seit der christliche Okzident sie zu einer Größe im Gemütshaushalt des kunstsinnigen Publikums entmächtigte und zu reizvollem artistischem Material veredelte. Eine Regie-Guillotine mit rollenden Götterköpfen im Stile des Neuenfels'schen Musiktheater-Talibanismus braucht man nicht, auch scheint man in Wiesbaden das Libretto richtig gelesen zu haben. Ein einziges Mal lachte das Publikum - vielleicht in purer Selbsterkenntnis, denn das Bild, das Ilia, die liebesverzweifelte Prinzessin der besiegten Trojaner mit ihrem über den Kopf gezogenen Schultertuch machte, verwandelte sich wohl nur in den Köpfen der Zuschauer in eine Burka. Ganz nebenher werdendie Götter verscheucht Zuletzt, als Idomeneo, der sich auf den Götterkuhhandel eingelassen hatte, alles hinter sich hat, Neptun durch Jupiter besänftigt, der Opfergang dank guter Seelenführung fast aller Beteiligter abgeblasen und das neue Gesetz à la "Deus caritas est" ausgerufen ist, macht der König ein paar verscheuchende Gesten Richtung Schlachtopferaltar, schlägt seinem Zeremonienmeister den Stab aus der Hand und jagt den Oberpriester davon - das war's. Und sonst? Ein stilisiertes griechisches Gestade mit in die Bühne ragender Säulenhalle ganz in Weiß, im Hintergrund azurne Griechenlandbläue, die bei der neptunischen Bestrafungsaktion sich in aufschäumende Wassermassen verwandelt. Das klassizistische Ambiente, kühl, glatt und designt wie ein Prada-Shop (Bühne: Csába Antal) wird in Momenten menschlich-göttlicher Konflikte in Farbe getaucht (Licht: Luigi Saccomandi): mal glänzen die Säulen waldmeistergrün, mal bonbonrosa. Vermutlich ist Idomeneo, die letzte von Mozarts Opern vor seinem ersten großen Wurf, der mittlerweile indexverdächtigen Entführung aus dem Serail, wirklich dramaturgisch zu schwach und zu wenig abgründig. Aber eine der schönsten Chor-Opern ist sie allemal. Dass zu den vier, fünf großen Chor-Komponisten der Operngeschichte neben Gluck, Verdi und Mussorgsky auch Mozart gehört, das liegt nicht zuletzt an den herrlichen Auftritten der Sieger- und Verlierervölker im Idomeneo. Der Wiesbadener Opernchor, einstudiert von Christof Hilmer, der mal als Kriegsheimkehrergruppe und dann würdig gekleidete Trauergesellschaft eingekleidet war (Kostüme: Marina Luxardo), hatte großen Anteil am Erfolg des Abends. Die Mitglieder des kretischen Königshauses waren in stilisierte Mäntel gewandet, die nach der Agamemnon-Affäre bei Idomeneo untergekommene, seinem Sohn versprochene Elektra trat in höfisch-strengem Schwarz auf. Allein die unbeschwert zwischen den personalen Schwerpunkten sich bewegende, wahre Geliebte des Königssohn Idamante - die Trojaner-Prinzession Ilia - hatte ein heiter-flattriges Outfit. Die zahlreichen Personalkonstellationen im Hin- und Her von Staatsraison, Götterwille, Liebe und Eifersucht werden von Lievi in klaren Bewegungszügen und Raumpostierungen verdeutlicht. Elektra, jene Außenseiterin, die auf der Strecke bleibt ist neben Idomeneo die interessanteste Figur, die von Annette Luig in verschlossener und doch sinnlich brodelnder Darstellung gut getroffen wird, wenngleich der furiose Aspekt des Selbstzerstörerischen in der schönen, aber zu zarten Stimme begrenzt ist. Die beiden anderen Frauenstimmen, Thora Einarsdottir als Ilia und Ute Döring in der Hosenrolle des Idamante, waren trefflich besetzt mit einer quirligen, manchmal fast derb anmutenden, wasserklaren Stimme einerseits und einer kernigen, sehr gut geführten Stimme auf der anderen Seite. Makellos auch der Arbaces und der Oberpriester von Jud Perry und Angus Wood. Alle überragte Kobie van Rensburg in der Titelrolle - ein tenorales Großkaliber, enorm substantiell und dabei emotional vollkommen beweglich. Das Orchester des Staatstheaters unter Marc Piollets animierender Leitung war in den wunderbar sensibel gebrachten Partien atmosphärischer Entrückung, in den artistisch raffiniert gefassten Marcia-Passagen und den Meereswogen-Lineaturen exzellent, die Rezitativ-Begleitung von Julia Palmova am Hammerflügel bestechend in harmonischer Gewichtung und phraseologischer Geschmeidigkeit. [ document info ] Dokument erstellt am 15.10.2006 um 16:32:04 Uhr Letzte Änderung am 15.10.2006 um 16:42:51 Uhr Erscheinungsdatum 16.10.2006 |
|
Ruhig und nah an der Handlung erzählt Von Axel Zibulski
WIESBADEN Keine besonderen Vorkommnisse: Anders, als offenbar höchst vage Gerüchte vermuten ließen, gab es vor dem Wiesbadener Staatstheater nicht die Spur eines Protests im Zusammenhang mit der Premiere von Wolfgang Amadeus Mozarts Oper "Idomeneo", in Deutschland immerhin die Neuinszenierung Nummer eins, seit vor wenigen Wochen an der Deutschen Oper Berlin die Wiederaufnahme der drei Jahre alten Hans-Neuenfels-Inszenierung abgesagt wurde. Neuenfels ließ neben den Köpfen von Christus, Buddha und Poseidon auch das Haupt Mohammeds rollen - eine blutige Angelegenheit, die keineswegs nur von Muslimen als blasphemischer Akt gedeutet wurde. Auch in der Wiesbadener Neuinszenierung fließt Blut, doch, wenn´s beruhigt, nur verhältnismäßig wenig. Mozarts Titelfigur, der antike Kreter-König Idomeneo selbst ist es, der sich hier am Ende den Dolch in die Brust stößt. Auch das eine kleine Zutat gegenüber Mozart und seinem Librettisten Gianbattista Varesco, wenngleich keine provokante, sondern eine durchaus diskutierbare, haben doch zuvor die Götter nur um den Preis, dass Idomeneos Sohn Idamante die Macht des Königs übernimmt, auf das von Idomeneo geforderte Menschenopfer in Gestalt eben seines eigenen Sohnes verzichtet. Insgesamt bleibt Regisseur Cesare Lievi freilich seiner Ästhetik, seiner ruhigen, nah an der Handlung verlaufenden Erzählweise treu, wie er sie auch bei den bisherigen Stationen seines Wiesbadener Mozart-Zyklus gezeigt hat. Ob "Zauberflöte" oder "Le nozze di Figaro", ob "Cosd fan tutte" oder, wie jetzt, "Idomeneo": Schwache Momente, in denen das Geschehen schlicht statuarisch wirkt, bleiben nicht aus, aber er findet auch atmosphärisch starke Bilder; beides war jetzt auch in der "Idomeneo"-Premiere zu sehen. Mächtige Säulen auf der rechten Bühnenseite, flache Stufen links davon - das ist das Einheitsbühnenbild, das Csába Antal für Lievi und diesen Wiesbadener "Idomeneo" errichtet hat. Nichts, was auf dieser offenen Bühne gezeigt wird, bliebt hier wirklich privat, nicht die Liebe Idamantes zu der Trojanerin Ilia, nicht die Eifersucht Elettras, die Annette Luig mit grenzwertigen Schärfen ihres Soprans immerhin rollendienlich und überdeutlich aufzeigt. Lievi selbst deutet eher an: Stimmungswechsel ereignen sich zwischen gleißend hellem Tageslicht und matter Düsternis, Wasser erscheint nur auf einer fernen, ruhigen Video-Projektion, und den Strand von Kreta, an den Idomeneo nach langer maritimer Irrfahrt gespült worden ist, markiert lediglich das Treibgut eines Autoreifens. Effekte bleiben ausgesucht, etwa wenn am Ende ein Glitzerregen über dem neuen Königspaar Idamante, vom neuen Ensemble-Mitglied Ute Döring als scharf konturiertes Figurenporträt tadellos gestaltet, und Ilia niedergeht - in der Partie der Trojanerin bietet Thora Einarsdottir mit ihren silbrigen, unbeschwerten Koloraturen einen der vokalen Höhepunkte. In dieser Hinsicht wirkt Tenor Kobie van Rensburg, einziger Gast-Sänger der Premiere, in der Titelpartie manchmal weniger agil, zeigt aber feine, strahlende Höhen. Jud Perry als sein Vertrauter Arbace, Angus Wood als Oberpriester und Christoph Stephinger als aus dem Off dringende Orakelstimme ergänzen die Premierenbesetzung; fast alle Partien hat das Staatstheater übrigens doppelt besetzt. Ob Kriegsgefangene, Volk von Kreta oder Priesterschar: Eine ungewöhnlich starke dramatische Beteiligung hat Mozart in seiner Opera seria für den Chor vorgesehen, und der von Christof Hilmer einstudierte Opernchor wird diesen Aufgaben auch durchweg gerecht. Nicht ganz ungetrübt bleibt anfangs der Eindruck vom Staatsorchester, das dem anfeuernden Dirigat von Marc Piollet in der Ouvertüre noch mit etwas mehr Elan folgen dürfte; nicht immer punktgenau die hier von Mozart so exponierten Bläserstimmen. Spätestens im dritten Akt hat sich freilich das unter Piollet vertraute Niveau eingestellt, verraten aufschäumende Streicher starke Affekte, klingt sein Mozart elastisch, schlank und präzise. Und nicht zuletzt die Straffung der ausladenden Rezitative erhöht in musikalischer Hinsicht noch einmal die Spannung in diesem ganz und gar skandalfreien Wiesbadener "Idomeneo". |
|
Freiheit und unerhörte Kühnheit Kritik von Midou Grossmann Barock? Barock? Fünfmal wird dieses Wort im Theaterjournal des Hessischen Staatstheaters Wiesbaden benutzt, wenn es um eine Zuordnung von Mozarts Opera Seria ‚Idomeneo’ geht. Und es schien auch so, als ob das Leading Team ganz bewusst auf eine barocke Aufführungspraxis gesetzt habe. Marc Piollet wählte zumeist sehr breite Tempi, die so sicher nicht immer gerechtfertigt waren. Temperament zeigte er nur bei der Marsch- und Ballettmusik, aber auch da sehr gezügelt, was bei seiner französischen Herkunft sehr überraschte, kann man doch sagen, dass sich Mozart mit seinem ‚Idomeneo’ der französischen Oper annäherte. Fünf lange Jahre wartete der Komponist auf einen geeigneten Opernauftrag, da kam dem 25jährigen 1781 der Auftrag von Karl Theodor, eine Oper für den Münchner Karneval zu schreiben, wie eine Befreiung vor. Gerade aus Paris zurückgekehrt, wirft er sich ins Schaffen und Alfred Einstein schreibt: „Im Grunde war Mozart nie unabhängiger als im ‚Idomeneo’. Er hat dieses Werk in einem wahren musikalischen Rausch geschrieben. Zum erstenmal darf er ins volle greifen, zum erstenmal in der Oper ist er Herr aller Mittel." Und das zeigt auch die gewaltige Beteiligung des Chores, der Abschluss des ersten Aktes mit einer Chaconne, die Märsche sowie die Ballettmusik unterstreichen diese Entwicklung, die gänzlich frei und zukunftsorientiert ist. Freiheit und eine unerhörte Kühnheit prägen Mozarts Werk. Unter all seinen Werken soll er den ‚Idomeneo’ immer hochgehalten und geliebt haben. Das alles war in der Regiearbeit von Cesare Lievi nicht zu spüren, oratorienartig wurde sich auf der Bühne bewegt, allzu oft im Takt zur Musik, was keine Spannung aufkommen ließ. Der Fairness halber muss erwähnt werden, dass Ilia und Elettra zuweilen auch leichtfüßig über die Bühne rennen durften, doch dies wirkte zumeist wie ein gesuchter Effekt. Es wurde allzu oft auf Effekt inszeniert und eine Welt der schönen Bilder präsentiert, was beim Publikum allerdings sehr gut ankam, das Werk aber ‚verkleinerte’. Auch die ‚Bereicherung’ der Handlung mit einer geplanten Kinderopferung und Idomenos Selbstmord am Schluss, trugen nicht zur Intensivierung des Geschehens bei. Das Einheitsbühnenbild von Csába Antal erinnerte an das Urlaubsland Griechenland, auch die Kostüme (Marina Luxardo) konnten die Handlung nicht verdichten. Ilia präsentiert sich als flippig moderne Urlauberin, Idamentes Outfit gleicht dem eines Hotelpagen und das strenge schwarze Kleid mit Mantille, welches Elettra trägt (man fragt sich zuweilen, was sie eigentlich auf Kreta zu suchen hatte) wirkt etwas zu plakativ; natürlich fehlen auch die so beliebten Tarnanzüge für das Wachpersonal nicht. Luigi Saccamandi versäumt es subtile Nuancen mit seiner Lichtregie zu zeichnen, zumeist war man einem grellen Bühnenlicht ausgeliefert, wohl als Anlehnung an die helle Mittelmeersonne gedacht, da kann auch das Kerzenlichtambiente im dritten Akt nicht mehr versöhnen. Somit waren Sänger gefordert eine dramatische Komponente auf die Bühne zu bringen und das taten sie teilweise recht beeindruckend. Kobie van Rensburg, zumeist von der Regie alleingelassen, versuchte schauspielerische Akzente zu setzen, stimmlich war er der Partie gewachsen und zeigte eine gute Leistung mit tenoralem Glanz. Berührende Momente lieferten Ute Döring (Idamante) und Thora Einarsdottir (Ilia), die zudem auch den ganzen Abend über eine konstant gute Gesangsdarbietung zeigten. Da hatte es Ute Döring schwerer, ihre Stimme ist letztendlich zu klein für die Partie der Elettra, obwohl das Orchester sie auf Händen trug, war die Tragfähigkeit der Stimme sehr limitiert. Positiv aufgefallen sind der junge Amerikaner Jud Perry in der Rolle des Arbace sowie der Chor des Hauses. Unterm Strich fehlte der Inszenierung die Freiheit und unerhörte Kühnheit, mit der Mozart diese Oper schrieb und man hatte das Gefühl, einen selten schönen Schmetterling zu sehen, der aufgespießt und eingerahmt zur Schau gestellt wurde. |