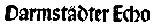|
Ein Fest für die Sinne Von Klaus Trapp DARMSTADT. Als Carl Orffs Vertonung der Tragödie „Antigonae" des Sophokles in der Übersetzung von Friedrich Hölderlin 1949 bei den Salzburger Festspielen uraufgeführt wurde, kam dies einer Sensation gleich. Achtzehn Schlagzeuger neben sechs Flügeln, neun Kontrabässen und zahlreichen Bläsern waren im Einsatz, um das rhythmisch-farbige Fundament zu legen für einen deklamatorischen Gesang, der die bedeutsame Sprache in den Vordergrund rücken sollte. Zehn Jahre später erschien Orffs Version von „Oedipus der Tyrann" in ähnlicher, wenn auch ein wenig spröder Form. Für die Darmstädter Aufführung beider Werke (die Premieren sind am 2. und 3. Dezember) hat Generalmusikdirektor Stefan Blunier die Orchesterbesetzung abgespeckt, um die vielen Schlaginstrumente im Graben überhaupt unterbringen zu können. Elf Schlagzeuger werden die zum Teil exotischen Perkussionsinstrumente bedienen, fünf Bässe und vier Flügel müssen ausreichen. Dennoch, so Blunier im Vorgespräch, wird das Klangbild der ursprünglichen Intention Orffs entsprechen. Orff, der nach dem Ersten Weltkrieg als Kapellmeister in Mannheim und Darmstadt (1918/1919) gewirkt hatte, bevor er sich 1920 in München niederließ, hat für seine Musikalisierung der Trauerspiele des Sophokles sich bewusst von der romantischen Oper abgewandt. Aufbauend auf dem Welterfolg seiner „Carmina burana" von 1937 fand er zu einer Musiksprache, die „dem Wort seine zentrale Bedeutung auf der Bühne" zurückgeben sollte. Blunier betont, dass weite Strecken des Hölderlin-Textes rein akustisch zu verstehen sind und dass das dunkle, vielschichtige Idiom Schwierigkeiten beim gedanklichen Nachvollzug mache. Doch Bedeutung, Atmosphäre und Gestik der Szenen seien offenkundig. So ergibt sich in der für Darmstadt gewählten Folge der beiden Werke die eine Tragödie aus der anderen. Am Anfang steht das Schicksal des Oedipus, der sich selbst blendet, nachdem er erfahren hat, dass er unwissend den eigenen Vater Lajos tötete und seine Mutter Jokasta heiratete. Antigonae, eine Tochter des Oedipus, begräbt trotz königlichen Verbots ihren im Kampf gefallenen Bruder Polyneikes und löst so, im Zwiespalt zwischen Religion und Politik, eine weitere Katastrophe aus. Die Inszenierung durch John Dew wird die Zeitlosigkeit des antiken Mythos betonen. Stefan Blunier verspricht ein Fest der Sinne, wenn die Darsteller vor einer Goldwand agieren, die durch Beleuchtungseffekte in unterschiedliche Farben getaucht wird. Für die selten gespielten Werke war allerdings eine besonders lange Vorbereitungszeit nötig, was vor allem auch den Chor betrifft, der bei Orff, getreu der griechischen Tragödien-Tradition, besonders wichtig ist. Für die extrem schwere Partie des Oedipus wurde Norbert Schmittberg als Gast gewonnen. Yamina Maamar tritt als Jokasta auf, Katrin Gerstenberger singt die Rolle der Antigonae. Schon jetzt zeichnet sich laut Theater das überregionale Interesse an dieser mutigen Doppel-Premiere ab, die gleichsam ein Orff-Festspiel werden soll. Am Samstag (2.) ist die Premiere des „Oedipus" um 19.30 Uhr, um 19 Uhr gibt es eine Einführung im Foyer, am Sonntag (3.) hat „Antigonae" Premiere, beginnt aber bereits um 18 Uhr, um 17.30 Uhr gibt es dazu ebenfalls eine Einführung im Foyer. Die beiden Aufführungen (Premieren-Abo PM) im Großen Haus dauern mit einer Pause jeweils etwa zweieinhalb Stunden. | |
| |
|
Oedipus-Prunk: Wie 450 Quadratmeter Gold ins Theater kamen Von Bert Hensel König Midas: In der griechischen Mythologie ist er jener, bei dem sich alles in Gold verwandelt, was er berührt. Wie sehr er diese Gabe zunächst von Dionysos erfleht und bekommen hatte, so sehr empfand er sie später als Last.Doch wie sehr hätte Midas jetzt, über 2750 Jahre später, dem Staatstheater Darmstadt helfen können. Indem er die schwere Last der Goldbeschaffung leichthändig übernähme. Denn für die Aufführung von Orffs „Oedipus der Tyrann" (Premiere morgen, Samstag, 19.30 Uhr) braucht es Gold, Gold, Gold für die gewünschte Kulisse. Das Bühnenbild soll die Illusion erzeugen, dass der Prunk-Palast von König Oedipus aus purem Gold bestehe. Weshalb die Mitarbeiter des Malersaals im Staatstheater fast 450 Quadratmeter Wand und Säulen optisch entsprechend herrichten mussten. Wie packten Malsaal-Chef Armin Reich (52) und fünf seiner Kollegen das in wochenlanger Arbeit? Und welche mutmaßliche Goldmine mussten sie dafür vorher finden und nutzen? Die Antwort: Bei dem prachtvoll schimmernden Material auf der Bühne handelt es sich um sogenanntes Kompositionsgold, das auch Schlagmetall genannt wird. Es ist hauchdünn, besteht zum größten Teil aus Messing und Zinn – ist aber von echtem Gold optisch kaum zu unterscheiden. Schlagmetall gibt es in Quadraten von 16 mal 16 Zentimeter im Fachhandel. Rund 16 000 (!) Blatt davon mussten die Traumgestalter in der Theaterwerkstatt fürs gewünschte Resultat verarbeiten. Wobei sie, weitab von Goldfinger Midas, eher in die Stress-Situation von Sisyphos gerieten. Der war wegen Gotteslästerung zum Steinestemmen aus dem Untergrund verdammt. Im Staatstheater Darmstadt ging’s auch ohne Fluchen an die Arbeit. Dennoch: Es war nervenaufreibend viel zu tun. „Für jede Vergoldung", so lässt Armin Reich wissen, „waren insgesamt acht Arbeitsvorgänge erforderlich. Unter anderem muss der Untergrund extrem gut vorbereitet werden." Wozu spachteln und mehrfach streichen gehören. Dann wird der Kleber aufgetragen, für den Spezialisten das Fachwort Mixion parat haben. Erst dann können die goldenen Schlagmetallblätter aufgebracht werden – „angeschossen", wie es bei Profis heißt. Feingespür bewiesen auch die Auszubildenden Nadine Wehrli (17) und Ramona Greifenstein (23). Denn schon durch leichten Luftzug kann das Material davon fliegen oder sich kräuseln. In Berührung mit Haut oxidiert es. Was erneut beweist: Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Aber in diesem Fall eine glänzende Leistung. | |
| |
|
Darmstadts Intendant Dew | |
|
Frankfurter Rundschau: Herr Dew, als Sie in der letzten Spielzeit-Pressekonferenz ankündigten, es werde zwei Orff-Opern geben in Darmstadt, blitzte es in Ihren Augen - als würde das Thema Orff Ihnen besonders nahe gehen. Stimmt das?John Dew: Ja. Oedipus, der Tyrann habe ich vor 35 Jahren kennen gelernt, und seitdem war es mein Traum, diese Oper einmal live zu erleben - das war mir bisher nicht vergönnt. Seit 35 Jahren halte ich also Ausschau nach einem Sänger, der den Oedipus singen kann. Ich hatte dann einen im Visier, den ich seit 15 Jahren sozusagen pflege und dem ich vor drei Jahren den Klavierauszug zuschickte. Drei volle Jahre hat er nun daran gearbeitet. Auch in der Antigonae gibt es solch ein Rollenproblem, für die Partie des Kreon: Zwei in Frage kommende Sängerdarsteller haben mir abgesagt - sie könnten das nicht lernen, es würde sich einfach nicht lohnen. Und das waren zwei äußerst taffe Typen, die eigentlich die merkwürdigsten Sachen zu singen imstande sind. Schließlich hat sich ein Sänger aus dem Ensemble freiwillig gemeldet. Und ein weiteres Puzzlestück hatte mir auch immer gefehlt: Ein Chor, der so etwas singen kann. Acht Monate hat unser Chor hier nun daran geprobt, vor drei Monaten war er am Rande der Verzweiflung und hat gesagt: Es wird nicht gehen. Was genau ist so schwierig daran? Die Chorsänger haben ausgerechnet, dass sie an einer Stelle 145 Worte auf einem einzigen Ton zu singen haben. Man muss wissen, dass man schon beim Lesen dieser Worte verrückt werden könnte. Orff verwendete hier den Sophokles-Text ja in der Übersetzung von Friedrich Hölderlin, die mehr als seltsam ist. Es hat mir bislang keiner erklären können, warum in diesem Text die Syntax so kurios ist. Ich vermute, Hölderlin hat sich von der griechischen Syntax verleiten lassen. Konstruktionen, die sicherlich auf Griechisch verständlich sind, muss man nun fünfmal lesen, bis man weiß, worum es geht. Warum hatte Orff den Text in dieser schwer rezipierbaren Form belassen? Die Musik zur Antigonae hatte der Nazi-Politiker Baldur von Schirach bei Orff bestellt, weil damit die Schauspielmusik des unerwünschten Mendelssohn, die immer zu Hölderlins Antigonae gespielt wurde, ersetzt werden sollte. Doch ähnlich wie Stalin über die bei Schostakowitsch in Auftrag gegebene, so witzig geratene neunte Sinfonie wenig erfreut war, dürften auch die Nazi-Größen nicht erfreut gewesen sein über Orffs Antigonae: Denn es wurde ein Werk gegen die Hybris, höchst elitäre Musik mit afrikanischen Instrumenten! Aber so, zusammen mit dem zehn Jahre später entstandenen Oedipus, haben wir zwei der größten Musiktheaterwerke des 20. Jahrhunderts. Das Hauptproblem ist also der Text? Er wird weitgehend unverständlich bleiben, obwohl wir uns um möglichst klare Deklamation bemühen. Trotzdem ist jede Szene kristallklar, und ich frage mich, ob Orff sein letztes großes griechisches Stück, den Prometheus, nicht deswegen auch auf Griechisch komponiert hat, weil er gemerkt hatte, dass die Sprache letztlich unerheblich ist. Aber ging es Orff bei diesen Opern nicht gerade um Verständlichkeit? Hat er nicht gesagt, das traditionelle Opernorchester etwa der "Elektra"-Größe würde den Text heillos überlagern und müsse auf das Notwendigste reduziert werden? Der Text an sich ist das Komplizierte. Hölderlins Sprachgewalt bricht über einen herein wie ein Wasserfall, man kann sich nach einer Weile nicht mehr wehren. Der Effekt gerade der Chöre ist überwältigend. Orff hatte ja eine Rückbesinnung auf die griechische Tragödie im Sinn. Nun weiß man aber nicht allzu viel darüber, wie damals wirklich ein Sophokles-Stück aufgeführt wurde, oder? Es gibt lediglich Theorien. Man geht von einem rezitierenden Sington aus, ohne Begleitung, und einem Spiel mit Masken. Das mit den Masken hatte ich nie wirklich geglaubt, bis ich die Frankfurter Produktion der Antigonae am Schauspiel gesehen habe. Das war derart gut! Suchen Sie als Regisseur hier nun ebenfalls die Annäherung an die Antike? Mit Masken, mit strenger geometrischen Führung? Nein, keine Masken. Und ich weiß auch nicht, ob das mit den geometrischen Figuren, mit dem Laufen im Kreis, wirklich so praktiziert wurde oder ob man das nicht heute in diese antiken Theaterbauten hineinprojiziert. Orffs Musik verleitet zu expressiven körperlichen Ausbrüchen, wir mussten uns da eher bremsen. Wir versuchen es schon mit dem griechischen Ideal der Moderation zu halten, also nicht zu viel Emotion zu zeigen. Carl Orff war ja in Darmstadt Kapellmeister, allerdings lange vor seiner "griechischen" Phase. Darmstadt hat also eine gewisse Orff-Tradition. Ich hatte Orff hier einmal selbst erlebt. 1976 pilgerte ich von Ulm, wo ich gerade Assistent war, nach Darmstadt: Orff las im Foyer seine Komödie Astutuli - ich habe kein Wort verstanden, weil es auf Bayerisch war. Aber den Eindruck werde ich nie vergessen. Orff hatte das gesamte Schlagzeug ersetzt nur durch einen Tisch, er hämmerte auf diesem Tisch wie ein Besessener, er sprach, sang und erzeugte eine fantastische Musik. Die Musik zu "Oedipus" und "Antigonae" ist da schon aufwändiger: Unter anderem sechs Piccoloflöten, sechs Klaviere, zehn Gongs, dafür keine Streicher außer Kontrabässe - wie lösen Sie das? Wir mussten die Proben teilweise in einem Klaviergeschäft abhalten. Allerdings haben wir die Besetzung leicht reduziert, nach Orffs Angaben. Bei den Gongs dachte ich, dass wir kein Problem hätten, denn vor meiner Zeit wurde ein ganz teures Set angeschafft, für ein anderes Stück - aber die sind alle einen Ton zu hoch. Der Verleger Ricordi hatte einst den Komponisten Puccini darauf gedrängt, für Gong nur in der gleichen Tonhöhe zu schreiben wie zuvor Franco Alfano in seiner asiatischen Oper Sakuntala. Weil die Theater diese Gongs bereits angeschafft hatten. Sonst wäre Puccini vielleicht nicht so populär worden. Wir haben natürlich vieles ausleihen müssen, die Besetzung ist ja äußerst exotisch. Aber ich habe es noch nie erlebt, dass Leute wie Trauben am Orchestergraben stehen um zu sehen, wie diese unglaublichen Klänge erzeugt werden. Elf Schlagzeuger brauchen wir im Oedipus, für Antigonae etwas weniger. Orff meinte ja auch, die "Antigonae" wäre sein "radikalstes Werk"... ... wobei Oedipus sogar noch verrückter ist! ...und Wieland Wagner schrieb 1951 an Orff: "Ihr Werk ist für mich ein Elementarereignis und die Lösung all dessen, worüber unendlich viel geschwätzt und diskutiert wird." Trotzdem war dieser Weg eine Sackgasse, Orffs neuer Opernstil wurde von niemandem weiter verfolgt, auch nicht von ihm selbst. Warum nicht? Zwanzig Antigonaes würde man nicht ertragen. Es war auch klug etwa von Igor Strawinsky, nach Les Noces etwas völlig anderes zu machen, etwas Neues. Bei Orff ist ja das Besondere: Jede Note klingt nach Orff, aber jedes Stück hat seine eigene, verrückte Idee. Interview: Stefan Schickhaus [ document info ] |
Interview John Dew, der Intendant des Staatstheaters Darmstadt, bringt an zwei aufeinander folgenden Abenden zwei Opern aus Carl Orffs griechischer Phase auf die Bühne: Am 2. Dezember hat "Oedipus, der Tyrann" Premiere, am 3. die Fortsetzung "Antigonae". |
| |