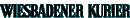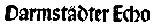|
Staatstheater Darmstadt VON HANS-KLAUS JUNGHEINRICH Im viel weniger auffällig als das Theateräußere neugestalteten Inneren des Großen Hauses Darmstadt öffnet sich der im Schnürboden verschwindende silbrig graue Vorhang mit ähnlich schmetterlingshaft leichter, aber viel weniger kurios-irritierender Eleganz als die mykenisierenden Goldportale der Eingangsschleuse. Der Vorhang mithin hob sich in verheißungsvoller Sekundenpräzision und gab den Blick frei auf eine gehaltvolle Eröffnungspremiere. Hausherr John Dew hatte selbst inszeniert: Leos Janáceks (noch) selten gespielte Oper Schicksal (Osud), verbunden mit dem Monodram Lélio von Hector Berlioz. Die aparte, erstaunlich plausibel funktionierende Werkkombination versteht sich als Teil eines Großprojekts unter dem Motto "Des Künstlers Suche nach der Kunst". Janáceks gut 100 Jahre alter Dreiakter erinnert an Künstlerdramen wie Der ferne Klang von Franz Schreker. Das Sujet streift die Kolportage, wenn Frau und Schwiegermutter am zweiten Aktschluss durch Sturz vom Balkon zu Tode kommen. Bemerkenswert freilich Janáceks auch hier auffällige Obsession fataler Mutterfiguren (Gegenstück zu Verdis schlimmen Vätern). Die Musik macht Kruditäten der Handlung vergessen. Sie ist umweglos lakonisch, abrupt, unredselig im übergangsarmen Aneinandermontieren ostinater Kleinmotive und mit sprachmelodisch orientiertem Vokalstil (was die deutsche Übersetzung leider nicht textverständlicher macht; Übertitel wären vonnöten). Klanghärte und knappe Formung gestatten dennoch Aufwölbungen: hochpathetischer Auftritt des Kindes im zweiten, Monolog der männlichen Hauptfigur, so lang und so gewichtig wie ein ganzes Leben, im dritten Akt. Hier zerbricht der Künstler an einem Lebensschicksal, dessen vollendete Verwandlung in Kunst ihm nicht gelingen will. Norbert Schmittberg als Komponist Zivny nimmt für sich ein mit expressiver, kaum larmoyanter Tenor-Diktion. Kein Fehler, dass seine Partnerin Yamina Maamar (warm timbriert)eine Spur höhergewachsen erscheint; so behält sie etwas von einer Ikone, einer gleichsam unhandhabbaren Kothurn-Gestalt. Unkarikiert gibt Sonja Borowski-Tudor der "Wahnsinnsszene" der Älteren komprimiertes Tragödinnenformat. John Dews feinfühlige Personenregie und die Kostüme von José Manuel Vázquez deuten den zeitlichen Abstand zur vorletzten Jahrhundertwende nur zart an. Fast könnten die Janácek-Personen unsere Zeitgenossen sein. Gescheiterter Künstler II Stärker historisierend ist das Berlioz-Stück inszenatorisch angelegt, also paradox als eine mitten im 19. Jahrhundert angesiedelte Janácek-"Fortsetzung", das Räsonnement eines "am Leben" gescheiterten Künstlers, der sich auf den Flügeln der Kunst seine Rückkehr "ins Leben" verschafft oder imaginiert. Es wirft ein anderes Licht auf dieses formal einzigartige (wenn man will: aus Versatzstücken zusammengeklitterte) Werk, wenn man es nicht, wie vom Autor intendiert, an dessen Symphonie fantastique bindet. Wie bei Schicksal sind auch bei Lélio zwei hochbesetzte Metaphern der Traditionsmusik in der Optik von Heinz Balthes bühnenbestimmend: ein mächtiger Konzertflügel im Zentrum und ein reich gegliederter Orgelprospekt in lichter Höhe. Dahinter öffnen sich von Zeit zu Zeit Fantasieräume zur Vergegenwärtigung der verbal beschworenen Künstlerträume, darunter romantische Zweisamkeiten mit musizierenden Frauen, aber auch eine knallige Trinkrunde unter stämmigen Räubersleuten - Künstlers Flirt mit dem weltlichen Getriebe in seiner unbürgerlich-machohaftesten Spielart. Sehr schön und sehr lustig, dass sich Dew nicht schamhaft davor scheute, auch die närrischen Seiten des Berlioz'schen Kunstenthusiasmus aufzublättern. So dessen unverbrüchliche Shakespeare-Anhimmelungen, deren religiöse Inbrunst durchaus einiges urkomische Potenzial bietet. So auch die Beschimpfungen der damals virulenten Kunstbanausen und -verderber, für Berlioz Ausdruck einer bitterernsten Abreagierungsenergie, heute womöglich eher ein verschmitzt ironischer Hinweis auf theaterinterne Machenschaften und Kräfte, die die hehren Kunstwerke nur als Steinbrüche für ihre genialischen Kraftmaßnahmen benutzen. Von derlei Schandtaten weiß sich John Dew inzwischen ganz frei. Anflüge von Ironie gehören aber auch bereits zur originalen Poetik des Schwarzromantikers Berlioz, worauf die brüchige Integration einer fragmenthaften Kantate zu Motiven des Shakespeare'schen Sturms als Lélio-Schlusskrönung hindeutet. Bei Dew wurde der dissoziierende Faktor prägnant klargestellt durch Zweiteilung der musikalischen Formationen auf der Hinterbühne (als Probensituation) und weiterhin aktivem Orchestergraben. In einer auf altmodische Art furiosen Tanzszene, brillant choreografiert von Mei Hong Lin, rundete sich die vielgestaltig-opulente action théatrale zum beifallheischenden Kehraus. Geschickt waren in die Berlioz-Turbulenzen auch einige Janácek-Hauptfiguren eingebaut. So, wie der Lélio-Sprecher (nuanciert: der Schauspieler Hans Matthias Fuchs) auch stumm-allgegenwärtig am eingangs gespielten Schicksal teilnahm. Mit dem hervorragend disponierten Staatstheaterorchester und dem nicht minder beeindruckenden Chor vollbrachte der Dirigent Stefan Blunier (bei Lélio assistiert von Lukas Beikircher) eine imposante, höchst unterschiedliche Klangwelten aufschließende Leistung. [ document info ] Dokument erstellt am 24.09.2006 um 18:48:09 Uhr Letzte Änderung am 24.09.2006 um 19:04:50 Uhr Erscheinungsdatum 25.09.2006 |
|
Der Mann am Klavier erinnert sich Von Volker Milch
DARMSTADT "Das hat was": Im Publikum der Saison-Eröffnung werden die architektonischen Novitäten von Darmstadts Staatstheater angeregt diskutiert. Im Zentrum des Interesses steht das neue, nun die Front dominierende Beton-Portal, das in seiner einladend geschwungenen Form die Öffnung zur Stadt ausdrücken soll. Das Stuttgarter Architekturbüro Lederer, Ragnarsdóttir und Oei hat Rolf Pranges klarem, großzügigen, 34 Jahre alten Beton-Bau so etwas wie einen Publikums-Ansaugrüssel vorgesetzt. Die geschwungenen Lippen aus Weißbeton geben diesem Vorbau, der sich mit zyklopischen Türen schließen lässt, etwas Organisches. An "spacige" Zeiten lassen auch andere Formen der An- und Aufbauten denken, etwa die illuminierten Sitz-Raketen, die nun auf der großen Terrasse dominieren. Das solchermaßen hoffentlich nachhaltig angezogene bzw. angesaugte Publikum bekommt zur Saisoneröffnung eine ganz besondere Spezialität serviert, eine gemeinsame Anstrengung der Sparten Oper, Schauspiel und Tanztheater: Ein einsamer Flügel steht auf der ebenfalls runderneuerten Staatstheater-Bühne, und der Himmel hängt voller Orgelpfeifen. Ein Künstler-Leben, ein Komponisten-Leben nämlich ist´s, um das sich die Premiere dreht. Der Intendant John Dew höchstselbst hat das Wagnis unternommen, zwei heterogene Raritäten vom Dachboden der Musikgeschichte herunterzuholen, abzustauben und zu einer szenischen Einheit zu verbinden: Leos Janaceks allein kaum abendfüllende, aber sicher nicht nur deshalb selten aufgeführte Oper "Osud" ("Schicksal") und Hector Berlioz´ Monodram "Lélio oder Die Rückkehr ins Leben", sozusagen die Fortsetzung der "Symphonie fantastique" in Wort und Ton, im Gegensatz zu dieser aber kaum gespielt. Die tendenziell pathetische Gattung des Melodrams, an die Berlioz´ Werk anknüpft, ist einigermaßen außer Mode gekommen und führt in der expressiven Deklamation des Schauspielers Hans Matthias Fuchs zu einer gewissen Heiterkeit im Großen Haus: "Shakespeare hat in mir eine Umwälzung ausgelöst." Aha. Die "Symphonie fantastique", im Untertitel "Episoden aus dem Leben eines Künstlers", handelt bekanntlich von einer in Liebe romantisch zerrissenen Seele, und Berlioz selbst hatte explizit eine szenische Verbindung der Symphonie mit dem Monodram "Lélio oder Die Rückkehr ins Leben" vorgeschlagen: Lélio sollte auf der Bühne schlafen und die Symphonie träumen, um dann zu den folgenden, von Lied-Einlagen und Orchestermusik unterbrochenen Monologen zu erwachen. Die leitmotivische "idée fixe" der Symphonie klingt auch in "Lélio" immer wieder an. John Dews Inszenierung nun ersetzt die "Symphonie fantastique" durch die komplexe, mit verschiedenen Realitäts-Ebenen spielende Liebesgeschichte von Janaceks "Schicksal": Auf der Bühne erinnert sich Zivny, ein alter Komponist, an Irrungen und Wirrungen der Gefühle zur tragisch endenden Mila, die sich in einer autobiografischen Oper niederschlagen. Diese wird schließlich von Zivnys Musikstudenten einstudiert: Die Konfrontation Zivnys mit seinem Werk und seiner Vergangenheit führt zum Zusammenbruch des Komponisten - der nach der Pause als Lélio am Flügel wieder aufersteht: "Ich lebe noch, da liegt noch immer die Partitur" - allgemeines Gelächter. Tatsächlich fügen sich die heterogenen Werke zu einer einigermaßen plausiblen "Story" - aber auch zu einer ästhetischen Zwangsehe, die angesichts der stilistischen Unterschiede ein bisschen kurios wirkt. Claus H. Hennebergs deutsche Übersetzung stärkt nicht gerade das problematische Libretto von Janaceks "Schicksal" : Wenn man überhaupt mal etwas versteht, möchte man es lieber gar nicht gehört haben und wünscht sich Janaceks originale Sprach-Melodie zurück. Hinzu kommt, dass der von Stefan Blunier dirigierte und in delikaten orchestralen Farben gehaltene Abend nicht in allen Partien angemessen besetzt ist. Ein Komponist von Format aber ist der klar artikulierende Tenor Norbert Schmittberg, dem Yamina Maamar als auch szenisch überzeugende Mila gegenüber steht. Die Reize von Janaceks Partitur sind insgesamt stärker als die dramaturgischen Defizite von "Schicksal" und machen die Aufführung auf jeden Fall zum Gewinn. Lélios Künstlerseele findet sich später in Caspar David Friedrichs Klosterruine Eldena (Bühnenbild: Heinz Balthes) wieder, und auch die von Mei Hong Lin choreografierten Tanz-Einlagen verstärken auf der immer wieder romantisch blau illuminierten Bühne den Eindruck einer naiven Theater-Träumerei: Die Figuren aus Shakespeares "Sturm" werden in bunten Kostümen lebendig und bilden das bewegte Äquivalent zu einer veritablen Räuberbande aus Lélios Fantasie. Das ist alles originell erdacht, liebevoll umgesetzt und sieht oft hübsch aus - dass es letztlich nur halb so spannend ist wie die architektonischen Novitäten an Darmstadts Staatstheater, liegt wohl primär an den Schwächen der Werke selbst. |
|
Offene Tore für die Kunst Von Heinz Zietsch
Darmstadt. Was sind die Seelen der Künstler doch empfindlich! Als diesen Sommer bei den Ferienkursen für Neue Musik in Darmstadt das Werk eines jungen Komponisten aufgeführt wurde, war dieser derart erregt durch die Aufführung und den damit verbundenen Stress, dass er ohnmächtig zusammenbrach, als er auf die Bühne kommen wollte. So ist der Zusammenbruch des Komponisten Îivn˘ am Ende von Leo‰ Janáăeks Oper „Schicksal" durchaus realistisch, nachdem er erkannt hat, dass die Figuren seiner Oper etwas mit seinem eigenen Leben zu tun haben.Janá čeks zwischen 1904 und 1906 entstandene Oper, just als Freud seine Methode der Psychoanalyse betrieb, ist eine musikalische Selbstanalyse des Komponisten, projiziert auf die Figur des Komponisten Zivny, der in der zu schreibenden Oper seine unglückliche Liebe zu Mila und der konfliktträchtigen Beziehung zu Milas Mutter verarbeitet, die sich in das Leben des Paares einmischt.Bis schließlich – ausgelöst durch eine heftige Auseinandersetzung – die Mutter vom Balkongeländer stürzt und ihre Tochter mit in den Abgrund reißt. Ein schicksalsträchtiges Aufeinandertreffen unglücklicher Umstände, die Îivn˘, wie es der Regie führende Darmstädter Intendant John Dew sieht, fast in den Wahn treiben. Realität und Fiktion sind in Janáčeks „Schicksal" kaum voneinander zu trennen. Das macht diese Oper so schwierig. Auch für das Publikum am Freitag bei der ersten Premiere im sanierten Großen Haus des Staatstheaters Darmstadt. Lange galt dieses Werk als unaufführbar und wurde erst 1958 in Brünn uraufgeführt, wo Janáček lange wirkte. Und Dew macht die Sache anscheinend noch komplizierter, denn er bringt den Komponisten gleich dreifach auf die Bühne: als junger und gereifter Künstler und als alter Mann, der sein Leben und seine Kunst analysierend reflektiert.Das „Schicksal" braucht „Lélio" von Hector Berlioz als ergänzendes zweites Werk zur klärenden Lösung. Die Figur des Lélio ist zugleich der Komponist Îivn ˘, ein alter Mann von heute, verkörpert von dem Schauspieler Hans Matthias Fuchs, der zunächst im „Schicksal“ als stummer Beobachter mitwirkt. Anfangs sitzt er am Klavier allein auf der Bühne. Die gleiche Szene eröffnet auch den zweiten Teil des Abends: „Lélio oder Die Rückkehr des Lebens" von Berlioz, die 1831/1832 entstandene Fortsetzung seiner „Fantastischen Sinfonie" von 1830. Das Publikum, das gerade das schwere „Schicksal" überstanden hat, lacht, als Lélio zu Beginn ausruft: „Gott, noch immer lebe ich."Beide Stücke sind starker Tobak für eine Wiedereröffnungspremiere. Gewöhnlich werden solche Anlässe mit repräsentativeren Stücken gefeiert. Doch Dew und seine Mannschaft schlugen einen anderen Weg ein und setzten mit diesem Doppelabend die mit Monteverdis „L’Orfeo" begonnene Reihe „Des Künstlers Suche nach der Kunst" fort. Lélio überwindet sein Leiden am Leben dank der Muse, der Kunst. Das passt zur „Langen Nacht der Musen", die am Freitagabend in Darmstadt zu erleben war, aber auch zur Wiedereröffnung des sanierten Theaters: die Tore im sanierten Haus weit zu öffnen für die darstellende Kunst. Dieser Doppelabend vereinigt die Sparten Oper, Schauspiel und Tanz. Berlioz vor allem verquickt in seinem Monodram zudem noch die unterschiedlichsten musikalische Gattungen wie Melodram, Lied, Oratorium und Sinfonie. |
|
STAATSTHEATER DARMSTADT Premiere am 22.9.2006 Janacek Schicksal / Berlioz Lélio Das Positive zuerst: das Staatstheater Darmstadt eröffnet das frisch renovierte „große Haus" mit einem Doppelabend zweier selten gespielter Stücke. Alle Sparten sind involviert und präsentieren sich in unterschiedlicher Verfassung. Regisseur und Intendant John Dew hat diese Kombination dieser zwei sehr unterschiedlichen Werke von Janacek und Berlioz lange geplant. Durch die Figur des Komponisten verbindet er das persönliche Drama des tragischen Verlustes der Frau in Osud (Schiksal) mit den künstlerischen Betrachtungen, die Berlioz in einem Monolog mit Musiknummern gespickt hat, und das Ganze Lelio betitelt. Der achtenswerte Versuch Dews misslingt leider völlig. Berlioz war zwar als Komponist großer Avantgardist, als Dichter jedoch wirkt er geschwätzig, diffus, orientiert sich von Homer über Shakespeare bis Goethe und hat keine sprachliche Gewalt. Das Schweifen von Goethes Balladen über Räuberpistolen hin zum „Sturm" wirkt so beliebig wie Überleitungen eines Wunschkonzertes, von Elmar Gunsch moderiert. Dazu wird er von Hans Mathias FUCHS als schauspielender Komponist bemüht, sprachlich ungeschliffen und allzu lamoriant dargeboten. Musikalisch enthält Lelio einige reizvolle Nummern, die jedem Konzertsaal wesentlich besser anständen, da sie theatralisch rein gar nichts bieten. Das Darmstädter Ballett immerhin kann sich im Shakespearschen „Sturm"-Teil profilieren und auch der Chor unter Leitung von André Weiss bietet Delikates. Dem jungen Tenor Mark ADLER fällt die heikle Aufgabe zu, Berliozlieder nur mit Harfe oder Klavier begleitet, im Bühnenhintergrund zu singen. Er besticht mit großer Musikalität und einem herrlichen lyrischen Timbre – eine Entdeckung. Dass man dieses rein lyrische Berlioz Stück an den zweiten Teil des Abends stellt, ist ebenfalls dramaturgisch sehr unglücklich. "Osud" ist das bessere Theaterstück und zoomt den zentralen Helden heran, da es ihn in seiner persönlichen Tragik zeigen könnte. So verpufft alles Bemühen des ersten Teils. Im kalten, aber dennoch kitschigen Bühnenbild Heinz Balthes will leider keine Intimität, die Janaceks Osud / Schicksal bitter nötig hätte, aufkommen. Zu elegant, fast schablonenhaft und unterkühlt (Kostüme: Jose Manuel Vazquez) schweben die Darsteller nichtssagend durch den Raum, in dessen Zentrum ein Flügel als des Komponisten Instrument dominiert. Der Mangel an Personenregie kann je nach Begabung unterschiedlich gut überbrückt werden. Unter der Sängerriege fallen auf: Yamina Maamar mit großer schauspielerischer Begabung und einer angenehm breitflächigen, souverän geführten Stimme als Mila. Ihre Mutter spielend, Sonja Borowski-Tudor mit großem, voluminösem, vielleicht etwas eindimensionalem Mezzo, und besonders Werner Volker Meyer, mit nur mittleren Partien betraut, aber perfekt in der Diktion, sehr vielfarbig und mit angenehm weichem Baritontimbre begabt. Norbert Schmittberg in der herausfordernden Tenorrolle des Zivny hat sehr starke Momente, kann aber sein sängerisches Niveau nicht durchgehend halten. Mit großer Strahlkraft bricht die Stimme hin und wieder, und ihm fällt der Wechsel vom Dramatischen ins Lyrische nicht leicht. Dennoch eine sehr beachtliche Leitung. Die Übersetzung Claus H. Hennebergs, das muß auch angemerkt werden, ist oft sehr unglücklich. Nachsilben sind oft ungeschickt lang auszuhalten, ungewichtige Worte auf betonten Taktteilen. Da hatte einst Max Brod ein wesentlich besseres Gespür mit seinen Janacek- Übersetzungen. So müsste man eben manche Notenwerte dem Deutsch anpassen. Janacek wäre der erste Pragmatiker in dieser Hinsicht gewesen. Das Orchester zeigt sich in guter Verfassung. Beim Berlioz- Anfang mulmten die Bläser sich etwas ungefähr in den Klang. Und GMD Stefan Blunier peitschte anfangs beim Janacek die Klangmassen allzu robust in die Höhe, den Sängern wenig Chance lassend. Mit zunehmender Dauer aber balancierte sich das Verhältnis ein und die musikalische Kraft der beiden Werke kam energisch zum Tragen. Der Abend wirkt dennoch, gerade szenisch, zäh, zu lang und erreicht das Publikum emotional nicht wirklich. Tapferer Premierenapplaus im ausverkauften Haus. Er galt vielleicht mehr dem Kraftakt, alle Gattungen zu vereinen, als dem künstlerischen Ergebnis. Damian Kern |
|
Pathos pur Der Start in die Theater-Saison 2006/2007 trug in Darmstadt besondere Züge. Nach einer zweijährigen Renovierung erstrahlte das Große Haus - und mit diesem das gesamte Gebäude des Staatstheaters - in neuem Glanze. Dabei bleiben die bedeutendsten und kostenträchtigsten Neuerungen verborgen hinter, unter und über der Bühne des Großen Hauses. Nach Ansicht von Fachleuten verfügt Darmstadt damit über das modernste Theater Europas, wenn nicht sogar der Welt. Diesem Anspruch wird auch das Äußere gerecht, mit seinem sandgestrahlten Glanz des Carrara-Marmors, dem repräsentativen und doch schlichten Portal und den auflockernden Elementen auf der weitläufigen Terrasse. Das Innere des Foyers hat durch die Neugestaltung - unter Beibehaltung der Raumstruktur - durch die luftigen Deckenelemente und die großzügig verwendete weiße Farbe an Leichtigkeit und Offenheit gewonnen. Soviel zum neuen Haus: Es versteht sich von selbst, dass der Saisonstart angesichts der oft beschwerlichen und zeitlich weit überzogenen Renovierungsphase und ihres glücklichen Endes ebenfalls eine gewisse Einmaligkeit aufweisen musste. Natürlich hätte man eine große Wagner- oder Verdioper mit Massenchören und einem voll besetzten Orchester wählen können, und das wäre dem Anlass sicher angemessen gewesen. Intendant John Dew jedoch hatte anderes im Sinn. Er wollte in der ersten Opern-Premiere alle Sparten des Dreisparten-Hauses gleichermaßen zum Einsatz kommen lassen, sozusagen als Symbol und als Dank für den Zusammenhalt des Ensembles während der schwierigen Zeit. Außerdem wollte er durch den bewussten Verzicht auf einen "Repertoire-Renner" ein weiteres Zeichen setzen. So fiel die Wahl auf die Inszenierung zweier im Wesen ähnlicher Kurzopern, die sich über gemeinsame Thematik und Grundtenor zu einem integrierten Stück zusammenschmieden ließen und die obendrein noch die Oper selbst in den Mittelpunkt der Handlung stellen: Leos Janáceks "Schicksal" und Hector Berlioz' "Lélio". Die Ähnlichkeit der beiden im Abstand von über siebzig Jahren entstandenen Opern ist tatsächlich verblüffend. In beiden Fällen lässt ein alternder Komponist das Leben Revue passieren und setzt sich mit dem Gegenstand seines Schaffens, der Musik, auseinander. In beiden Fällen komponiert der Protagonist eine Oper, die autobiographisches Material verdichtet, und lässt sie auch zur Aufführung kommen. Und in beiden Fällen geht es auch um erotische Verwicklungen und Katastrophen, die nicht nur das Leben der jeweiligen Hauptperson - des fiktiven Komponisten - sondern ebenso das des jeweiligen realen Komponisten geprägt haben. In beiden Fällen handelt es sich also um stark selbstrefenzielle Kunstprodukte, die nicht nur das Innere nach außen kehren, sondern gleichzeitig diese Vorgänge aus der Perspektive der betroffenen Person widerspiegeln und kommentieren. Die doppelte Ebene des Selbstbezugs - innerhalb der Opern durch die autobiographische Bedeutung er Musik und außerhalb ihrer durch den ebenso deutlichen autobiographischen Charakter beider Werke - schafft ein Vexierbild, bei dem Realität und Fiktion ineinander verschwimmen. Der Effekt ähnelt dem des Kameramannes, der das aufgenommene Bild auf dem Fernsehschirm abfilmt. Die Wiederholungen der Selbstspiegelungen verlieren sich im Unendlichen. Selbstreferenz hat Künstler schon immer gereizt, z. B. die Maler des Surrealismus, die sich selbst beim Malen malen. Hier findet wir diesen sich irgendwo im Fiktiven auflösenden Wesenszug auch in der Musik. Da beide Opern die Person des alten Komponisten als Rahmen der Handlung wählen, war es ein Leichtes für John Dew und seine Mitarbeiter, die beiden Opern wie zwei Akte ein und derselben Oper zu inszenieren. Wenn der Komponist Zivny am Ende von "Schicksal" über dem Flügel in verzweifelnder Melancholie zusammensinkt, so beginnt "Lélio" exakt mit diesem Bild. Konsequent wählt Dew auch für beide Komponisten den selben Habitus, das selbe Kostüm und denselben Schauspieler bzw. Sänger. Beide sind bei Dew "der" Komponist und nicht länger Figuren von Janaceks oder Berlioz' Gnaden. Ebenso konsequent führt er auch die anderen Personen weiter, soweit möglich. Die Geliebte Mila des Zivny wird so zur fernen - und unerreichbaren - Geliebten bei Berlioz. In beiden Opern kämpft der Protagonist mit seinen Zweifeln an sich und seiner Kunst, mit dem Gefühl mangelhafter Ausdrucksgabe und dem unerfüllten Wunsch nach der endgültigen Musik, die zwar im Kopf existiert, sich aber nur schwer in der erträumten Form auf Papier bannen und in reale Musik umsetzen lässt. Beide wollen zwischenzeitlich aufgeben, verzweifeln und kommen doch zurück ins Leben, um weiter zu machen. Bei Janacek umgibt diese Suche nach dem musikalischen Ausdruck noch die Handlung einer familiären Katastrophe. In einem Kurort treffen sich unverhofft die ehemaligen Geliebten Zivny und Mila, nur um festzustellen, dass Milas intrigante Mutter sie auseinander gebracht hat. Zivny lebt wieder mit Mila und dem unehelichen Sohn zusammen, doch die zänkische Mutter streut Hass und Intrigen, wo sie kann, und zerstört die Beziehung ein zweites Mal. Im beginnenden Wahnsinn fällt sie zusammen mit der sie haltenden Mila vom Balkon und Zivny bleibt mit seinem Sohn allein. Als Jahre später Studenten bei dem Versuch, seine Oper aufzuführen - die wir übrigens in John Dews Inszenierung auszugsweise von der CD hören - mit dem Gerücht konfrontieren, diese Oper sei in Wirklichkeit eine musikalische Autobiographie, bricht er angesichts der Erinnerungen zusammen und verfällt in Wahnvorstellungen. Am Ende sinkt er über dem Flügel zusammen. Bei Berlioz schwebt dem Protagonisten das ultimative Kunstwerk aus Musik, Theater und Tanz vor, da er fasziniert ist von Shakespeare und nicht mehr von diesem Genie loskommt. Vermischt werden seine pathetischen Beschwörungen des Genies aus Stratford on Avon mit sehnsüchtigen Anrufen seiner unerreichbaren Geliebten - dieses Problem und die Shakespeare-Verehrung sind ebenfalls Wesenszüge von Berlioz und keine Opernfiktionen - und sie enden in dem Wunsch, Shakespeares "Sturm" zu vertonen. Während er seine Musik von einem Orchester mit Chor auf der Bühne proben lässt, träumt er sich den wahren Klang herbei, der dann zu einem halluzinatorischen Tanz von Caliban und Genossen hinter einem Gaze-Vorhang aus dem Orchestergraben ertönt. Der bewusst spröde und eher bescheidene Eindruck der Musik auf der Bühne illustriert das vermeintliche Unvermögen des Komponisten, seine musikalischen Vorstellungen in echte Töne umzusetzen. Nach den musikalischen und tänzerischen Halluzinationen, bei denen ihn die Shakespeare-Figuren seiner Phantasie herumwirbeln und bedrängen, steht er plötzlich wie benommen auf dem Flügel vor dem probenden Orchester, dessen Mitglieder anschließend mit skeptischen bis fragenden Gesichtern die Bühne verlassen. Er selbst entschließt sich nach dem Abschütteln der Traumeindrücke, weiter zu machen mit der Musik, ungeachtet seines möglichen Scheiterns. Berlioz hatte "Lélio" als szenische Fortsetzung seiner "Symphonie Fantastique" geplant, musste sich jedoch von Bühnenexperten sagen lassen, dass dies praktisch unmöglich sei. Nun, John Dew und die erneuerte Technik des Staatstheaters Darmstadt haben bewiesen, dass es mittlerweile doch möglich ist, die verschiedenen Ebenen echter und fiktiv erlebter Realität sowohl szenisch als auch musikalisch darzustellen. Das war nicht immer einfach, musste doch GMD Stefan Blunier die Musik des Bühnenorchesters aus dem Graben begleiten und übernehmen, ohne seinen "Spinn-Off" auf der Bühne sehen zu können. Doch langjähriges Training, hohes Gespür für musikalische Feinheiten und natürlich einige technische Hilfsmittel ermöglichten es, dass am Ende die Musik beider Ensembles fast nahtlos ineinander überging und obendrein die Realität der bescheidenen Bühnenmusik von der imaginierten Fülle und Wucht der nur vorgestellten Musik aus dem Orchestergraben zum Ausdruck kam. Dabei leistete das Orchester nicht nur aus den erwähnten Gründen der Zweigleisigkeit Besonderes. Innerhalb eines Abends musste es nicht nur zwei Musikstile - den eher modernen, nachwagnerianischen Stil Janaceks und den spätromantischen von Berlioz - interpretieren, sondern die Musik auch noch mit den Abläufen auf der Bühne koordinieren. Bei Janacek stachen vor allem die exakt und kompromisslos herausgearbeitete Harmonik sowie die Zerrissenheit der Themen hervor, die den Seelenzustand der Personen auf der Bühne treffend kennzeichnen. Nur selten mussten sich die Sänger gegen das Orchester durchsetzen, gerade bei leiseren Stellen nahm Blunier das Orchester rechtzeitig zurück. Die Sänger lieferten an diesem Abend ebenfalls exzellente Arbeit ab. Norbert Schmittberg als Komponist besticht durch seinen strahlkräftigen Tenor und die Intensität seiner Darstellung des zerrissenen Komponisten. Mark Adler übernimmt glaubwürdig die Partie des jungen Komponisten. Diesen beiden gegenüber steht Yamina Maamar als Mila und später als die ferne Geliebte, mit einer vor allem in den lyrischen Partien ausdrucksstarken Stimme und ebenfalls überzeugendem darstellerischen Können. Sonja Borwoski-Tudor verleiht der Mutter Milas mit ihrem stimmgewaltigen Mezzo-Sopran eine geradezu Furcht erregende Intensität. In verschiedenen Rollen beider Oper überzeugen weiterhin Werner Volker Meyer, Sonja Gerlach, und Elisabeth Hornung sowie weitere Mitglieder des Ensembles. Als Einziger des gesamten Ensembles ist Matthias Fuchs permanent auf der Bühne präsent: in "Schicksal" lediglich als stummer Betrachter der Ereignisse, die sich in seinem Kopf abspielen, in "Lélio" dann als emphatischer Shakespeare-Verehrer, der an der Übermacht dieses Genies fast zerbricht, da er ihm auf musikalischem Gebiet nichts Gleichwertiges entgegenzusetzen zu können glaubt. Er bildet sozusagen das konstante Element in den beiden "Teilopern" und verleiht ihnen durch seine Interpretation des alten Komponisten innere Konsistenz. Überhaupt wird Pathos in dieser Inszenierung wieder groß geschrieben. Lange Zeit war man dem Pathos vor allem in der deutschen Oper - und im Theater - abgeneigt. Zu sehr schien diese Geisteshaltung durch die jüngere Vergangenheit kompromittiert. Doch in letzter Zeit haben sich sozialwissenschaftliche Stimmen erhoben, die ein gewisses Pathos für einen gesunden Seelenhaushalt eines Volkes für erforderlich halten. Der Zeitgeist scheint diese Stimmen - bewusst oder unbewusst - gehört zu haben und wagt sich wieder Schritt für Schritt in dieses Gebiet hinein. In John Dews Inszenierung erleben wir pures Pathos, sei es um die verlorene Liebe, sei es um die Anbetung der Musik als elementarer Macht. Diese beiden eher unverdächtigen Anlässe für pathetische Empfindungen machten es John Dew sicherlich leichter, den Schwerpunkt wieder vom Kopf zum Herzen hin zu verlagern, und Matthias Fuchs setzt dieses Pathos ohne jeden falschen Zungenschlag glaubwürdig um. Bliebe noch das Bühnenbild zu erwähnen, das dem pathetischen Zug ebenfalls bis zu einem gewissen Grad folgt. In "Schicksal" sehen wir noch sparsame Bühnenbilder mit eher praktischen Blickfängen im Hintergründen, so dem Balkon, von dem Mila und ihre Mutter springen. Neue Zwischenvorhänge erlauben es, den hinteren Bühnenraum schnell abzudecken und damit das Bühnenbild flexibel zu verändern. In "Lélio" dann kommt das romantische und pathetische Element voll zur Geltung. Anfangs erhebt sich hinter dem am Flügel träumenden Komponisten über die gesamte Bühnenrückwand ein Gemälde Caspar David Friedrichs mit gespenstisch kahlen Bäumen und einer alten Ruine in der Mitte, das sich im Laufe der längeren Szene langsam aus der Dunkelheit zur Morgendämmerung aufhellt. Später, wenn der Komponist von der Vertonung des "Sturm" träumt, rollen riesige Sturmseen über den im Bühnenvordergrund aufgezogenen Gazevorhang und lassen das Treiben der Kobolde aus Mei Hong Lins Tanztruppe unwirklich erscheinen. In diesem Teil der Inszenierung feiert das romantische Pathos fröhliche Urständ, und das ist gut so. Das Premierenpublikum zeigte sich rundherum begeistert von diesem Saisonstart und sparte bei dem anhaltenden Applaus nicht mit "Bravo"-Rufen. Das Ensemble nahm die Huldigungen dankbar und strahlend entgegen. Anschließend bewirtete das Theater die Gäste im Foyer, und die politischen Lokalgrößen standen dem Hessischen Rundfunk, der diese Aufführung "live" übertragen hatte, in einer Gesprächsrunde Rede und Antwort. Frank Raudszus |