|
Oper als Passionsspiel Der Zuschauerraum ist verdunkelt, der Dirigent wartet am Pult, der Chor steht starr auf der offenen, von Metallgerüsten umrahmten Bühne. Doch es dauert endlose Minuten, bis das Bild in Bewegung gerät, einzelne Figuren sich aus der Menge lösen und schliesslich nur noch die Protagonisten zurückbleiben. Dann setzt, sehr leise, duftig zart, die Musik ein. Die Wartezeit in der Oper Frankfurt könnte durchaus etwas kürzer sein - wie Christof Loy, der Regisseur, und Paolo Carignani, der scheidende Frankfurter Generalmusikdirektor, Giuseppe Verdis düsteren "Simon Boccanegra" verstehen, würde auch dann von allem Anfang an deutlich. Äusserste Konzentration, eine fast sakrale Andacht ersteht aus diesem Beginn und bleibt bis zum Schluss, der wieder in das erste Bild mündet, bestehen. Der Lebensweg des genuesischen Korsaren, der zum Dogen aufsteigt, wird hier zur Parabel um Macht und Parteienhass, Milde und Verrat, Liebe und Tod. Dazu braucht es keine Kulissen, keine historischen Kostüme, die Bühne ist nichts als Bühne, nur mit einigen Vorhängen drapiert (Johannes Leiacker). Der zu Beginn und am Schluss gezeigte Prospekt einer graubraunen Meeresszenerie wirkt allerdings suggestiv-stimmungshaft. Wo keine Kulissen sind, gibt es auch kein Geschehen hinter den Kulissen, vor aller Augen ereignet sich hier das Drama, selbst der Moment, da der frisch gekürte Doge seine Geliebte, um derentwillen er das Amt übernommen hat, tot im Palast ihres Vaters Fiesco findet. Das Private wird öffentlich, die Öffentlichkeit - Patrizier, Plebejer, das wankelmütige Volk - greift zerstörerisch ins Private ein. Wie dann die Tote als Amelia/Maria aufersteht, die gemeinsame Tochter, die der Vater Jahre später wiederfindet, das gehört mit zur Kreislauf-Bewegung von Loys Inszenierung. Simon als Märtyrer, die Dogenkrone als Dornenkrone, die Tochter als Jungfrau Maria, Paolo, der Simon zum Dogen macht und ihn später mit Gift umbringt, als der Verräter Judas: Auf diese und weitere Parallelen zur Passionsgeschichte verweist der Regisseur selber in einem Programmheft-Interview. Doch sie werden im Bühnengeschehen nicht bildhaft konkretisiert, da herrscht vielmehr nüchterne Kargheit. Stimmungsträger ist bei dieser Aufführung zuallererst das Orchester, das unter Carignani eine Piano- Kultur pflegt, wie man sie bei Verdi-Opern kaum je zu hören bekommt. Dabei fehlt es weder an subtilen Farbschattierungen noch an dramatischer Zuspitzung, wo solche gefordert ist. Dass zwischen dem Prolog und dem ersten Akt das "Ingemisco" aus Verdis Requiem erklingt, verweist nicht nur auf die stilistische Verwandtschaft zwischen den zwei Werken, es kennzeichnet auch den Aufführungsstil der Oper. Und in eljko Lu?i hat sie einen Protagonisten, der diesem Stil auch sängerisch wunderbar entspricht: mit einem warm timbrierten, in allen Lagen frei strömenden Bariton von fein differenzierter Ausdruckskraft. Umso mehr nimmt man daneben allerdings die vokalen Mängel der übrigen Solisten wahr, die Unebenheiten und Schärfen des Soprans von Annalisa Raspagliosi, deren Amelia/ Maria auch darstellerisch wenig Kontur gewinnt, die verschattete Mittellage des Tenors Paul Charles Clarke (Gabriele Adorno), das starke Vibrato des Baritons von Johannes Martin Kränzle (Paolo). Und dass es in "Simon Boccanegra" zwei grosse Vaterfiguren gibt, geht angesichts des blassen, kraftlosen Fiesco von Bálint Szabó fast vergessen. Doch weil Loy das Familiendrama ins Gleichnishafte überführt, fallen diese Mängel nicht zu sehr ins Gewicht. Marianne Zelger-Vogt |
|
Oberammergau ist fern VON STEFAN SCHICKHAUS Christof Loy hatte sein Publikum gewarnt. Wer seine Inszenierung der zu keiner Zeit populären Verdi-Oper Simon Boccanegra besuchen wolle, solle sich vorab mit der Handlung und ihren Wirrnissen gut vertraut machen, so hatte der Regisseur im Vorfeld seiner neuen Produktion an der Oper Frankfurt gesprochen. Aber ist's nicht genau Aufgabe eines Regisseurs, den Opernführer entbehrlich zu machen? Bei Loy keine Frage. Er, einer der fähigsten Charaktermodellierer des Musiktheaters und gerade in Frankfurt mit enorm gelungenen Arbeiten regelmäßig präsent, hat diese Oper Giuseppe Verdis jedenfalls radikal entkleidet. Gemeinsam mit seinem Team aus Bettina Walter (Kostüme) und Johannes Leiacker (Bühne) fegte er alles Äußerliche hinweg. Dem Dogen Simon Boccanegra ließ er nur kurz einen roten Mantel der Macht, doch darüber hinaus geben sich die Figuren in diesem dunklen Spiel nicht durch äußeren Schein in ihrer Position zu Erkennen. Alle sind sie schwarz und, wie meist bei Loy, zeitlos gekleidet, sie halten sich an einem harten, oft neonhellen Unort auf. Schön will diese Bühne nicht sein, nicht atmosphärisch, das rein Funktionale bestimmt das Einheitsbild. Loy hat das Libretto der zweiten Fassung neu gelesen Für Loy also spielt es keine Rolle, ob der eine nun Korsar ist, der andere Edelmann, ob ein Höfling oder ein Armbrustschützenhauptmann vor ihm steht. Er hat vielmehr in dieser weitgehend ungeliebten, weil nirgends Hit-verdächtigen Verdi-Oper etwas anderes entdeckt: Die Passionsgeschichte. Loy las aus dem Libretto der zweiten, 1881 und damit 25 Jahre nach der ersten uraufgeführten Fassung von Simon Boccanegra eine religionsphilosophische Komponente heraus, die, einmal im Hinterkopf, sich in der Tat zu bestätigen scheint. Wie oft wird da alleine schon von Paradies und Hölle gesungen, werden Engel beschworen, wird gesegnet zu Choral-Klängen, und das Volk steuert "Töte ihn"-Rufe bei? Die einzige weibliche Gestalt heißt Maria, eine eigene Einheit bilden die beiden Fädenzieher Paolo und Pietro, einer davon übernimmt dazu die Judas-Funktion des zerrissenen Verräters in den eigenen Reihen. Simon, die Lichtgestalt, trägt die Last der Welt. Und der, mit dem sich in einer ungemein zärtlich geglückten Szene dieser Weltenretter versöhnt, beide in einem isolierten Lichtkorridor stehend, ist nicht sein Vater, aber immerhin so etwas wie sein Schwiegervater, der strafende, aber gerechte Fiesco. Alles wird klar, sonnenklar an grauem Ort: eine Erleuchtung Nun ist aber Christof Loy keiner, der Oberammergau nach Frankfurt bringt. Passionsgeschichtliche Metaphern finden sich beim besten Willen nicht, nur Haltungen - aber was heißt hier nur! Die Haltungen, die Konstellationen, die Bewegungen der Akteure zueinander sind das, was die geradezu sensationelle Intensität dieser Inszenierung ausmachen. Jede Personengruppe ist in ihrer Disposition höchst ausgeklügelt, Chor und Statisterie stellen sich mit größter bildlicher Klarheit auf, Loy hat am Menschen gearbeitet. Und alles wird klar, sonnenklar an grauem Ort: eine Erleuchtung. Die das Premierenpublikum durchdrungen hat. Denn als zu Beginn, in fünf Schweigeminuten, eine Menschenmasse auf der Bühne stand wie festgefroren, das Gegenteil eines Verdischen Ouvertürentrubels also, wurde in den Zuschauerreihen noch Ungeduld laut, Unruhe, ein Sich-nicht-einlassen wollen. Am Ende dann, wenn sich alle wieder zum gleichen Statikbild zusammenfinden, klatschte niemand in die Konzentration hinein, man hatte zu sich gefunden. Christof Loys Wagnis ging auf. Dann aber: Enormer Applaus in erster Linie für den Bariton Zeljko Lucic, einen idealen Verdi-Sänger, der im Frankfurter Ensemble zu Weltklasse-Format herangereift ist - und der das Haus demnächst verlassen wird. Aus seinem Rollendebüt machte er eine grandiose Charakterstudie und setzte damit einen Maßstab: Einen so emotional beteiligten und stimmlich unanfechtbaren Sänger wie Lucic findet man so schnell kein zweites Mal in einem Hausensemble. Neben ihm, weitgehend gleichwertig: Annalisa Raspagliosi als Maria / Amelia, streitbar und markant und mit bestechend lyrischen Momenten; der klassische basso profondo Bálint Szabó als Fiesco, der extrem charakteristisch timbrierte, auch darstellerisch wendige Johannes Martin Kränzle als Paolo Albiani und, als Solist des Opernchores, Pavel Smirnov mit einer ebenfalls bravourösen Bariton-Leistung. Alleine der Tenor von Paul Charles Clarke (Gabriele Adorno), die einzige hohe Männerstimme in dieser durchweg dunklen Angelegenheit, machte nicht vollends glücklich, zu sehr veränderten sich Farbe und Gewicht und Balance bei zunehmender Höhe. Dass diese Simon Boccangera-Partitur eine sonderliche unter Verdis Opern ist, weiß einer wie Paolo Carignani besonders gut. Der Frankfurter GMD legte so auch hörbar alles daran, das Individuelle dieser Musik nach vorne zu stellen. Geradezu aggressiv klangen die (trotz Bühnenbewegung reibungslosen) Chorpartien, Volkschöre mit Passionsvehemenz. Kalte Fanfaren, irrlichterne Sphärenharmonien, ungeahnt moderne Stimmungsbilder: Das Frankfurter Museumsorchester sorgte unter Carignanis engagiertem Dirigat dafür, dass sich diese Verdi-Produktion abhebt von allen anderen, auch musikalisch zum Verdi-Solitär wird. [ document info ] Dokument erstellt am 21.05.2007 um 17:00:02 Uhr Letzte Änderung am 21.05.2007 um 17:15:03 Uhr Erscheinungsdatum 22.05.2007 |
|
Verdis "Simon Boccanegra" in Frankfurt Von Uwe Wittstock Solchen Beifall hat Frankfurt lange nicht erlebt. Vielleicht noch kein Opern-Triumph, aber doch ein großer Opern-Erfolg, einer jener raren Abende, an denen fast alles zusammenpasst, überwältigende Stimmen, exzellente darstellerische Leistungen, ein springlebendiges und doch präzise geführtes Orchester und eine klare Regie, die sich vor allem um eines bemüht: den Geist der Komposition zur Geltung zu bringen. Und das ist bei Verdis "Simon Boccanegra" bei Gott nicht einfach. Die Handlung, eine politische Intrige aus dem 14. Jahrhundert, zieht sich über zwanzig Jahre hin und wird derart sprunghaft und verschachtelt erzählt, dass es nahezu unmöglich ist, sie auf der Bühne plausibel zu machen. Die Uraufführung wurde 1857, obwohl Verdi zuvor mit "Rigoletto", "Trovatore", "Traviata" und "Sizilianischer Vesper" eine beispiellose Erfolgsserie hingelegt hatte, zum Fehlschlag. Erst knapp ein Vierteljahrhundert später, als er gemeinsam mit Arrigo Boito, dem Librettisten seiner späten Opern, "Boccanegra" überarbeitete, fand sie zu einer überzeugenden Form. Verdi betont hier, im Gegensatz zu der von zeitlichen Brüchen geprägten Bühnenhandlung, musikalisch vor allem die Zusammenhänge. "Boccanegra" enthält wenig Arien, die Rezitative sind vom Orchester prächtig untermalt, so dass der Eindruck einer durchkomponierten Großform entsteht - also ein entschlossenen Schritte weg von der traditionellen "Nummern"-Oper hin zum Musikdrama. Und das hebt auch die Inszenierung von Christof Loy hervor. Er hat von seinem Ausstatter Johannes Leiacker ein einziges, schlichtes Bühnenbild entwerfen lassen: Eine kahle Holzbühne in der Mitte, umgeben von beweglichen Metallgerüsten, mit denen die Sprünge von einem Schauplatz und einem Jahrzehnt zum anderen allein durch das Vor- und Zurückgleiten einzelner Gerüstteile in wechselndem Licht veranschaulicht werden. Umso größer ist die Konzentration auf die Musik. Auch bei den Sängern beschränkt sich Loy klug auf wenige, aber dafür überzeugende, eindringliche Gesten und Konstellationen. Das wirkt mitunter ein wenig statuarisch, doch zumeist gelingt ihm das Kunststück, den Figuren trotz allem eine hohe innere Spannung zu verleihen. So liegt immer eine bedrohliche Ruhe über der Szene, in der dann subtilere Details ihre Wirkung überhaupt erst entfalten können. Wenn, beispielsweise, im dritten Akt die Rebellen gegen den Dogen Boccanegra zum Tode verurteilt werden, schickt Loy die Kolonne der Männern mit bloßem Oberkörper ins Dunkel des Bühnenhintergrunds hinab, und lässt so etwas ahnen von dem Schrecken einer Massenhinrichtung, bei der eben noch lebendige Körper wie auf dem Fließband in kaltes Fleisch verwandelt werden. An den Anfang dieser Oper, die keine Ouvertüre hat, haben Loy und der Dirigent Paolo Carignani zudem John Cages wohl bekanntestes Stück "4'33"" gestellt: Eine gut viereinhalb Minuten andauernde Generalpause sämtlicher Instrumente, so dass alle hörbaren Laute nicht von den Musikern, sondern vom Publikum stammen. Dazu hat Loy den Chor, der in Verdis Oper Volkes Stimme singt, bewegungslos auf die Bühne gestellt, den Blick starr auf die Zuschauer gerichtet, die ihrerseits untätig zurückzustarren gezwungen sind. Lange, bedrückende viereinhalb Minuten, die man wohl als Identifikationsvorschlag zwischen Publikum und einem Opernvolk verstehen darf, das bei Verdi allerdings eine recht launenhafte, dümmliche Rolle spielt. Wenn sich in diesen Abend trotz seines hohen musikalischen und inszenatorischen Ranges so etwas wie Wehmut mischt, dann weil mit dieser Aufführung der Abschied von zwei prägenden Kräften der Frankfurter Oper immer deutlicher vor Augen steht. Paolo Carignani leitet mit "Boccanegra" seine letzte Verdi-Inszenierung in Frankfurt, im Sommer 2008 wird er nach fast zehn Jahren sein Amt als Generalmusikdirektor an Sebastian Weigle übergeben. Und auch der serbische Bariton {Zcaron}eljko Lucic wird nach einem Jahrzehnt, in dem er sich einen herausragenden internationalen Ruf ersungen hat, das Frankfurter Ensemble demnächst verlassen. Besser als durch Lucic in dieser Aufführung lässt sich der Begriff Heldenbariton kaum mehr füllen. Seine Präsenz ist enorm, die Modulationsfähigkeit seiner Stimme von zartesten Liebeslaut als glückseliger Vater bis zum brachialen Machtwort als Doge spektakulär. Das Duett mit der ebenfalls überragenden Annalisa Raspagliosi als Maria, in der Boccanegra seine vor 20 Jahren verlorene Tochter wiederfindet, ist von einer emotionalen Wucht, der man wohl nur dann ohne Gänsehaut entgeht, wenn man sich die Ohren zuhält. Aber auch die übrigen Sänger, der Chor, das Orchester - wo immer man an diesem Abend hinschaute, hinhörte, alles war mustergültig. |
|
An der Frankfurter Oper hatte Verdis „Simon Boccanegra" Premiere. Von Andreas Bomba Zu Beginn: nichts. Bühne auf, Licht an, das Orchester sitzt, Chor und Statisten stehen minutenlang auf der fast leeren Bühne. Regungslos. Ein gruppendynamisches Geduldspiel, besonders fürs Publikum. Am Ende, nach drei Stunden packenden Musiktheaters, noch einmal dieses Bild. Wieder stehen alle dort, geläutert vielleicht, bereichert um viel tragische Lebenserfahrung, und die Geschichte könnte wieder von vorne beginnen. Langsam verlöscht das Licht. Diesmal verharrt auch das Publikum in gebanntem Schweigen, bevor der Applaus losbricht. Christof Loy, dem Regisseur, ist eine Ringparabel gelungen. Geschichte, historische Prozesse verlaufen gesetzmäßig und wiederholen sich. „So ist das Volk eben", sagt Simone Boccanegra: Hosianna – Kreuzige, „Eviva" oder „Vendetta". Als Giuseppe Verdi seine 1857 in Venedig durchgefallene Oper 1881 für Mailand überarbeitete, interessierten ihn weniger die politischen Optionen als die Menschen und die Konstellationen ihres Miteinanders. Geschichte gibt die Folie her, nicht mehr. Loy und sein Bühnenbildner Johannes Leiacker folgen dieser Lesart radikal. Das Volk, sobald es zu agieren anfängt, wird ins Off oder feige kauernd in seitliche Nischen verbannt. Die Welt steht offen, eine Bühne blankliegender Gefühle. Mit Schritten und Blicken messen die Personen die Nähe und Weite zueinander aus, alles wohlkalkuliert, fast geometrisch klar, die Komplexität der Handlung aufs Wesentliche entwirrend. Gestänge und Gerüste links und rechts bieten Platz für ein paar „offizielle" Staatshandlungen. Schon im Ansatz scheitert der Versuch, im Hintergrund einmal einen roten Teppich auszurollen: Alles repräsentative Gepränge würde nur Zeljko Lucic stören, die Titelpartie des Volkshelden musikalisch auszuloten. Der noble Bariton klingt noch nobler als sonst, würdig in der Höhe, dunkel in der Tiefe, von enormer Empfindsamkeit, wenn er von Frieden und Liebe singt, nachdenklich, schließlich traurig und melancholisch über sein Scheitern. Sein Singen, seine Statur füllen den ganzen Raum. Auch Freunde purer Gesangstechnik können sich über seine Stimmführung freuen, insbesondere die Kunst des dynamischen „Messa di voce". Mit Johannes Martin Kränzle (Paolo) und Bálint Szabó (Fiesco) bekommt er zwei charaktervolle Gegenspieler, Paolo mit missmutigen Untertönen (er wird den Dogen schließlich vergiften), Fiesco mit harscher Bestimmtheit. Sie löst sich auf in versöhnliche Wärme, als er Simon nach 25 Jahren wieder begegnet. Auch hier schließt sich also der Kreis, und nicht zuletzt dieser Logik halber zieht sich Simone zum Sterben an den Ort zurück, an dem, auf dem großen zeitlichen Sprung vom Prolog in den ersten Akt, Amelia in Erscheinung getreten war, seine gemeinsame Tochter mit Maria, der verstorbenen Geliebten und Fiescos Tochter. Vom ersten Ton an, ätherisch unterfüttert vom Geschwirre der Streicher und Holzbläser, wird Annalisa Raspagliosi zum Ereignis. Zwischen volksliedhaft Naivem und dramatischen Ausbrüchen ist sie hin- und hergerissen, mit glutvollen Tönen vor allem in Mittel- und tiefer Lage versucht sie zu vermitteln. Hinreißend das den zweiten Akt beschließende Terzett. Anrührend auch die Szene, in der Simon seine verschollen geglaubte Tochter wiedererkennt. Nachvollziehbar die Eifersucht, die Amelias Geliebten Gabriele Adorno befällt – bis er von Simone das Dogenamt erbt. Paul Charles Clarke fokussiert die feinnervige Spannung dieser Rolle mit hellem, bisweilen etwas gepresstem Tenor; vor seinem ersten Auftritt darf er hinter der Bühne A-cappella „Ingemisco" singen, das Schuldbekenntnis aus Verdis „Requiem". Von der geringen Personenzahl und der Musik ausgehend, ist diese Oper eigentlich ein Kammerspiel. Zu hören auch in der Musik, die das Museumsorchester unter Paolo Carignanis sorgfältiger Leitung zum Blühen bringt. Welcher Mut zur Langsamkeit und zum Detail, welche Suggestion, welche Farben, welches Feingefühl und emotionale Kraft dringen da aus dem Graben! Kein Verdi-Stereotyp bleibt unhinterfragt, die Musik trägt und inspiriert die Sänger (und den präzisen Chor!) zu herausragenden Leistungen. Auch deshalb das atemlose Schweigen am Schluss. |
|
Seelenstürme auf der kahlen Probebühne Von Götz Thieme Oft erörtert, nie widerlegt: die Krise der Gesangskunst. Dafür, dass es Wagner besonders trifft, werden seine Musikdramen ziemlich häufig aufgeführt - anhaltende Beliebtheit diktiert das den Direktoren. "Ringe" von Weimar bis Baden-Baden, von Detmold bis Karlsruhe. Wenn es mit dem Singen nicht so hinhaut, wird engagiert gebelfert und gebrüllt. Im Zweifel geht das Personal ehrenvoll in sinfonischen Orchesterwogen unter - die Wirkungen des Zauberers richten es. Giuseppe Verdis Opern ergeht es nicht besser. Das genaue Studium der Spielpläne spricht Bände. Eine "Traviata" lässt sich mit leichten, lyrischen Stimmen noch bewältigen. Danach wird es düster, die Besetzungsbüros ächzen bei der Sängersuche. Der hohe Verdi-Bariton - eine Seltenheit; der Spinto-Sopran - eine Rarität; der tenore eroico - nicht vorhanden. Kommt hinzu die (deutsche) Dirigentenkrise: was Karajan noch konnte, kann Thielemann nimmermehr. Selbst die Italiener haben verlernt, wie bei der Premiere von Verdis "Simon Boccanegras" an der Frankfurter Oper zu erleben war: die Schattenspiele, der geschmeidige, an der Szene orientierte Wechsel der Tonfälle, die rhythmische Gespanntheit, das Schweben der Melodie. Der vom Publikum erstaunlich gefeierte Frankfurter Generalmusikdirektor Paolo Carignani, eigentlich vom Typus agil-temperamentvoll, kleistert eine löchrige, gebleichte Klangtapete ans Dogen-Drama. Verschenkt die düsteren Farben des Seelenmeeres, die heranbrausenden Stürme der Volkesstimme. In absoluter Zeit gemessen, bleibt das im Maß - und wirkt doch verschleppt, fahrig, zerdehnt. In der Ratsszene mit den großartigen Raumperspektiven, den Chören hinter der Bühne, entfaltet sich kaum dramatische Dynamik. Die hier wichtigen Blechbläserattacken sind schlecht ausgeformt. Im ersten Finale mit den scharf gezackten Fanfaren zu Simones Ansprache sticht mal eine aberwitzige Posaune hervor, dann drückt eine Trompetenstimme aufs Gewicht. Der gut verblendete Bläsersatz hat dienstfrei. Atem und Attacke, Anrührendes und Abscheuliches - vieles ließe sich mit dem starken Frankfurter Museumsorchester formen in dieser Partitur, die in der hier gespielten Zweitfassung wunderbar unkonventionell, formelfrei ist - und so modern brüchig. Aber Paolo Carignani dirigiert mit Eleganz ohne Substanz. Beinahe enttäuschender die Sänger: hier in Frankfurt, wo der Intendant Bernd Loebe bisher mit Geschmack und Instinkt Arrivierte und junge Unbekannte in Ensembles versammelte, die ein Stück belebten, wie es das Dramaturgentheater alleine nicht kann. Nun dies: Paul Charles Clarke als Gabriele Adorno, eher ein Charaktertenor, singt flach und glanzlos; in der Höhe unfrei liegt die Stimme nicht auf dem Atem. Trotzdem ringt sich Clarke hier und da ein Legato ab. In den dramatischen Angelpunkten der Ratsszene fehlt es ihm entschieden an Kraft. Wenn er den Rivalen Simone angreift, hat sein "Pel cielo!" nichts vom "terribilmente" im Ausdruck, das Verdi hier fordert. Mehr tonliches Gewicht wünscht man sich auch vom hell tremolierenden Paolo-Sänger Johannes Martin Kränzle, dem Mann, der Simone erst zur Herrschaft verhilft und ihn dann eifersüchtig vergiftet. Grau und von schwacher Bassgegenkraft zu Simone der Fiesco des Bálint Szabã - Verdi verlangte vom Darsteller eine "Grabesstimme". Gleichförmig hält sich Szabã an die Vokallinie, ohne aus den Worten die Farben zu gewinnen, mit denen das Melos zu tönen wäre. Loebes Trumpf ist Zeljko Lucic, ein Simone von Weltformat. Und dazu noch aus dem eigenen Ensemble - bis zum nächsten Jahr. Lucic, der inzwischen regelmäßig an der New Yorker Met gastiert, verlässt das Frankfurter Haus 2008. Der grimme Kraftdarsteller singt den Korsaren, der von den Genuesern zum Dogen gewählt wird, mit einem Bariton, der von gleichem warmem Rot ist wie das Blut am Schwert des schillernden Charakters. Lucic hat das Piano für die Traurigkeit des unglücklich Liebenden und das Forte für den Gewaltmenschen. In ihm wird das Paradoxon von Gewalt als Voraussetzung von Befriedung begreifbar - das hat wenig an Aktualität verloren. Annalisa Raspagliosi, als die wiedergefundene Tochter Amelia, bringt außer der guten Figur als Einzige die charakteristische Stimme mit, um neben Simone als Charakter Größe zu gewinnen; da hört man über gelegentliche Unausgeglichenheit in den Registern, eine aufzackende Schärfe im dramatischen Moment hinweg. Vielleicht lag es an der weit gehend stimmungslosen musikalischen Realisierung, dass Christof Loy, der radikale Ästhet, mit seiner Inszenierung mehr das Hirn als das Herz traf. Gegen kluge Opernregie ist nichts einzuwenden. Allein davon wird man nicht satt. Auf Ornament und Kostüm verzichtet Loy in dem von Johannes Leiacker entworfenen Raumviereck, ein mit Segeltuch bespanntes Gerüstgerippe um eine leicht ansteigende Holzrampe, das im kühl-hellen Licht einer Probebühne gleicht. Gedeckte Farben für den Chor: Hose, Bluse, Rock. Schwarze Pullis, Hemden, Anzugsjacken für die Protagonisten. Nur Simone hängt sich widerwillig den Purpurherrschermantel über. Loy wagt gleich zu Beginn den Illusionsbruch. Das Frankfurter Opernhaus verfügt über eine Besonderheit: der eiserne Vorhang setzt vor dem Orchestergraben auf. Anfangs nun ist er geschlossen und sperrt das vertraute Stimmen der Instrumente vor der Aufführung aus. Wenn er sich gehoben hat, springt ein gnadenloses Licht an, und der versammelte Chor, das Volk, starrt regungslos auf uns. Eine, zwei, drei, vier Minuten bleibt alles stumm. Einigen Zuschauern wird unbehaglich - Behaglichkeit ist ja eine der größten Verlockungskräfte der Oper. Vier Minuten 33 sollen es genau sein: John Cages Experiment mit der performativen Stille, das als Prolog zum Prolog dient. Dann treten nacheinander alle ab, wozu sich Verdis Musik dazwischenschiebt. An dieser Konstruktivität, der Logik der Bewegungsrichtungen, hält Loy fest und schließt in Bogenform den Dramenzirkel. Am Schluss stehen sie alle wieder da, stumm. Verdis düstere Oper endet in Resignation. Jetzt fehlt Regiemut. Kein Licht, das hart ausknallt, keine 4.33 Minuten Zurückgeworfenheit des Schauenden auf sich selbst. Langsam, fast versöhnlich verlischt das Bild nach nur kurzer Stille. Der Regisseur inszeniert auf Lücke, kaut nicht Bedeutung vor, meidet symbolische Überfrachtung. Seine Zeichen sind stark und werden ökonomisch eingesetzt. Der Zeitensprung nach dem Prolog, 25 Jahre, vollzieht sich in einer Bewegung, Simone, Fiesco, Paolo ziehen das jugendlich-straffe Perückenhaar ab. Beim Tod des Simone wird ein mit dem Meer bemalter Leinwandprospekt über den Dahingesunkenen gezogen: Leichentuch, Vereinigung mit der Liebsten, denn zu Beginn wurde genau so, gegenläufig, die tote Geliebte freigegeben, von der ihm nur die Tochter geblieben war, die er wieder gefunden hat - zu spät für sein Glück und das der Republik. |
|
Im Scheitern zeigt sich ein Stück Menschsein
Das tragische Scheitern von Giuseppe Verdis Opernhelden zeigt exemplarisch ein Stück Menschsein - und ist daher zeitlos aktuell. Diese Quintessenz zieht Regisseur Christof Loy aus "Simon Boccanegra" und verhandelt das Melodramma wie ein Requiem in strengem Schwarz-Weiß. Mit einem die Härten, aber auch die milden, nahezu religiös inspirierten Momente der Musik aufzeigenden Paolo Carignani und dem überragenden Titelhelden Zeljko Lucic wirkte diese Neuinszenierung der Oper Frankfurt so packend wie berührend. Und der Beifall prasselte erst nach einer szenisch wohl kalkulierten Verzögerung. Schon vorm Vorspiel, nach dem Schlag einer Schiffsglocke steht das Ensemble samt Volksmassen auf der Bühne und fixiert minutenlang die Zuschauer. Die nervenzehrende Stille, durchsetzt von verlegenem Hüsteln, führt direkt in die dunklen Sphären des grausamen Spiels um einen Unbeugsamen, der versöhnen will, aber den Gifttod erleidet. Beim durch Plebiszit zum Dogen von Genua ernannten Boccanegra, als Freibeuter ein Volksheld, führen alle Wege zum Meer, auch sein letzter. Entsprechend wirkt Johannes Leiackers stählerner Bühnenbau wie eine Hafenanlage mit Metalltreppen, Plattformen und einem Gerüst, das über der Szene schwebt. Da lenkt nichts vom tragischen Geschehen ab. Allenfalls das unruhige Meeresprospekt mit seinen dunklen Wolken. Oder jener knallrote Vorhang zur Hinterbühne, der wie ein Signal des Aufruhrs in wilde Bewegung versetzt wird. Denn neben mörderischen politischen Intrigen, gibt es eine hochemotionale Ebene: Boccanegra hat ein Kind mit der Tochter des gottähnlich auftretenden Patriziers Fiesco, das entführt wurde, im Kloster einen Adelsnamen annahm und den Edelmann Adorno liebt, ebenfalls ein Gegner des Dogen. Überaus spannend, wie Regisseur Loy auf schrägen Schiffsplanken beziehungsreiche psychologische Spannungsfelder aufbaut, ohne die schier sakrale Sphäre zu verlassen. Wie er die Volksmassen zu kämpferischer oder angstvoller Phalanx arrangiert, noch auf dem Weg zum Schafott eine Prozession halbnackter Männer. Dazu Verdis "Musik aus dem Geist des Theaters", deren dunkle Cello-Grundierung Carignani in großer Ruhe ausspielen lässt. Wie er die Morgenstimmungen transparent macht, fiebrig gläubige Hoffnung auf den Frieden schürend, und die starken Arien-Bekenntnisse empfindsam untermalt. Verdis "hm-ta-ta" tönt hier in Moll, vom Energie abstrahlenden Museumsorchester in grelle expressionistische Klangbereiche getrieben - mit dem gellendem Schrei des viel beschäftigten und klanglich wandlungsfähigen Chors (Einstudierung: Alessandro Zuppardo). Hier ist Bariton Zeljko Lucic der Souverän, als den man ihn kennt, ein Boccanegra der hohen klanglichen Temperaturen, aufbegehrend, anrührend und selbst im langwierigen Sterben ungebrochen. Als Fiesco bemüht sich Balint Szabo auch um stimmliche Autorität, ein Bass von beeindruckender Tiefe, aber unter Druck intonatorisch flackernd. Paroli bietet schon eher Johannes Martin Kränzle, der intellektuelle Volkstribun Paolo, Opfer seiner Ränke, ein Bariton, dem man alles abnimmt, zudem eilfertig unterstützt von Pietro, dem stabilen Bassisten Pavel Smirnov. Während Paul Charles Clarke als Adorno Liebesglut und Betroffenheit mit einer Tenorstimme artikuliert, die den Italiener bezeugt, aber im Laufe der Distanz in der Höhe immer schmaler wird. Bis auf ein paar zu spitz geratene Töne makellos und von starker Ausstrahlung: Als Amelia hat Annalisa Raspagliosis ausdrucksfähiger Sopran zudem eine betörende Süße. Verdis Musik ist schon verloschen, wenn am tragischen Ende alle Akteure wiederum ihr Publikum anstarren - als wollten sie sagen: So seid ihr! KLAUS ACKERMANN |
|
Ein Idealist scheitert Oper: „Simon Boccanegra" in Frankfurt: Verdi, wie man ihn noch nicht erlebt hat Von Albrecht Schmidt FRANKFURT. Mit einem Exempel fesselnder, suggestivster Stillhaltekunst überrascht und fasziniert die Frankfurter Oper ihre Besucher am Anfang und Ende ihrer Neuproduktion von Giuseppe Verdis „Simon Boccanegra". Auf einem kahlen, nach rückwärts leicht ansteigenden Bühnenpodest, umgeben von Stahlgerüsten, stehen minutenlang regungslos über hundert Choristen und Statisten in dunkler Alltagskleidung. Zu Beginn ist es eine Stille, die vom üblichen Husten, Gemurmel und besorgten, jedoch sofort niedergezischten Applausversuchen begleitet ist. Nach drei spannenden Opernstunden, wenn sich der Kreis schließt und alle Akteure im Zeitlupentempo auf ihre Ausgangspositionen zurückkehren, herrscht gebannte Totenstille, die einem die Kehle zuschnürt. Christoph Loy (Inszenierung) und Paolo Carignani (musikalische Leitung) mögen sich an Cages Kompositionsabsicht, „das Denken zu läutern und zur Ruhe zu bringen", erinnert haben und distanzieren sich bei Verdis „Simon Boccanegra" von vordergründiger Dramatik, Renaissancegepränge und dem damit verbundenen Kostüm- und Requisitenplunder. Mit einer Reduzierung des Optischen (Bühne: Johannes Leiacker, Kostüme: Bettina Walter) und gezielt eingesetzter Statuarik und verzögerten Bewegungsabläufen will die Inszenierung den Blick auf die Musik richten und damit auch vom konfusen Geschehen ablenken, das selbst durch die deutsche Übertitelung kaum zu entschlüsseln ist. Wohl wissend, dass in der Auseinandersetzung mit Realpolitik, mit Machtkämpfen, Intrigen und Verrat Möglichkeiten zu Aktualisierungen liegen, interessiert die Regie nicht primär die politischen Konstellationen in Genua um 1350, sondern die Befindlichkeit eines in politische und private Schicksale verstrickten Menschen, die auch dem heutigen Betrachter nahe geht: Zeljko Lucic zeichnet mit seinem facettenreichen, modulationsfähigen Bariton ein großartiges Rollenporträt des Simone, des liebenden Vaters und des am Ende scheiternden Idealisten. Singend wie spielend eine Wohltat ist die Amelia der Annalisa Raspagliosi, während Paul Charles Clarke als Gabriele Adorno zwar tenorale lyrische Expressivität, aber zu wenig Belcantoqualitäten zeigt. Neben Lucic debütierten Bálint Szabó als gleichermaßen standesstolzer wie milder Boccanegra-Gegenspieler Fiesco und Johannes Martin Kränzle als finsteres Judas- und Jago-Modell in der Rolle des intriganten Bösewichtes Paolo Albiani. Doch das eigentliche Ereignis dieses Frankfurter „Simon Boccanegra" ist das Museumsorchester unter der Leitung von Paolo Carignani, der nicht nur für eine vollkommene Einheit zwischen Bühne und Orchestergraben sorgt, sondern die Kostbarkeiten der Partitur, zuvorderst die kammermusikalischen Feinheiten und die stillen Momente, mit wunderbaren klanglichen Nuancierungen und dynamischen Schattierungen ausformt. In Frankfurt lässt sich ein Verdi entdecken, den man so noch nicht erlebt hat. |
|
Der einsame Mann und das Meer Von Volker Milch
FRANKFURT In Bohuslav Martinus Oper "Griechische Passion" wird aus einem frommen Passionsspiel eine wahre, zur "Imitatio Christi" innerhalb einer Dorfgemeinschaft führenden Leidensgeschichte. Der Regisseur Dietrich Hilsdorf hatte sich von dieser auf dem Roman von Nikos Kazantzakis beruhenden Opern-Handlung inspirieren lassen, als er 2005 in Wiesbaden Johann Sebastian Bachs Johannespassion als Musikdrama inszenierte. Aus Oratorium wurde Oper. Den umgekehrten Weg wollte jetzt offenbar Christof Loy in Frankfurt mit seiner so eigenwilligen wie eindrucksvollen Interpretation von Giuseppe Verdis "Simone Boccanegra" beschreiten: Die Geschichte des Korsars, der im 14. Jahrhundert Doge in Genua wird, politisch-private Kämpfe zu bestehen hat, Frieden und Liebe in der sich im Bürgerkrieg zerfleischenden Stadt predigt und schließlich einem Giftanschlag zum Opfer fällt, erzählt Loy als düstere Passionsgeschichte. In statischen, fast halbszenischen Passagen erinnert sie immer wieder an ein Oratorium. Der staatstragende Dogen-Mantel fällt von Boccanegra ab wie die Opern-Posen oder die Stoffbahnen der Bühnen-Konstruktion: Die Reduktion auch der Ausstattung, Schlichtheit der dunklen Kleidung signalisieren eine Konzentration aufs Wesentliche, die die Aufmerksamkeit immer wieder auf die musikalischen Werte der zweiten Fassung (1881) von Verdis Melodrama fokussiert. Von der Opern-Konvention setzt sich die Inszenierung bereits durch die gedehnte Stille ab, die das Publikum empfängt und am Schluss wieder entlässt: Der Chor starrt lange reglos ins Auditorium. Ungeduldige versuchen, das Geschehen mit Applaus in Gang zu bringen. Frankfurts Generalmusikdirektor Paolo Carignani ist in der düsteren orchestralen Grundierung des Werks ganz in seinem Element, unterstreicht mit dreinfahrenden Blechbläsern Verdis bisweilen drastische Instrumentierung. Großes Musikdrama entsteht aus der Spannung zwischen Chor-Kollektiv und Individuum etwa im Finale des ersten Akts, wenn Boccanegra seine berühmte Ansprache hält ("Plebe! Patrizi! Popolo") und Paolo dazu zwingt, sich selbst zu verfluchen. Der appellative politische Aspekt, der bei Verdi auch die Einigkeit im Italien seines Jahrhunderts meint, tritt in Loys Sicht hinter den heilsgeschichtlichen der Passion zurück. Die äußerliche Statik der Personenführung des Regisseurs, der in Frankfurt ja zum Beispiel schon mit seiner ausgezeichneten "Entführung" erfolgreich war, ist von einer inneren Dramatik erfüllt, die sich auch ohne große Gesten mitteilt. Die Figuren-Konstellationen auf der rechteckigen Spielfläche wirken dabei manchmal wie die eines Schachspiels in der Endphase. Im Zentrum steht Zeljko Lucic als ein Doge, der die Einsamkeit der Macht unmittelbar spüren lässt und zwischen voluminösem Wohllaut und Charakterisierungskunst ein vorzüglich gestaltender Verdi-Bariton ist. Das an Frankfurts Oper in der Regel ja vorzügliche vokale Niveau erscheint in diesem Fall etwas weniger einheitlich, aber selbst gefährdete Höhenflüge von Annalisa Raspagliosis Amelia und Paul Charles Clarkes charismatisch-kraftvollem, jedoch angestrengt aufgerautem Gabriele Adorno tragen in gewissem Sinn zur gesteigerten Authentizität der Passionsgeschichte bei. Einen würdigen Gegenspieler hat Zeljko Lucic in Balint Szabos profundem Jacopo Fiesco, während Johannes Martin Kränzles souveräner, packend gespielter Paolo die Judas-Funktion übernehmen muss. Am Schluss legt sich der sterbende Simone Boccanegra vor ein Gemälde seines Elements, des Meeres, vor ein leitmotivisch entrolltes Seestück. Die Leinwand setzt sich in Bewegung, das Meer nimmt den Dogen wieder auf. Einer der eindringlichsten Momente einer vom Publikum nachhaltig gefeierten Premiere. |
|
Eine italienische Passion? kritik von Midou Grossmann Verdis ‚Simon Boccanegra’ hat nie wirklich Fuß gefasst in den Spielplänen der Opernhäuser und wenn man die Frankfurter Inszenierung gesehen hat, versteht man wieder warum. Die erste Fassung der Oper fiel 1857 bei der Premiere in Venedig durch, erst 24 Jahre später erlebte das Werk mit einem überarbeiteten Libretto von Arrigo Boito und einer musikalischen Revision von Verdi eine erfolgreichere Aufführung an der Mailänder Scala. Doch auch danach tat sich die Oper auf internationaler Ebene sehr schwer, ein Publikumsrenner ist das Werk sicherlich nie gewesen. Das Libretto der zweiten Fassung zeigt immer noch immense Schwächen, die Handlung bleibt zu sehr an der Oberfläche, Verdis Hang zum Pathetischen wirkt in dieser Oper störend, wirkt museal und ist wohl auch schon im Jahr 1857 mehr Ancien Regime als Aufbruchswerk. Christof Loy setzt auf einen religionsphilosophischen Aspekt, auf ein imitatio Jesu, so jedenfalls ist es im Programmheft nachzulesen und er tut sich und dem Werk mit einer solchen hoch angelegten Deutung keinen Gefallen. Dubios seine minimalistische Personenregie, die drei Stunden lang schleichende, zumeist schwarz gekleidete Menschen, auf einer kargen Bühne (Johannes Leiacker) agieren lässt. Ein Passionsspiel hat mehr Tiefe, aber die kann das Werk nicht liefern, Verdi war nie ein Spezialist für Spiritualität. Bemerkt man in vielen Teilen der Gesellschaft wieder eine Hinwendung zum Feudalismus, so hat die Sozialisierung des Musiktheaters in Deutschland immer noch Hochkultur, beides ist sicherlich ein vorübergehendes Extrem. Auf der Bühne in Frankfurt dominiert eine ‚no future’ Gesellschaft, ohne Empathie und Elan, in der auch die Hauptakteure gefangen sind und nebeneinander vorbei spielen, auf die dramatische Entwicklung der Handlung wartet man vergebens. Seltsam emotionslos auch der Gesang und das Orchester. Musste man da dem Konzept des Regisseurs Rechnung tragen? Paolo Carignani setzt auf sehr breite Tempi, Italianità scheint verboten zu sein. Das Orchester ist zudem nicht immer ganz bei der Sache, Wackler und ein Mangel an Koordination sind zu bemerken. Die Sänger sind durch die statische Regie an einer ausgefeilteren Interpretation sicherlich gehindert gewesen. In der Titelpartie debütiert Zeljko Lucic, der die schwierige Partie sehr beachtlich meistert, aber darstellerisch blass bleibt, ebenso Annalisa Raspagliosi als Maria, von der die Regie, neben der schleichenden Fortbewegung, nicht mehr als schmachtende Blicke und ein gelegentliches auf dem Boden kauern fordert. Der Tenor Paul Charles Clarke in der Rolle des Adorno hat keinen guten Abend, seine Stimme klingt gepresst und die Höhe ist zumeist forciert. Etwas mehr Profil zeigt Johannes Martin Kränzle in der undankbaren Partie des Paolo, farblos dagegen Bálint Szabó als Fiesco. Wie weit Christof Loy hier ein Sängerfest, vielleicht aus falsch verstandener Pietät, verhinderte, ist unklar, jedenfalls durfte der Chor unter der Leitung von Alessandro Zuppardo etwas mehr glänzen, dafür musste er auch vier Minuten schweigend am Beginn der Vorstellung auf der Bühne stehen und in das Publikum starren, welches zumeist amüsiert diese Zeit ebenfalls schweigend meisterte, von dem obligatorischen Husten einmal abgesehen. Jemand erzählte mir etwas über John Cage, was ich nicht nachvollziehen konnte, denn diese Schweigeminuten erinnerten mehr an einen erhobenen Zeigefinger des Regisseurs als an eine Aktion des genialen Multitalents John Cage |
|
Frankfurt: Sternstunde mit „SIMONE BOCCANEGRA" Das ergriffene Publikum zollte zu Recht den beiden Hauptverantwortlichen für den grandiosen Abend, dem Generalmusikdirektor und Dirigenten Paolo Carignani sowie dem Darsteller des "Simon", dem bewunderungswürdigen Bariton Zeljiko Lucic, starken, nicht enden wollenden Beifall. Carignani hatte in intensiver Vorarbeit das Orchester auf die dunklen, schweren und traurigen Farben der Verdi-Musik, auf die feinen Valeurs der Nebentöne eingestimmt; kontrastreich, klar strukturiert blühten die Töne schwelgerisch bis zu den großen mächtigen Klangwogen auf. Grandios auch die Mitwirkung des Chores, wunderbar von Alessandro Zuppardo eingestellt. - Das geschlossen wirkende Sängerensemble wurde von den herrlichen dunklen Stimmen dominiert, allen voran von Zeljiko Lucic, der mit Kraft, Ausdauer und schönem Timbre alle Nuancen der Enttäuschung, des Glücks, der Todesangst und der Versöhnung zum Ausdruck brachte, äußerlich mehr einen Aufsteiger als den Dogen verkörpernd. Der Vater von Maria, Fiesco, in Person des Balint Szabo, und der Schurke Paolo, der Bass-Bariton Johannes Martin Kränzle, hielten in ihrer Kunst nur geringen Abstand zum Dogen Simon. Tadellos die Amelia der Annalisa Raspagliosi. Ihr Geliebter Adorno, der englische Tenor Paul Charles Clarke, berührte mit viel Gefühl und heftigen Ausbrüchen; unzureichende Einstimmung in die Intonation und teilweise fehlende Tonfarben wurden dadurch ausgeglichen. - Eine karge weite Bühne, viel nüchternes Eisenwerk für Abgrenzungen, Treppen und Balkone hatte Regisseur Christof Loy zusammen mit Ausstatter Johannes Leiacker geschaffen, um die Konzentration auf die Handlung, die nur wenig bewegten Personen und Gruppen zu lenken, zugleich die Einsamkeit der beteiligten Menschen zu symbolisieren. Moderne, einfache Bekleidung mit schwarzen oder grauen Hemden ließ ebenfalls keine illusionistischen Bilder aufkommen. Dadurch wurde die Zeitlosigkeit von Inhalt, Musik und Gesang betont. - Originell, auch passend, die Idee, vor und nach dem Opernwerk ein „Stück" von John Cage einzublenden, in Form einer stillen Musikpause vor geöffnetem Vorhang. - Noch nie hatte ich einen so bewegenden, zu Herzen gehenden „Simon Boccanegra" gehört. Ulrich Springsguth |
|
Baritones Battle in Frankfurt's `Boccanegra' By Shirley Apthorp May 22 (Bloomberg) -- With political poisonings all the rage, the Frankfurt production of ``Simon Boccanegra'' could have been an orgy of references to current post-communist politics. After all, the 1857 opera about the murdered Doge of Genoa was Verdi's message to the feuding Italians of his time. The new staging of this dark historical drama resists all urges to quote current events. Instead, it serves up something that is overtly what it is -- a grimly massive piece of music theater, in which singers make glorious sounds to remind us of our own mortality. Christof Loy presents Verdi's opera (in its 1881 revision) as a pared-down passion play, an ``Everyman'' for our time. The opera spans 25 years in the 14th century, detailing the rise and fall of Genoa's first freely elected Doge. Verdi complicates an already convoluted story by adding two generations of love triangles, disguises, abductions and false identities to the political sub-plots of intrigue and assassination. Loy's determination to strip the piece down to its bare essentials does much to keep the action intelligible. It's a rare treat in Germany's novelty-obsessed opera world to find a production that never forgets for an instant that this art form is mainly about music. ``Simon Boccanegra'' is one of Verdi's most somber works, its colors darkened by the predominance of baritones in the cast, its score tugged down by gut-wrenching rumblings of terror in the orchestra. Somber Tones Loy sees Boccanegra as a Biblical allegory, closely related to Verdi's ``Requiem.'' Johannes Leiacker's set is an unadorned platform of wood on steel slats, walls and a backdrop made of plain cloth, a slatted staircase on either side. Bettina Walter costumes the singers in everyday clothes of black and gray. In lesser hands, what Loy does would be dull. Cast and chorus spend much of their time immobile, in the footlights, singing straight at the conductor. This is part oratorio, part autism. Yet it's done with such fanatical precision, detail and grace that the mix becomes gripping. Although Loy never lets us forget that these are people playing roles, each character is drawn so intensely that we are soon drawn deep into the story. It is a bold, high-risk way to make theater, with conventional debts to Bertolt Brecht, but it works, and it leaves the music firmly center-stage. That's a fine thing with Paolo Carignani on the podium and this high-carat cast. It is this conductor's kind of piece, rich and forceful, with a dense romanticism where the orchestra needs to be both tightly controlled and frenzied. To make ``Boccanegra'' work, electrifying orchestral playing is important and a strong cast is vital. This one has a cracking conclave of singers with the maturity to make the time span plausible yet the strength to see out an evening's long, loud sing. Forceful Baritone Zeljko Lucic, the Yugoslavian-born baritone, gives a towering performance in the title role, bringing gravity and sonorous force, showing us edges of pain and dawning self- knowledge on his path to a poisoned end. Balint Szabo makes a worthy opponent as Fiesco, his political and personal enemy, with unrelenting focus and a more veiled, grainy timbre. Annalisa Raspagliosi is an effortful yet slightly vacuous Amelia/ Maria, lover of the opera's only tenor, Paul Charles Clarke's strained though dependable Adorno. The greatest strength of this production is in the unity of its elements, its ferocious concentration and ultimate clarity. (Shirley Apthorp is a critic for Bloomberg News. The opinions expressed are her own.) |
|
L'umanità del Simone Con quasi dieci minuti di applausi, il pubblico festeggia il debutto del nuovo "Simon Boccanegra" all'Oper Frankfurt. Il direttore Paolo Carignani porta al successo una compagnia di canto, su cui domina il Simnone di Željko Lucic. Molto efficaci la lettura asciutta del regista Christof Loy e la bella scena di Johannes Leiacker, che evoca ambienti marittimi.
Musicalmente il risultato è di quelli importanti. Assecondato da un'orchestra in stato di grazia, Paolo Carignani offre una lettura appassionata e appassionante. Lavora sul colore e sulle dinamiche, impone strette rapinose e teatralissime, canta quando deve. Un risultato che ottiene anche grazie ad una compagine di canto che, se non spicca per grandi personalità, funziona perfettamente nell'insieme. Eccezione è Željko Lucic: la bellezza del timbro, il fraseggio nobile, la varietà di accenti e l'intima adesione al ruolo ne fanno non soltanto il protagonista assoluto della serata ma anche un baritono verdiano autentico. Infine, un elogio al coro, magnifico, preparato da Alessandro Zuppardo. Una serata felice, salutata da quasi dieci minuti di applausi. Stefano Nardelli |







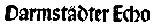
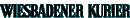





 A sfogliare il programma di sala ricco di simboli cristiani e ripensando a Loy e alla sua lettura religiosa del "Simon Boccanegra", ci si sarebbe potuti aspettare una messa in scena fortemente simbolica e intellettualistica dell'opera verdiana. Invece, a parte un innocuo "Ingemisco" fuori scena che segna il passaggio fra prologo e primo atto, Christof Loy costruisce uno spettacolo fortemente "umano". Il suo "Boccanegra" è privo di simboli, quasi spoglio, ma di grande forza espressiva, a cominciare dall'apertura di forte impatto con solisti, coro e comparse in scena, a fissare il pubblico per cinque minuti in silenzio, quasi a voler stabilire un ponte, un legame ideale con lo spettatore. Nella bella scena di Johannes Leiacker - che evoca ambienti marittimi, con i suoi fondali che si avvolgono come vele, le tavole di legno della scena che richiamano un ponte, e scalette e poggi metallici - Loy sviluppa le sue tipiche geometrie di affetti e costruisce un dramma vero, pienamente credibile, con ammirevole economia di mezzi.
A sfogliare il programma di sala ricco di simboli cristiani e ripensando a Loy e alla sua lettura religiosa del "Simon Boccanegra", ci si sarebbe potuti aspettare una messa in scena fortemente simbolica e intellettualistica dell'opera verdiana. Invece, a parte un innocuo "Ingemisco" fuori scena che segna il passaggio fra prologo e primo atto, Christof Loy costruisce uno spettacolo fortemente "umano". Il suo "Boccanegra" è privo di simboli, quasi spoglio, ma di grande forza espressiva, a cominciare dall'apertura di forte impatto con solisti, coro e comparse in scena, a fissare il pubblico per cinque minuti in silenzio, quasi a voler stabilire un ponte, un legame ideale con lo spettatore. Nella bella scena di Johannes Leiacker - che evoca ambienti marittimi, con i suoi fondali che si avvolgono come vele, le tavole di legno della scena che richiamano un ponte, e scalette e poggi metallici - Loy sviluppa le sue tipiche geometrie di affetti e costruisce un dramma vero, pienamente credibile, con ammirevole economia di mezzi.