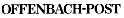|
Die Frankfurter Oper spielt „Tiefland“ Eugen d’Alberts Oper „Tiefland“, 1903 komponiert, war fast ein halbes Jahrhundert lang unglaublich populär und hatte einen ganz besonderen Fan: Adolf Hitler. Danach verschwand sie von den Bühnen. Jetzt wagt sich die Oper Frankfurt an das Werk. Wie „Die Meistersinger“ und „Die Lustige Witwe“ zählte diese Oper zu Hitlers Lieblingswerken. Gegen Ende des Dritten Reiches verfilmte Leni Riefenstahl das Bauerndrama. Für die Statisten rekrutierte sie Zigeuner aus Konzentrationslagern. Dafür ist zwar der damals schon lange gestorbene Komponist und Pianist Eugen d’Albert nicht verantwortlich zu machen, trotzdem wagte sich lange Zeit keine Bühne mehr an dieses Werk. Doch jetzt kommt „Tiefland“ gleich in mehreren Städten wieder zur Aufführung – nach Zürich und Wien in Frankfurt.
John Treleaven, der in der Frankfurter Inszenierung den Hirten Pedro singt, ist einer der großen Wagnertenöre unserer Zeit. Er stammt aus Cornwall im Südwesten Englands, doch zu Hause ist er in Deutschland. Seit 15 Jahren wohnt er in Nackenheim am Rhein. Die Rolle des Pedro ist eine Partie, die für einen Wagnersänger wie ihn wie geschaffen ist. Im Mittelpunkt der Oper steht der Hirte Pedro, der einsam im Gebirge lebt, dann ins Tal hinabsteigt, um sich eine Frau zu suchen. Dort gerät er alsbald in die schönsten dramatischen Konflikte. Lange Zeit wurde „Tiefland“ mit dem umstrittenen Film von Regisseurin Leni Riefenstahl in Zusammenhang gebracht. Vor wenigen Jahren erst machte der Film wieder Schlagzeilen. Hitlers Starregisseurin hatte sich eigenhändig in einem KZ die Komparsen für den Film ausgesucht: Sinti und Roma, die später ermordet wurden. Zudem soll „Tiefland“ eine der Lieblingsopern von Hitler gewesen sein. Das reichte aus, um das Werk nach Ende des Zweiten Weltkrieges in Verruf zu bringen. Dass die Qualitäten der Oper darüber vergessen wurden, bedauert John Treleaven: „Es ist hohe Zeit, dass wir das endlich hinter uns bringen und vergessen und lieber an die wunderschöne Musik denken, die d’Albert uns geschrieben hat. Und der hatte natürlich keine Ahnung davon, dass seine Musik so schrecklich ausgenutzt wurde.“
John Treleaven: “Es ist eine schöne Herausforderung für einen Sänger, weil man eine gewisse Zärtlichkeit und lyrische Empfindungen ausdrücken muss. Trotzdem muss man dann in den großen Tutti-Momenten dagegenhalten, wo das volle wagnersche Orchester spielt.“ Erst nach der Hochzeit erfährt der Hirte Pedro, dass er in eine üble Intrige geraten ist: Seine Frau ist die Geliebte eines anderen. Aber zum Glück hat diese Oper ein Happyend. "Tiefland“ ist keine Oper, die die Welt erklärt, kein Ideendrama. Sie ist eine einfache Geschichte über einfache Menschen. Vorgestellt von Manfred Scheyko für "hauptsache kultur!" | |
|
Gebirgstapete In Abkehr von Richard Wagner und den groBen mythischen Stoffen habe sich Eugen d'Albert in seinen musikalischen Buhnenwerken dem realen Leben und den einfachen Menschen zugewandt. Als Beispiel fur diesen "Verismo" konne auch ,"Tiefland", die bekannteste seiner 21 Opern, dienen. Das hat die Dramaturgin Agnes Eggers bei der Einfuhrungsmatinee "Oper extra" in der Oper Frankfurt erlautert, wo das Werk am kommenden Sonntag, 10. Dezember, um 18 Uhr in der Inszenierung von Anselm Weber Premiere hat. Gespielt wird das Musikdrama, zu dem Rudolf Lothar den deutschen Text nach dem Schauspiel "Terra baixa" des spanischen Autors Angel Guimera schrieb und das bei der Urauffuhrung 1903 in Berlin ein groBer Erfolg war, in der uberarbeiteten Fassung des Jahres 1905. Im Zentrum der Handlung steht der allein in den Pyrenaen lebende Hirte Pedro. Als der Großindustrielle Sebastiano aus dem Tiefland zu ihm kornmt und ihm die Hand seiner Bediensteten Marta anbietet, willigt der einsame Pedro sofort cin. Er ahntnicht, daß Sebastiano die junge Frau seit ihrer Jugend miBbraucht, dies weiterhin zu tun gedenkt und die Hochzeit nur aus finanziellen Grunden arrangiert. Marta faßt jedoch so viel Vertrauen zu Pedro, daß sie ihm diese Verhaltnisse offenbart. Der Hirte erwurgt daraufhin den reichen Mann, und das junge Paar flieht ins Gebirge. Laut Regisseur Anselm Weber braucht diese Handlung ,,einen realen Ort". Mit dem Btihnenbildner Hermann Feuchter entschied er sich daher, nahe an den Vorgaben des Originals zu bleiben. Zu sehen sein wird, wie Feuchter berichtete, zunachst eine ,,iibergroBe Gebirgstapete", die mit Pedros "Wohnhohle" verschrankt sei. Die Szenen imn Tiefland spielen dann in einer Fabrikhalle, in deren Mittelpunkt ein Miihlrad steht und die einen Ausblick auf die Gebirgslandschaft bietet. Das Tiefland sei dabei als Ort der Enge, der Ausweglosigkeit, der Intrige und der Macht zu verstehen, erlauterte Weber. Die musikalische Leitung hat Sebastian Weigle, gegenwartig noch Generalmusikdirektor in Barcelona, der aber für dieses Amt in Frankfurt als Nachfolger von Paolo Carignani designiert ist. Er wies auf Anklange der Komposition an Puccinis ,"Tosca", Bizets "Carmen", aber auch an die chromatische Harmonik von Wagners ,"Tristan und Isolde" hin. Zugleich habe sich d'Albert mit spanischer Folklore beschaftigt, so daß auch Tanzrhythmen samt Kastagnetten klang auftauchten. GUIDO HOLZE | |
|
OPER Von Ellen Kohlhaas
Hitlers Lieblingsoper, Wunschkonzert-Sentimentalität, die verlogene, moralisch plakative Gegenüberstellung von verkommenem Tiefland und heilem Hochland, gar ein Blut- und Boden-Verdacht: All diese kritischen Girlanden rund um Eugen d`Alberts einst populäre, heute fast vergessene Oper „Tiefland" kümmern den Regisseur Anselm Weber, der den Zweiakter mit alpinem Vorspiel gerade für die Premiere am Sonntag an der Frankfurter Oper vorbereitet, herzlich wenig. Viel lieber befaßt er sich nahe an Libretto und Musik mit dem psychologischen Beziehungsnetz zwischen den Figuren. Im Gespräch mit dieser Zeitung entdeckt Weber Parallelen zwischen dem d’Albert und Leoš Janáceks „Katja Kabanová", die er in der Spielzeit 2003/ 2004 in Frankfurt inszeniert hat. Hier wie dort steht eine Frau im Zentrum, die außer Gewalt keine Zuwendung kennt. Marta im „Tiefland" wird obendrein zum hörigen Lustobjekt des korrupten und von der Insolvenz bedrohten Mühlenbesitzers Sebastiano, der sie an den ahnungslosen Hirten Pedro, einen Alpen-Parsifal, verkuppelt, um dem Gerede im Dorf Einhalt zu gebieten, sich selbst eine reiche und ihn geschäftlich sanierende Heirat zu ermöglichen, Marta aber auch weiterhin mißbrauchen zu können. Rettung durch den Tod In beiden Opern verstärkt die Abgeschiedenheit des Schauplatzes die Zwangslage der Frau. Im „Tiefland" kommt die ökonomische Abhängigkeit sämtlicher Bewohner vom einzigen Arbeitgeber der Gegend hinzu: Falls die diktierte Liaison von Marta und Pedro und Sebastianos reiche Heirat nicht funktionieren, werden alle arbeitslos. Deshalb unterstützen sämtliche Angestellte des Unternehmens die Pläne des Müllers und stellen sich damit gegen Marta, die so zur Außenseiterin ohne Aussicht auf Erlösung wird – wie Katja. Beide Frauen glauben, ihrer Situation nur durch ihren Tod entkommen zu können: Katja ertränkt sich in der Wolga, Marta entgeht einem solchen Schicksal erst im letzten Moment, als Pedro aus Liebe zu ihr den wölfischen Nebenbuhler erwürgt wie einst den Wolf oben auf der Alm, ehe er mit seiner Frau in dieses vermeintlich sündenlose Rückzugsgebiet flieht. Geschlechterverquerungen Bis dahin aber haben Marta und Pedroeinen Weg auf Leben und Tod zurückzulegen. Der Hirte ist eine archaische, unzivilisierte Figur, die Sex nur aus Tierbeobachtungen kennt. Gleichwohl sehnt sich Pedro nach einer Frau, die er in einem halb religiösen, halb erotischen Traum als Mischung aus Naturerscheinung und Gottesmutter erschaut hat. Pedro und Marta treffen „mit verqueren Erfahrungen mit dem jeweils anderen Geschlecht aufeinander", wie Weber die Ausgangslage benennt. Sie streiten sich verzweifelt aufeinander zu und lernen so schmerzlich die Liebe kennen, die endlich beiden aus der Verstrickung hilft. In das angestrebte „genaue psychische Profil der Figuren" und „die Frage nach deren Wahrheit und Motivation" bezieht Weber auch die Nebenfiguren ein: den Hirten Nando, der das Tiefland-Dorf und dessen Frauen kennt und aus dieser Erfahrung Pedros Sehnsucht ironisiert, die kindlich gebliebene Magd Nuri, „die warmherzige Unschuld, die diese Welt nur aushält, weil sie nicht merkt, was sie mit ihr treibt und wie sie sie schuldig werden läßt", den weisen Dorfältesten Tommaso, der die schier ausweglosen Konflikte „der Katharsis zuführt", die boshaften Mägde Pepa, Antonia und Rosalia, die „das Unheil hinterhältig wie Shakespeares Macbeth-Hexen kommentieren und schüren und so zu Sinnbildern für die Tiefland-Häme werden". Sie, findet Weber, „drehen Schicksalsschnüre aus Menschenleid und nutzen Nuris Treuherzigkeit sadistisch aus". Sehnsuchtswelten Hermann Feuchters Bühnenbilder übersetzen diese psychologische Perspektive ins Optische. So weitet sich das naturbildhafte Vorspiel mit dem Klarinettisten auf der Vorderbühne zu einem kosmischen Satelliten-Blick auf die Pyrenäen: „Das Weltall als große Scheibe zu den Sehnsuchtsklängen der Musik", erläutert Weber. Dann verengt sich der Horizont zu einem Gebirgszug, schließlich zu einer Fabrikhalle mit einem Mühlrad als Zentrum und einem Gebirgsausblick als Sehnsuchtsort. Die dunkle, nicht mehr richtig funktionierende Industriewelt als Ort von Enge und Ausweglosigkeit, Macht und Intrige läßt durch Fenster gleichwohl den Lichtverlauf der anderthalb Tage vom Sonnenaufgang bis zum Mittag des nächsten Tages ein, als tröstlicher Eingriff des Hochlands, in dem „Olaf Winter mit Licht Atmosphäre malt", wie Weber dies schildert. So bleiben die Weite des anfänglichen Weltraumblicks und die Unendlichkeit der Natur im wechselnden Lichteinfall von außen gegenwärtig. Webers Ziel, „eine Oper von hoher Stringenz als große Frauengeschichte psychologisch und dramatisch möglichst genau klarzulegen", soll so auch optisch anschaulich werden. | |
|
Unverdorbener Bergmensch kämpft gegen Fabrikbesitzer Von Birgit Popp Eugen d’Albert, 1864 als Sohn einer Engländerin und eines deutschen Ballettkomponisten mit italienischer Herkunft (Alberti) in Glasgow geboren und 1932 in Riga gestorben, war einer der schillerndsten Musikerpersönlichkeiten seiner Zeit. Seine Karriere als umjubelter Starpianist führte d’Albert in viele Länder, er fühlte sich jedoch zeitlebens als Deutscher und schrieb seine Opern ausschließlich auf deutsche Texte. Obwohl d’Albert, der sechs Mal verheiratet war, bis kurz vor seinem Lebensende öffentlich als Pianist auftrat, widmete er sich seit 1893 vermehrt der Komposition von Opern mit verschiedenen Thematiken und Stilrichtungen. In „Tiefland" verband der kompositorische Autodidakt die Wagnersche Leitmotiv-Technik mit den Elementen des italienischen Verismo. Er schuf mit der 1903 in Prag uraufgeführten Oper eines der wenigen Werke des deutschen Naturalismus. Dem Libretto von Rudolf Lothar diente das naturalistische Drama „Terra baixa" (Tiefes Land) des Katalanen Angel Guimerà von 1896 als Vorlage. Es stellt die – nach Meinung des Autors – unverdorbenen, der Zivilisation fernen Menschen der Bergwelt in Kontrast zu den intriganten, schlechten Menschen des Tieflands. Die szenische Umsetzung der Oper obliegt Anselm Weber, der 2004 bereits „Katja Kabanová" in Frankfurt inszenierte. Eine Neuproduktion von „Tiefland" ist für den Essener Schauspiel-Intendanten und früheren Oberspielleiter des Frankfurter Schauspiels auch ein Abschied von Aufführungspraktiken vor 1945: „Die Oper ,Tiefland‘ war von den Nazis vereinnahmt worden, galt als Lieblingsoper des Führers, doch im eigentlichen Text sind keine entsprechenden Bezüge zu finden. Der Naturbursche hat jedoch gut in ihr Konzept gepasst, hingegen wurde die Religiosität von den Nazis ganz herausgelassen. Wir haben in unserer Inszenierung die Oper vom Pathos des Films von Leni Riefenstahl befreit", so Anselm Weber. Der gebürtige Münchner sieht in dieser Oper vielmehr einen konkreten Bezug zur Gegenwart: „Sebastiano ist für mich ein moderner Unternehmer in der heutigen Zeit, der über seine Verhältnisse gelebt hat. Ein Lebemann und Frauenheld mit Strahlkraft, der versucht, als er merkt, dass er pleite ist, seine Firma mit einer Geldheirat zu retten. Seine Belegschaft kämpft um den Job in einer ländlichen Gegend, wo es nicht viele Arbeitgeber gibt. Es ist eine Art von moderner Abhängigkeit und Leibeigenschaft. Um seinen Angestellten und Arbeitern weiterhin die Arbeit zu ermöglichen und gleichzeitig seine Geliebte nicht zu verlieren, fingiert Sebastiano eine Zwangsheirat, nach der Marta ihm auch später noch willig sein soll." „Jetzt geht dieser Fabrikbesitzer in die Berge, um einen Bergtölpel zu holen, den er mit Marta verheiratet und dem er die Mühle beziehungsweise Fabrik übergibt", so Weber weiter. „Dieser junge Mann, Pedro, besitzt eine Art Vision. Er wünscht sich eine Frau. Ich komme ursprünglich aus Bayern, und mir sind Menschen, die außerhalb der Zivilisation leben, nicht unbekannt. Dieser Mann kommt in eine Umgebung, die er nicht kennt. Diese Figur besitzt etwas Parzivaleskes. Er gerät an die vorderste Front von Intrige, Neid, Missgunst und körperlicher Gewalt." Anselm Weber sieht die Figuren vor allem in Grautönen: „Für mich ist Sebastiano nicht nur ein ,böser‘ Mensch, sondern ich sehe auch seine Abhängigkeit. Er liebt Marta wirklich, und seine emotionale Abhängigkeit ist letztlich sein Todesurteil, denn er verliert seine Souveränität." Auch Pedro ist für ihn nicht nur gut: „Für mich ist er keine Lichtfigur. Er ist wild, nicht zivilisiert und in seinem zwischenmenschlichen Verhalten deutlich degeneriert. Wenn er gereizt wird, tötet er auch. In Anselms Inszenierung wird die Partie der Marta von der Mezzosopranistin Michaela Schuster gegeben, zuletzt in Frankfurt als Caesonia in „Caligula" zu hören. Ebenfalls nach Frankfurt zurückkehren werden John Treleaven als Pedro und Lucio Gallo als Sebastiano. Die musikalische Leitung obliegt dem zukünftigen Frankfurter GMD Sebastian Weigle. | |
|
Auch die Schauspielerei gehört zur hohen Kunst Seine helle Stimme und sein Lächeln nehmen auf Anhieb für ihn ein. Und selbst im von Künstlern verwöhnten Fundus, Restaurant im Schauspiel Frankfurt, zieht Sebastian Weigle die Aufmerksamkeit auf sich. Diese Art Ausstrahlung gehört zu seinem Job, muss er doch zumeist ein Heer von Musikern suggestiv auf Ton und Takt einschwören. Und natürlich redet ein guter Dirigent auch immer mit den Händen. Der Generalmusikdirektor (GMD) am Gran Teatre del Liceu in Barcelona wird die Neuinszenierung von Eugen d’Alberts (1864-1932) "Tiefland" dirigieren. Regie führt in diesem Musikdrama Anselm Weber, ebenfalls kein Unbekannter in Frankfurt. Die Rolle der Marta singt Michaela Schuster, als Kundry (Parsifal) schon am Main erfolgreich, ein weiterer Protagonist ist der Heldentenor John Treleaven, in Frankfurt als Brittens Peter Grimes wohlgelitten. Die Premiere beginnt am Sonntag um 18 Uhr im Opernhaus. D’Alberts Drama um den Hirten Pedro, der unwissend die Geliebte seines Großgrundbesitzers auf dessen Wunsch heiratet, was in einem tödlichen Zweikampf endet, war früher ein Opern-Renner, wird heute freilich nur noch selten gespielt. Sebastian Weigle kennt die dem Verismo (von vero, wahr) zugehörige Oper noch aus seiner Zeit als Hornist an der Berliner Staatsoper vor 20 Jahren - und hat sich "aus dem Bauch heraus" für das Werk entschieden. Aufgrund von Landschaftsbeschreibungen und Naturstimmungen, die d’Alberts Musik ebenso auszeichne wie ihre spanischen folkloristischen Wendungen bis hin zum Bolero. Liegt doch der Opern-Tatort, "Tiefland", am Rande der Pyrenäen unweit von Barcelona, "eine schroffe, sehr ehrliche Natur", weiß Weigle, ideale Kulisse für einen Tanz auf dem (Gefühls-)Vulkan. Außerdem rieche es in der Partitur nach Wagner, sagt der Spezialist des "Deutschen Repertoires", "Tristan" und "Walküre" seien nahe, aber auch Puccinis "Tosca" und Bizets "Carmen". An Regisseur Anselm Weber schätzt der Dirigent dessen Werktreue. Ganz ohne Psychologie ginge es zwar auch bei diesem hochdramatischen Konflikt zwischen Ausbeutern und ihren Opfern in dörflicher Gemeinschaft nicht, doch Weber setze auf natürliche, direkt ansprechende Bilder. Zwischen Wunschtraum und heftigem emotionalen Ausbruch sei d’Alberts Drama ein romantisches - in einer heute kitschig wirkenden Sprache. Der entgegenzuwirken, bedürfe es einer starken, realistischen Szene, wobei Weber sogar d’Alberts Regieanweisungen in Partitur und Textbuch genau umsetze - und nicht etwa konterkariere, wie das im heutigen Regietheater üblich ist. Über dessen Grenzen hat der gebürtige Berliner Weigle klare Vorstellungen: "Wenn ein Regisseur in Text und Musik eingreift, diese etwa noch durch Eigenes ergänzt und das Ganze beim ursprünglichen Operntitel belässt, dann reise ich ab." Regie und Musik müssten von Anbeginn zusammenarbeiten. Deshalb sei er immer bei der ersten Probe schon mit von der Partie - und nicht erst nach drei Wochen. Nur so könne man verhindern, dass Regisseure ihre eigene neurotische Welt auf die Bühne stellten. Bei Anselm Weber, seit 2004 Intendant am Schauspiel Essen, sei dies überhaupt kein Problem. Hatte er doch schon vorab ein dickes Regiebuch geschrieben, in dem jede Szene präzise vorgegeben ist. Da bedarf es dann nur noch der Feinabstimmung - wie etwa der Blickkontakt des Sängers zum Dirigenten. Mit diesen Prinzipien hat es Weigle weit gebracht, der eine schnelle Auffassungsgabe, ein sehr gutes Gedächtnis und auch das gewisse Schauspielertum als Voraussetzungen für einen Dirigenten hält. Als Hornist im Orchestergraben habe er sie alle studieren können - und besonders Daniel Barenboim geschätzt, der ihn zu seinem Assistenten machte und schon früh auch bei Vorstellungen ans Pult beorderte. Nur wenn der Maestro "Elektra" (Richard Strauss) dirigierte, befahl er Weigle zum Hornsolo ins Orchester zurück. Das Hornspiel mit seinem dauerhaften Transponieren erleichtert zudem den Blick aufs Ganze, auf die Partitur. Die liest Weigle am liebsten entspannt im Sessel bei einem Glas Wein, lernt die Gesangsstimmen und gewichtet danach den Orchesterklang. Apropos Wein, hier liebt der Chefdirigent den spanischen Roten aus Rioja oder Navarra, schätzt an Katalonien zudem die Kultur der Tapas, jener frischen kleinen schmackhaften Gerichte. Und natürlich Barcelona und dessen Gran Teatre del Liceu, an dem er fünf bis sechs Monate im Jahr wirkt. "Das schönste Opernhaus der Welt", schwärmt Weigle, der in Spanien schon zweimal als Dirigent des Jahres ausgezeichnet wurde. Hier werde Stagione (Neuinszenierungen in längeren Serien) gespielt, was die Verpflichtung vieler Weltstars wie Koproduktionen ermögliche. Allein 14 verschiedene Abonnements sorgten dafür, dass die 2 200 Sitzplätze allabendlich besetzt seien. Und für einen Dirigenten optimal: Von der ersten Probe bis zur letzten Vorstellung arbeite man mit den selben Orchestermusikern. Das gelänge bestenfalls an der Frankfurter Oper, an die Weigle ebenfalls nur gute Erinnerungen hat. Mit "Frau ohne Schatten" (Richard Strauss) wurde er 2003 von Kritikern zum "Dirigenten des Jahres" gewählt. Und 2008 tritt er in Frankfurt als GMD an. Viele Hornquinten werde es dann geben, aber auch kleine Sekunden, große Septimen und süße Terzen. Kurzum die gute Mischung aus traditionellem Repertoire, modernen Auftragswerken und spannenden "Ausgrabungen", wie sie das Markenzeichen von Intendant Bernd Loebe ist. Doch zuvor bringt er im August nächsten Jahres in Bayreuth mit Wagner-Urenkelin Katharina als Regisseurin die "Meistersinger" heraus, die Weigle bereits in Mannheim, Wien und Berlin dirigierte. "Natürlich ist es eine Ehre, für Bayreuth verpflichtet zu werden. Auf der anderen Seite ist das ein ganz normales Opernhaus für den Sommer", wiegelt der Maestro ab. Von der sicher schon fertigen Regie-Konzeption verrät er indes nichts. Vielleicht fallen ja die "Meistersinger" im betulichen Bayreuth tatsächlich mal in einen Jungbrunnen … KLAUS ACKERMANN | |
|
Frankfurts designierter GMD Sebastian Weigle
Sebastian Weigle, Jahrgang 1961, studierte an der Berliner Hochschule für Musik Hanns Eisler Horn, Klavier und Dirigieren. Von 1982 an arbeitete er 15 Jahre lang als Solo-Hornist der Staatskapelle Berlin, bis er sich doch für eine Laufbahn als Dirigent entschied. (FR) |
|
|
Frankfurter Rundschau : Herr Weigle, fühlen Sie sich denn hier in Frankfurt schon ein bisschen zu Hause?Sebastian Weigle: Zu Hause kann ich nicht sagen, aber ich fühle mich wohl. Nicht einmal in Berlin, wo ich ja eigentlich wohne, fühle ich mich wirklich zu Hause. Wahrscheinlich bin ich zu viel unterwegs. Über das Jahr gesehen bin ich vielleicht eineinhalb Monate dort. Und dann brauche ich auch da immer wieder zwei, drei Tage, bis ich weiß, wo der Tee steht und ob der Lichtschalter im Bad jetzt links oder rechts von der Tür ist. Haben Sie in Frankfurt schon mal nach einer Wohnung geschaut? Ehrlich gesagt: nein. Aber ich wollte jetzt zumindest mal nach Wohngegenden Ausschau halten, denn eigentlich würde ich gerne schon im nächsten Jahr nach Frankfurt ziehen. Wieso das? Um mich zu akklimatisieren. Um mich vielleicht auch zu Hause zu fühlen. Ich mag es nicht, eine Stelle neu zu beziehen, sich in Strukturen einzuarbeiten und daneben auch noch völlig fremd in einer Stadt zu sein. Sie dirigieren ja nicht zum ersten Mal hier an der Oper Frankfurt. Werden Sie jetzt eigentlich anders wahrgenommen, anders angesprochen, seitdem alle wissen, dass Sie hier bald der neue Chef sind? Schwer zu sagen. Manchmal habe ich so ein Gefühl, aber das kann natürlich auch falsch sein. Ohnehin darf es meine Arbeit nicht beeinflussen. Ich versuche mich genauso so zu verhalten wie immer. Sind Sie ein Cheftyp? Nee, glaube ich nicht. Mir geht es um die Sache. Wenn deshalb manchmal ein herberer Ton gefordert ist, dann wird er auch zu hören sein. Aber dabei geht es nicht darum, dass ich gerne den Chef raushängen lasse. Ich habe eine Vorstellung vom Klang einer Oper und bin als Dirigent verpflichtet, die so gut wie möglich umzusetzen. In Frankfurt haben Sie die Premieren der "Frau ohne Schatten" und "Pique Dame" dirigiert. Nun steht Eugen d'Alberts "Tiefland" auf dem Programm. Das sind alles nicht gerade Kernstücke des Repertoires. Zufall? Oder Methode? Weder noch. Das hat mit Angebot und Nachfrage zu tun, natürlich auch mit meinen persönlichen Wünschen und Vorlieben. Aber ich meide nicht das so genannte Standardrepertoire. Wie schwierig ist es, seine eigenen Wunschstücke auch tatsächlich zu dirigieren? Das hängt ganz davon, was Sie sich wünschen. Wollen Sie als Dirigent unbedingt die Zauberflöte machen, dürfte das kein Problem sein. Bei Tiefland aber war das schon sehr viel schwieriger. Seit zehn Jahren will ich das Stück dirigieren. Aber nie wollte es ein Intendant, manchmal gab es auch schlicht keine Sänger dafür. Erst jetzt klappt es. Seit zehn Jahren schon? Was fasziniert Sie so an "Tiefland"? Es ist ein großes Werk. Hochdramatisch für Bass, Sopran und Tenor. Ich habe es selbst gespielt, als ich noch Orchestermusiker an der Staatsoper Berlin war, und war vom ersten Takt an begeistert. Ich habe meine Dienstpläne immer so gelegt, dass ich keine Aufführung verpasse. Die Musik bringt mich schlicht zum Fliegen. Sie geraten ja richtig ins Schwärmen… Und ich bin noch nicht fertig. Mal friere ich, mal glühe ich. Die Musik ist unmittelbar. Ich kann mich ihr nicht entziehen. Es gibt aber auch die Meinung, die Oper sei schlicht kitschig. Da bin nun ich gefordert. Man muss den Kitsch draußen lassen. Sonst wird es wahnsinnig schnell einfach nur süßlich. Und das ist die Musik gerade nicht. Sie ist eine dramatische, eine hochdramatische Angelegenheit. Ist die immanente Kitschgefahr Schuld daran, dass "Tiefland", was ja einst eine immens erfolgreiche Oper war, so in Vergessenheit geriet? Ich glaube schon. Und gegen den Kitsch muss man ja nicht nur dirigieren, sondern auch inszenieren. Wenn man all das so macht, wie es in der Partitur steht, wenn man alle Regiewünsche d'Alberts erfüllt, wenn man all die hübschen Zicklein auf die grünen Bergwiesen stellt, na dann: gute Nacht. Worauf müssen Sie als Dirigent achten, damit d'Alberts Musik nicht kitschig klingt? Interview: Tim Gorbauch [ document info ] |
Interview Sebastian Weigle, Jahrgang 1961, studierte an der Berliner Hochschule für Musik "Hanns Eisler" Horn, Klavier und Dirigieren. Von 1982 an arbeitete er 15 Jahre lang als Solo-Hornist der Staatskapelle Berlin, bis er sich doch für eine Laufbahn als Dirigent entschied. Rasch machte er sich dabei einen Namen, wurde zunächst 1. Kapellmeister der Staatsoper Berlin, dann Chefdirigent der Oper Barcelona. Ab der Spielzeit 2008/2009 wird Weigle Nachfolger Paolo Carignanis als Generalmusikdirektor der Stadt Frankfurt. Im nächsten Jahr debütiert er als Dirigent der Meistersinger in Bayreuth. Eugen d'Alberts "Tiefland", dirigiert von Weigle, inszeniert von Anselm Weber, hat am Sonntag, 10. Dezember, 18 Uhr, in der Oper Frankfurt Premiere. |

 Das Libretto von "Tiefland" geht zurück auf das Schauspiel Terra baixa (1806) des Spaniers Angel Guimerà (1849-1924). Das deutsche Libretto schrieb Rudolf Lothar. Die Umarbeitung der 1903 in Prag uraufgeführten Fassung wurde erstmals 1905 in Magdeburg gezeigt. Diese Fassung liegt auch der Frankfurter Produktion zugrunde. "Tiefland" ist die dramatische Liebesgeschichte zwischen einem Hirten und einer Magd.
Das Libretto von "Tiefland" geht zurück auf das Schauspiel Terra baixa (1806) des Spaniers Angel Guimerà (1849-1924). Das deutsche Libretto schrieb Rudolf Lothar. Die Umarbeitung der 1903 in Prag uraufgeführten Fassung wurde erstmals 1905 in Magdeburg gezeigt. Diese Fassung liegt auch der Frankfurter Produktion zugrunde. "Tiefland" ist die dramatische Liebesgeschichte zwischen einem Hirten und einer Magd.  Auch dem Dirigenten Sebastian Weigle, designierter Generalmusikdirektor der Oper Frankfurt, ist es wichtig, die Oper „Tiefland“ wieder zu entdecken; endlich zu zeigen, was in ihr steckt, jenseits des Nazi-Images. Und das Werk braucht extrem gute Sänger mit einer großen Palette an Ausdrucksmöglichkeiten.
Auch dem Dirigenten Sebastian Weigle, designierter Generalmusikdirektor der Oper Frankfurt, ist es wichtig, die Oper „Tiefland“ wieder zu entdecken; endlich zu zeigen, was in ihr steckt, jenseits des Nazi-Images. Und das Werk braucht extrem gute Sänger mit einer großen Palette an Ausdrucksmöglichkeiten.