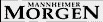|
Musiktheater Von unserem Redaktionsmitglied Stefan M. DettlingerFünfzehn Minuten sind eine lange Zeit. Fünfzehn Minuten rauschender Beifall, gesprenkelt von heftigen Buh- und Bravorufen, sind eine halbe Ewigkeit. Und ungeheuerlich endlos scheint es, wenn all dies der Aufführung einer so genannten "Mannheimer Hofoper" gilt, also einem Werk, das zu Kurfürst Carl Theodors Zeiten in Mannheim uraufgeführt wurde (erinnert sei nur an den trostlosen "Catone in Utica" vom vergangenen Jahr). Diesmal war "Alessandro" dran - eine unbekannte Seria-Oper. Von Gian Francesco de Majo - einem unbekannten Komponisten. Der Regisseur dieses Abends indes ist kein Unbekannter, und das ist gut so. Denn der schalkhafte Günter Krämer hat mit diesem Werk einfach Theater gemacht, ein ziemlich verrücktes und gutes sogar, ganz nach dem Motto: Wenn wir uns schon mit der Mannheimer Hofoper herumplagen müssen, dann soll es wenigstens Spaß machen. Es hat Spaß gemacht. Weitgehend. Jeder Mensch ist ein Inder Alles fängt damit an, dass wir zu Indern gemacht werden. Zahllose - echte und scheinbare - Inderinnen tragen zu den Tabla- und Sithar-Klängen (Yogendra, Ramesh Shotham) ihre freien Bäuche durch die Besucherreihen und versehen die Zuschauer mit einem roten Bindi auf der Stirn. Die Ästhetik ist unmissverständlich. Bombay und Bollywood lassen grüßen, schließlich geht es in dieser Fragment-Oper auch um Alexanders des Großen Indienfeldzug gegen Porus. Intrigen, Mordversuche, Liebschaften und Eifersüchteleien stehen im Zentrum der Handlung, und wenn man dem Abend eines vorwerfen will, dann, dass Musik und Handlung weitgehend hinter das Ornament und die Farbe zurücktreten. Wie überhaupt der Seria-Charakter verloren geht. Fast minütlich gäbe es etwas zu lachen, die Tragik und Dramatik gehört nicht dem Werk, sondern der Oper als Kunstform. Sie nämlich denkt in diesen farbenfrohen Verkleidungen (Falk Bauer), in den indischen Klischee-Dekors (Jürgen Bäckmann)und zirkushaften Zoten, in diesem buntscheckigen Blödelkosmos über sich selbst nach. Hinter der frohlockenden Fassade des Witzes lauern eigentlich Fragen wie diese: Was will die Oper im Zeitalter des medialen Unernstes? Inwieweit sind wir in unserer Quatschgesellschaft überhaupt noch zu authentischen Gefühlen in der Lage? Die ironische Antwort gibt immer wieder die Schauspielerin Traute Hoess ("Sonnenallee"), unter anderem ein Double von Cornelia Ptassek als Cleofide, indem sie Texte der Sindelfinger Autorin Friederike Roth rezitiert: "Ich liebe die Oper", heißt es dort oftmals über das Musiktheater, in dem "der Billigramschkelch für zweifuffzich" zum Heiligen Gral werde. Im Grunde ist diese Affirmation wie ein Trojanisches Pferd: Aus ihrem Bauch heraus kullern Spott und Hohn für die lächerliche Kunstform. Im optische Rausch Und "Alessandro"? Der wird in diesem optischen Rausch halt auch gespielt, eher beiläufig zwar, aber das scheint - nach einmaligem Hören - nicht allzu tragisch. Die Rezitativ-Musik ist ohnehin verschollen. Die Texte werden von Schauspielern gesprochen. Und die Arien sind zwar hübsch, aber in nur wenigen Ausnahmen mehr als das, etwa wenn Marie-Belle Sandis uns als Porus mit dem kriegerischen Allegro "Destrier, che all'armi usato" samt marschierendem Inderinnen-Chor (unser großes Bild) glasklare Koloraturen schenkt - einer der starken vokalen und musikalischen Momente. Auch Cornelia Ptassek als Cleofide lässt natürlich aufhorchen. In ihrer Treue-Arie "Digli ch'io son fedele ..." gibt sie einmal mehr eine Kostprobe ihrer sehr charakteristischen Phrasierungstechnik, mit der sie die Töne elastisch legatissimo aneinanderreiht, als fielen Tropfen reinen Parfums ins heilignüchterne Wasser. Iris Kupkes Erissena beeindruckt ebenfalls, mit einer bestens intonierten Sprechstimme genauso wie durch ihren Gesang, etwa in der Koloratur-Arie "Di rendermi la calma prometti", die sie leicht und intonationssicher mit heller Trauer versieht. In dieser Phase des Abends legen alle Sängerinnen ihre indischen Klamotten ab und stehen im schwarzen Trägerkleid nebeneinander (kleines Bild links), auch Katharina Göres, die als Erissenas Geliebter Gandartes mit der elegant gesungenen Es-Dur-Arie "Mio ben, riccordati" überzeugen kann. Etwas unglücklich ist nur der Alexander besetzt. Lars Møller agiert überzeugend, bleibt stimmlich aber etwas blass, was von seinem Schauspieler-Double Daniel Schüßler mit aggressivem Sado-Maso-Gebaren aufgefangen wird. Das Nationaltheater-Orchester spielt - erst in hellen Dinner-Jackets, dann in T-Shirts - auf der Bühne und wird von Tito Ceccherini geleitet. Der Klang ist solide, so etwas wie der Fels in der verrückt-genialischen Brandung dieses tollkühnen Abenteuers. Oper? Offenbar! |
|
Mannheim: Barocke Oper über den großen Alexander Von Wibke Gerking Frisch wie ein Sommerregen prasselte die alte Musik auf die Zuhörer herab - die 242 Jahre im Archiv merkt man Gian Francesco de Majos hübscher Oper nicht an. Das Mannheimer Nationaltheater, zu Recht stolz auf seine große Geschichte, hat diesen "Alessandro" ausgegraben, der 1766 zu einem kurfürstlichen Namenstag aufgeführt wurde. Die Wiederaufführung zeigte: Bei Kurfürsts wussten man sich niveauvoll zu amüsieren. Ob man nun gleich Mozartsche Anklänge in der Musik erahnen will, darüber kann man streiten - aber an Gluck konnte man sich auf jeden Fall erinnert fühlen: durch die innigen Melodien, die sich so geschmeidig in die Form einfügen; die Direktheit im Ausdruck, oft erzielt durch eine ausgefeilte Dynamik; und den Willen, die Form bis an ihre Grenzen aufzubrechen, um einen dramatischen Vorgang besser wirken zu lassen. Weniger originell ist die Instrumentierung: Fast die ganze Oper liegt auf dem Rücken der Streicher, das bot den Mannheimer Geigern Gelegenheit zu zeigen, was sie können. Unter Tito Ceccherini Leitung spielten sie dynamisch sehr genau und deutlich phrasiert. Sehr gut auch die Sänger. Das einzige, was störte, war die unausgegorene Inszenierung. Günter Krämer hat sich vom Kampf Alexanders des Großen (Lars Moller) gegen den indischen König Poro (Marie-Belle Sandis) samt der zwischen beiden Männern stehenden Cleofide (Cornelia Ptassek) zu einem Bollywood-Spektakel verleiten lassen. Gar nicht uninteressant war die Idee, die verloren gegangenen Rezitative durch Sprache mit dezent unterlegter indischer Musik zu ersetzen. Doch ansonsten begnügte sich Krämer damit, alles mit einem bunten Gewusel aus Saris, Bimmelglöckchen und Glitzervorhängen zu überdecken. Junge Mädchen tanzen durch die Reihen und drücken den Zuschauern rote Flecke auf die Stirn. Dazu eine Rahmenhandlung, in der Mannheims Kurfürstenpaar banale Texte von Friederike Roth aufsagt: zu viel, zu bunt, zu lärmig - das störte manchmal empfindlich die Musik. Vor allem liegt schon die Grundidee der Inszenierung schief: Es mag eine Parallele geben zwischen Bollywood und Oper, denn beide sind exotische Scheinwelten. Doch Bollywood ist Unterhaltung von und für Inder. Alessandro ist europäische Unterhaltung, die europäische Klischees über Indien enthält. Indem Krämer mit europäischem Blick Bilder von Bollywood vereinnahmt, fügt er neue Klischees hinzu, was dem Spektakel einen unangenehmen Beigeschmack verleiht. Insgesamt blieb der Eindruck einer Inszenierung von Leuten, die Oper langweilig finden, für ein Publikum, das nach Regie-Gags geiert. |
|
Bollywood mit Gesang Sigrid Feeser MANNHEIM. Die Oper spielt in Indien. Im Opernbetrieb des 18. Jahrhunderts ist das nicht mehr als exotisches Kolorit, Folie für die üblichen Liebeshändel, Eifersüchteleien, Missverständnisse, Kriegsgeschrei und operntypischen Unwahrscheinlichkeiten. Alles eben mal locker aufgehängt an einer Persönlichkeit, deren historische Realität aber nicht zur Debatte steht. So auch in Gian Francesco de Majos „Alessandro nell’ Indie", 1766 in der Mannheimer Hofoper uraufgeführt zur Feier des Namenstages des Kurfürsten Carl Theodor. Es war nach der „Iphigenie" zwei Jahre zuvor die zweite Mannheimer Scrittura des gerade schwer angesagten Neapolitaners. Dessen Karriere währte nicht lange, de Majo starb bereits 1770 im Alter von nur 38 Jahren, „entkräftet", wie es heißt. Das war ein immenser Verlust für die musikalische Welt. Unüberhörbar weht die Luft der Opernreform durch die Partitur – nicht zu Unrecht fühlt man sich manchmal an den jungen Mozart erinnert. Also eine wichtige Ausgrabung am Mannheimer Nationaltheater, ansprechend dirigiert von Tito Ceccherini, legitimiert durch beachtliche Sängerleistungen, allen voran und pars pro toto Marie-Belle Sandis (als Inderkönig Poro) und Cornelia Ptassek (seine Geliebte Cleofide). Zumindest musikalisch wird im Mannheimer Opernhaus der Beweis angetreten, dass diese 242 Jahre alte Oper nicht in den Archiven dahinmodern muss. Und die Regie von Günter Krämer? Ein Stuss. Mannheim verdankt ihm einen vorzüglichen „Lucio Silla". Diesmal freilich bedient er nichts als die unteren Schubladen eines längst abgewrackten Regietheaters. Das Ganze läuft als „indisch" eingekleidete Bollywood-Schmonzette, und dies auf Hochtouren. Immer bloß dahinwitzelnde Action, immer bloß Knalleffekt auf Knalleffekt. Da weder Ouvertüre noch Rezitative überliefert sind, lässt Krämer die Texte der deutschen Übersetzung einschließlich der orthographischen Absonderlichkeiten von ständig sich einmischenden Schauspielern sprechen und von traditionellen indischen Instrumenten begleiten. Das Stück wird zur Gag-Maschine, ist der Lächerlichkeit preisgegeben. Und das hat „Alessandro" nicht verdient. |
|
Bollywood in Klammern VON STEFAN SCHICKHAUS Man nannte ihn Ciccio, Dickerchen. Der neapolitanische Komponist Gian Francesco de Majo hatte es schwer, trotz bester Kontakte. In Neapel ist die Konkurrenz mächtig, im feuchten Ausland die Gesundheit sein Feind. Er stirbt 1770 mit 38 Jahren an Tuberkulose - einige Monate zuvor hatte der 14-jährige Mozart seiner Musik ein "bellissima" attestiert. Das Nationaltheater Mannheim hat sich dieser Musik erinnert, denn in den 1760ern hatte de Majo zwei Opern für den Kurfürsten komponiert. Huldigungsopern natürlich, und als eine solche wurde der 1766 uraufgeführte "Alessandro" jetzt inszeniert von Günter Krämer, der den in Klammern gesetzten Ortszusatz mit Genuss betonte. "Alessandro (nell'Indie)": Eine schrille Revue, die das Publikum zu heftigen, meist frenetisch positiven Reaktionen animierte. Die Huldigung dachte sich Krämer so: Die Frau des Kurfürsten veranstaltet für ihren Gatten ein Fest zum Modethema Bollywood. Im Rahmen des Festes spielen die Protagonisten die "Alessandro"- Oper, das Orchester sitzt als Showband auf der Glitzerbühne (und spielt unter Tito Ceccherini tadellos). Stets in der Mitte: Ramesh Shotham, Tablas, und Yogendra, Sitar. Gegen Ende wird Rio Reisers "Bye-bye Junimond" gesungen, begleitet von indischen Instrumenten und Hammerklavier. Es gibt viel Grund zur Freude an diesem Abend: Über den Indien-Kitsch, über Krämers Klischee-Krieger Alexander, über Demontagen von Koloraturarien, über jenen prächtigen deutschen Text, der für den Regisseur überhaupt der Grund war, "weshalb ich die Regie übernommen habe: diese alberne Poesie". De Majos Oper aber verschwindet. Ob das schlimm ist, sei dahingestellt. Nur bei wenigen Nummern dieser ohne Rezitative überlieferten Hofoper zog Krämer sich zurück, meist gab seine Regie der Musik Kontra. Jede filigrane, edle Arie muss verwelken, wenn parallel dazu eine Darstellerin sich ein Fußbad einlässt, weil sie beim Ausdruckstanz in einen Dorn getreten ist, die Koloratur der Sängerin geht über in ein Heulen. Gesungen wird stark, auch wenn der Bass Lars Mollers (Alexander) nicht gut zentriert sitzt. Ihm überlegen zeigen sich Cornelia Ptassek als Cleofide und Marie-Belle Sandis als Porus, die mit enormer physischer Kondition gen Alexander marschierte. Die Protagonisten waren gedoppelt und getripelt durch Schauspieler und Tänzer, was für helle Bühnenaufregung sorgte. Zu viel für Puristen. Nicht zu viel aber für eine Oper wie "Alessandro", in Klammern: In Indien. [ document info ] Dokument erstellt am 08.06.2008 um 16:32:01 Uhr Letzte Änderung am 09.06.2008 um 12:37:48 Uhr Erscheinungsdatum 09.06.2008 |
|
Francesco di Majos "Alessandro" in Mannheim Von Gabriele Weingartner MANNHEIM Es ist nun schon das dritte Mal, dass das Nationaltheater Mannheim in seinem Hofopernrepertoire kramt und auch fündig wird: Nach Tommaso Traettas "Sofonisba" und Niccolo Piccinis "Catone in Utica" wandte man sich Gian Francesco di Majos "Alessandro" zu. Günter Krämer inszenierte das nicht mehr vollständig überlieferte Werk zur Feier des Namenstags von Kurfürst Carl Theodor konsequent gegen den heroisch-historischen Strich. Heraus kam eine Art Bollywood-Oper, zu deren strahlender Intensität vor allem Tito Ceccherini und das direkt auf der Bühne und in Alltagskluft musizierende Orchester beitrugen. "Alexander in Indien" heißt eigentlich das Libretto von Pietro Metastasio, dessen sehr fremd und fern und wohl auch deshalb so lustig klingender Text in der Aufführung eine große Rolle spielte. Denn da die Rezitative verloren gegangen waren, griff man umso beherzter auf das Wort zurück und dazu noch auf Schauspieler und Schauspielerinnen, die ihre singenden Kollegen doubelten. Was zuerst das Verständnis zu behindern schien, bestätigte sich im Verlauf des Abends als gute, wenn auch vertrackte Idee: Führte doch Majos Musik, seine geradezu traumselig die Wiener Klassik vorbereitenden Arien und Märsche die Hohlheit der deklamierten Phrasen wunderbar ad absurdum, zumal die Darsteller stets in wahrer Seelennähe zu den Sängern agierten und nicht selten durch pantomimische Einlagen deren "mentalen Zustand" facettenreich kommentierten. Sprich: De schräge, bisweilen grob unter die Gürtellinie greifende, durchaus auch kein Klischee verschmähende Regiearbeit Krämers hatte zusammen mit dem grell und bollywoodmäßig ausgeleuchteten Bühnengeschehen viele doppelte, differenziert eingezogene Böden, die man goutieren konnte. Und auch für das rechte Augenfutter war gesorgt: mit glitzerndem, sich wandelndem Hintergrund, fantasievollen üppigen Kostümen (Jürgen Bäckmann/ Falk Bauer), indisch geprägten choreografischen Einlagen (Paul Kribbe), viel Situationskomik und jeder Menge "Äction", die mit der sichtbaren Lust aller Beteiligten vonstatten ging. Schon dass man mit Trude Hoess eine Sprech-Figur einführte, die die Oper an sich kräftig ironisierte, sich aber immer wieder zu den Gefühlen bekannte, die dort und nur dort überleben können, sorgte dafür, dass der Klamauk nicht nur Klamauk blieb. Dass die Musik des europaweit erfolgreich gewesenen Komponisten Majo, die der junge Mozart als "bellissima" einstufte, über dem inhaltlich kaum mehr begreifbaren Spektakel zu kurz kommen könnte, stand das eine oder andere Mal schon zu befürchten. Aber eben nur fast. Dafür sorgten Cornelia Ptassek, Katharina Göres und Iris Kupke mit lyrischer Intensität scheinbar ganz ohne Anstrengung, wobei selbst sie sich über die eigenen Koloraturen belustigen durften. Den Inderkönig Porus, als Gegenspieler des griechischen Feldherrn Alexander (Lars Moller), gab die hinreißende Marie-Belle Sandis. Wie gut, dass man ihr keinen männlichen Altus vorgezogen hat. |
|
das opernnetz.com Die Dreisparten-Oper
Eine Hofoper von 1776 für den pfälzischen Kurfürsten Carl Theodor, dazu noch eine verloren gegangene Ouvertüre, Arien, die schon mal locker die Zehnminutengrenze streifen können, eine peinlich anmutende, sich devot anheischig machende Eloge auf den edlen Potentaten Alexander, der sich aufgeklärt gegenüber dem unterlegenen indischen Kollegen Porus verhält, als habe er gerade Voltaire verschlungen, eine Beziehungs- und Verwechslungsgeschichte, deren Verlauf und Ende abzusehen ist, sofern sie überhaupt darstellbar und nachvollziehbar ist - das alles lässt die Frage aufkommen, ob der Verbleib im Archiv nicht die beste aller möglichen Welten für Majos Werk dargestellt hätte. Oder eine konzertante Aufführung dem Haus viel Geld erspart haben würde. Mitnichten! Nicht nur, weil die Fuchs Petroclub AG sich als großzügiger Mäzen erwiesen hat. Nicht nur, weil Majos Musik so zauberhaft prämozartianisch klingt und darum nicht dem Vergessen anheim fallen darf. Günter Krämer gelingt mit seiner Inszenierung ein exzellenter Wurf, eine Herausforderung, die ein brillantes Ensemble mit sichtlichem Vergnügen annimmt, die ein versiert und engagiert aufspielendes Orchester meistert, ein intellektuelles und künstlerisches Vergnügen für das Mannheimer Publikum, das sich nicht satt sehen, satt hören, satt denken und assoziieren kann während des knapp drei Stunden-Spektakels. Rollen, die dreifach besetzt sind - SängerIn, SchauspielerIn, TänzerIn. Die Oper als Dreispartenspiel. Ungeahnte Möglichkeiten tun sich auf, nie gesehene Bilder werden in Szene gesetzt, der sich selbst reitende Mensch nur eine der Figuren, innere Kämpfe, innere Dialoge werden darstellbar, doppelte Motivationen. Nicht nacheinander, sondern ineinander, mit witzigen Auflösungen. Den eigenen Versuchungen wird nachgegeben, wenn Alexander Schauspieler Alexander Sänger zur hochangereicherten Wasserpfeife animiert. Der historische Säufer kifft aktuell. Bisexualität weniger als ‚Sowohl als Auch’, eher phasenweises Entweder/Oder, wobei Krämer die Widersprüche und Brüche im Ich nicht in ein alter ego auslagert, sondern Selbsthass und Bestrafungswünsche in einen (kontrovers diskutierten) Akt sexueller Gewalt am Ende der Oper münden lässt. Er zeichnet Geschichten ein, die sich zwischen Schauspieler und Sänger abspielen. Er spielt mit den Ebenen. Er wechselt die Sprache, lässt den barocken, gestelzt wirkenden Redefluss zu wie Parodien auf das Hoffranzösisch, archaisierende Formen und knallhart konterkarierendes Jetztdeutsch. Sein „Alessandro" liefert eine Theorie der Gefälligkeit von Oper, weist ihr den Platz im Leben zu, seine Inszenierung unterfüttert die Theorie mit Bollywood in Mannheim. Statt Langeweile subtile Unterhaltung. Jürgen Bäckmann (Bühne) und Falk Bauer (Kostüme) brennen ein Feuerwerk ab an zündenden Ideen, märchenhafter Ausstattung. Schwebende Prinzessinnen, rotgestrapste Alexander, Glimmer und Glanz, Safrangelb und Hindukuh, nichts fehlt, nicht einmal der Tikkapunkt auf die Stirnmitte, den sarigewandete Schönheiten durch die Reihen tänzelnd dem Publikum auftupfen. Paul Kribbe bringt den vorzüglichen Bewegungschor und die hoch motivierte Statisterie choreographisch auf Linie. Exotische Klänge von Sitar, Shrutibox, Dan Moi, Tabla, Hang, Konnakol und Kanjira rufen Yogendra und Ramesh Shotham gekonnt hervor, omnipräsent während der gesamten Aufführung. Tito Ceccherini führt das Orchester des Nationaltheaters zu spritziger Italianità und zeigt, dass Barock immer mehr zu einem weiteren Gütezeichen des Hauses werden kann. Das Gesangsensemble überzeugt ausnahmslos. Cornelia Ptasseks großer, solitärer Sopran, ihre seelenmalende Stimme gibt der Cleofide Profil und Ausstrahlung. Ihre tänzerische Seite wird mit Hua Shan-Bähr in beeindruckender Manier von einer Gehörlosen dargestellt. Zweiter Tänzer: Der elegante und zugleich herrlich komische Luches Huddleston jr. Lars Moeller überzeugt doppelt: Sein Bariton bellissimo, sein Spiel dem Profischauspieler und Könner Daniel Schüssler (der andere Alexander) absolut ebenbürtig. Umjubelt auch Iris Kupke in der Rolle der Erissena, mit wunderschönen Koloraturen. Beeindruckend Marie-Belle Sandis in der Rock-Hosenrolle des Poro. Eine vorzügliche Gesangsleistung darf auch Katharina Göres als Gandarte und Gundula Schneider in der Rolle des Timagene attestiert werden. Umjubelt die chansonierende Traute Hoess aus dem Schauspielensemble, aus dem Victor Schefé einen spannenden Poro gibt. Das Publikum zeigt sich hingerissen. Immer neue Ovationen, stehend, einige wenige Buhrufer, die sich offensichtlich an der Darstellung der sexuellen Gewalt stören, provozieren ungewollt immer neue Ausbrüche der Begeisterung auf Seiten der ganz und gar nicht schweigenden Mehrheit. Mitten dabei Dr. Alfred Biolek, dem die Inszenierung sehr gut gefällt. Der klassische Teil bleibe unangetastet, Bollywood sei extrem in, die Mischung gelungen und die Grenze zum Kitsch, so lässt er opernnetz wissen, wird nirgends überschritten. Recht hat er! Frank Herkommer
ALESSANDRO nnnnn Musiknnnnn Gesang nnnnn Regie nnnnn Bühne nnnnn Publikum nnnnn Chat-Faktor |