|
|
Auf heißen Händen
VON JÖRG KÖNIGSDORF Es geht also doch. Ein Opernabend, der Witz und Tiefsinn mit leichter Hand zusammenfügt, der unterhält, ohne derb zu werden, anregt, ohne in Bedeutungsschwere zu verfallen. Wann hat es das zuletzt an der Deutschen Oper gegeben? Von überquellender Warmherzigkeit ist der Beifall, mit dem das Publikum am Ende alle Beteiligten an dieser „Ariadne auf Naxos" überschüttet, als gälte dieser Dank nicht nur der Premiere selbst, sondern einer wiedergewonnenen Zuversicht in das krisengeschüttelte Haus. Verständlich wär’s jedenfalls: Hätte die Deutsche Oper mehr Abende wie diesen im Angebot, bräuchte man sich keine Sorgen um sie zu machen und das aus Enttäuschung und Verärgerung über allzu viel Misslungenes der Bismarckstraße letzthin ferngebliebene Publikum, stünde wieder an den Kartenschaltern Schlange. Überraschend kommt dieser Erfolg nicht. Denn erstens hatte diese (nur für fünf Vorstellungen) von der Bayerischen Staatsoper entliehene Produktion ihre Publikumswirksamkeit ja schon bewiesen, und zweitens vermag es der Kanadier Robert Carsen als Regisseur allen recht zu machen: den Sängern, dem Publikum, der großen Opernbühne selbst, auf der viele schöne Ideen schnell klein und hilflos aussehen. Doch Carsen, der hier sein überraschend spätes Berlin-Debüt gibt, ist ein Profi: Souverän schafft er sich für Strauss / Hofmannsthals kunstvolles Theater-auf-dem-Theater-Spiel den Raum, den er gerade braucht, behält im chaotischen Gewusel des Vorspiels die Übersicht, kann die Riesenbühne der Bismarckstraße aber auch unangestrengt mit ein, zwei Sängern füllen. Das ist Musiktheater von Anfang an: Im Haus des „reichsten Mannes der Stadt", der Künstler verschiedener Couleur als hochkulturelles Entertainment für seine Gäste versammelt hat, turnen schon zur Ouvertüre die Ballettratten, die später auch in die Aufführung der Oper „Ariadne auf Naxos" involviert sein werden. Nicht im theresianischen Rokoko wird dieses Fest veranstaltet, sondern zwischen Glas und Beton. Und nicht Opera Seria und Commedia dell’Arte müssen, einer spontanen Anordnung des Geldgebers Folge leistend, mit- und gegeneinander antreten, sondern ihre aktuellen Nachfahren: Die hohe Kunst kommt als Tanztheater à la Pina Bausch daher. Die vier Witzbolde im Gefolge des Showgirls Zerbinetta dagegen scheinen direkt aus der fliegenden Zirkustruppe von Monty Python zu stammen. Das tut dem Stück nur gut, weil der Gegensatz zwischen E und U, zwischen hehrer Kunst und kommerzieller Unterhaltung dadurch umso klarer hervortritt: Im historisierenden Harlekinaden-Kostüm, wie es sich Hofmannsthal und Strauss 1916 wünschten, würde ihre Zerbinetta inzwischen selbst nur als Vertreterin hoher Koloraturkunst begriffen werden. Bei Carsen ist sie vor allem sexy – mal mit Louise-Brooks-Perücke, dann, in ihrer Showeinlage „Großmächtige Prinzessin" als Mae West von einem Rudel hot guys auf Händen getragen. Einerseits trifft das den Kern der Sache. Schließlich ist hier eine gute Viertelstunde von nichts anderem die Rede als von der Schwachheit der Frau angesichts gut gebauter Männerkörper. Andererseits wird die „Ariadne" dadurch mit ihrer Entstehungszeit rückgekoppelt. Denn Hofmannsthal verarbeitete jenes Auseinanderdriften von Massenkultur und Elitenkunst, das im ersten Viertel des 20. Jahrhunderts eine bis dahin unbekannte Dynamik erreichte. Schon in der Art, wie die große Oper hier beschrieben wird, steckt ein gutes Stück Karikatur des nachwagnerschen Gesamtkunstwerks: Im zur Schau gestellten Heroinenpathos der sitzen gelassenen Kreterprinzessin ebenso wie im nicht enden wollenden Duett, in dem Bacchus und Ariadne mehrfach den Faden zu verlieren scheinen. Da verzeiht man es Carsen, dass die Redundanz dieses letzten Teils etwas zu deutlich spürbar wird. Die große weiße Wand, vor der das hehre Paar einander in die Arme sinkt, taugt letztlich als Projektionsfläche für jedes Drama (Bühne: Peter Pabst). Das wäre auch konkreter gegangen. Dass der Abend auch diese prekäre Stelle kraftvoll überspielt, liegt vor allem am sicheren musikalischen Fundament. Unter Jacques Lacombe erinnert das Orchester der Deutschen Oper daran, was für leuchtende Strauss-Farben es eigentlich besitzt. Trotz gelegentlicher Wackelkontakte zur Bühne lässt der Abend keinen Zweifel daran, dass die Musiker in dieser Musik ebenso zu Hause sind wie diese Musik an der Deutschen Oper. Mit ihren 17 Rollen ist „Ariadne auf Naxos" ein Leistungstest für ein Besetzungsbüro. Die Deutsche Oper besteht ihn gut, sowohl bei den kleineren, durchweg markant profilierten Partien (Burkhard Ulrich als Tanzmeister, Lenus Carlson als Musiklehrer) als auch bei den Gaststars. Während Violeta Urmanas eine Ariadne mit Brünnhilden-Autorität ist, hält Roberto Saccás Bacchus mit der Strahlkraft eines jungen, aber durchsetzungsfähigen Gottes dagegen. Und wenn Carsen am Ende nicht nur das Heldenpaar vereint, sondern eigenmächtig auch den heißblütigen jungen Komponisten (Ruxandra Donose) und Zerbinetta (sexy bis ins hohe f: Jane Archibald) verkuppelt, hat wohl keiner etwas dagegen. Der Mann kann es eben allen recht machen. Wieder am 11., 19., 21. u. 27. 2. |
|
|
Deutsche Oper Von Klaus Geitel Die Deutsche Oper an der Bismarckstraße hat sich mit der Aufführung der "Ariadne auf Naxos" von Richard Strauss den Platz Eins in der Hauptstadt wieder erobert. Regisseur Robert Carsen sei ein Theaterwunder gelungen, wie es schon lange keins mehr gab, meint unser Kritiker.
Nach dem Großerfolg der „Ägyptischen Helena" nun ein neuer Triumph der Richard-Strauss-Wochen. Er ist inszenatorisch wie musikalisch einem Teamwork von höchster Kompetenz zu verdanken: an der Spitze dem Regisseur Robert Carsen, dem Dirigenten Jacques Lacombe und seinem hingebungsvollen Orchester, der Bühne von Peter Papst, samt den Kostümen von Falk Bauer, und natürlich einer rundum hervorragenden Besetzung, deren wundervoller Übereinklang zu wahrhaft explosiven Beifallsbekundungen führte. Der Komponist ist der Held Carsen lässt den Zweiteiler, von Hofmannsthal als Vorspiel und Hauptspiel verschränkt, ohne Pause spielen. Er verknüpft beide Teile aufs Amüsanteste, letztendlich aber auch aufs Anrührendste. Held des Stückes sind bei ihm nicht die Primadonna und ihr heldentenoraler Singkumpan, sondern der gebeutelte, erniedrigte, verzweifelte Komponist, der seine offenkundig zum Machwerk verhunzte Oper, erst einmal unter Tränen dem Dirigenten am Pult im Orchestergraben auf Gedeih und Verderb ausliefert. Dann, hingequetscht an den Bühnenrand, beäugt er die Vorstellung, belauert und kontrolliert sie, um nach ihrem Ende von allen Mitwirkenden geradezu in einem Triumphzug auf den Schultern über die nackte Bühne getragen zu werden. Ruxandra Donose, jung, rank und schlank, singt die Wunderpartie tiefer seelischer Verwundung und Auferstehung in Glanz und Glorie mit hinreißendem Stimm-Elan. Ihr tiefernst und besorgt zur Seite der eindringliche Lenus Carlson als ihr Musiklehrer. Gelegentlich will es scheinen, als hätten Strauss und Hofmannsthal ihre gemeinsame Oper noch anschaulicher „Zerbinetta auf Naxos" nennen sollen. Sie konnten aber nicht wissen, dass Jane Archibald, die Koketterie in Person, die Rolle der Entertainerin in Berlin singend hinsprühen würde: eine Koloraturvirtuosin höchsten Grades, dazu spielvergnügt, verzaubernd, eine Männermörderin der Liebe auf dem Operntrip, umsungen und umsprungen von ihren vier heiteren Kameraden, umzingelt außerdem von einem wahren Turnverein sinnlich aufgeheizter Männlichkeit. Nie zuvor war der Opernstatisterie eine vergleichbar dankbare Aufgabe zugefallen. Sie löste sie aufs Tüpfelchen in aller vorgeschriebenen Stille buchstäblich mit Haut und Haar. Carsen lässt das Geschehen auf nackter, schwarzer Bühne herumtollen. Es setzt Überraschungen am laufenden Band. Denn die Insel, auf der Ariadne gestrandet ist, bleibt durchaus nicht lange wüst und menschenleer. Es ringeln sich fortgesetzt, schwarz gekleidete weibliche Gestalten stumm am Boden, nicht nur die drei mythologisch fixierbaren Sing-Gefährtinnen. Es tut sich immerfort was, geheimnisvoll und die Neugier weckend. Sie rankt sich natürlich um Violeta Urmana in der Titelpartie der Ariadne. Nach ihrem hochnäsigen, etwas schrillen Primadonnenauftritt im Vorspiel singt sie sich nun mit ausdauernder inbrünstiger Schönheit tief in die Tragik hinein, die der unmenschlichen Verlassenheit, in die sie Theseus, der geliebte, hinab stieß. Die Urmana findet dafür die hochpathetischen, leisen Worte, die Hofmannsthal und Strauss ihr in die Kehle legen, und singt sie mit Wärme und unendlicher Würde heraus. Roberto Saccà als tenoraler Singgott Aus der Ferne zunächst, durch einen einzigen hellleuchtenden Lichtschlitz auf finsterer Bühne, klingt des Bacchus Stimme herein. Sie gehört in kostbarer Unermüdlichkeit und heldentenoraler Linienschönheit Roberto Saccà. Er ist tatsächlich ein Singgott, an dessen Stimmkultur sich nicht einzig Ariadne nicht satt hören kann. Dem Publikum geht es nicht anders. Saccà und Urmana machen deutlich, wovon Hofmannsthal und Strauss in ihrem Meisterwerk sprechen: „Musik ist eine heilige Kunst". So wird sie auch von Lacombe und seinem Orchester, aber auch von der Regie Carsens behandelt. "Ariadne auf Naxos" in der Deutschen Oper, Bismarckstr. 35, Charlottenburg. |
|
|
Die Kunst der Verwandlung Wolfgang Fuhrmann Es geht um die Kompromisse und um die Extreme, um das Begehren, das flüchtig streift von Gestalt zu Gestalt, und um die Liebe, die da nimmermehr aufhöret, es geht um den Anspruch der hohen Kunst und um die niederen Instinkte derer, die sie bezahlen. Es geht, mit einem Wort, um alles: Nichts Geringeres als Liebe, Kunst und Tod sind, in feingewirktem Ineinander, die Themen von "Ariadne auf Naxos", der Oper in einem Aufzug nebst einem Vorspiel von Hugo von Hofmannsthal und Richard Strauss. Der Regisseur Robert Carsen und der Dirigent Jacques Lacombe haben die "Ariadne" am Sonntag an der Deutschen Oper herausgebracht, als Zweitpremiere in Koproduktion mit der Bayerischen Staatsoper, und man muss gleich sagen, es ist ein nahezu uneingeschränkter künstlerischer Erfolg geworden, stimmig, sinnig und geglückt auf allen Ebenen, zwischen Kompromiss und Extrem, Tragödie und Komödie, der Liebe zur Kunst und der Kunst des Liebens. Eigentlich erzählt Carsen einfach die Geschichte, die sich in Vorspiel und Oper ereignet. Aber so einfach ist es eben nicht, denn "Ariadne" ist so doppelbödig und beziehungsreich wie kaum ein anderes Werk der musikalischen Weltliteratur. Das Vorspiel schildert die Schrecken des Mäzenatentums im 18. Jahrhundert, indem ein junger Komponist seine tragische Oper "Ariadne auf Naxos" auf Befehl des Sponsors mit lustigen Einlagen versehen soll. Die Oper selbst schildert die Schrecken des Liebesverrats in mythologischer Allgegenwart: Ariadne, von Theseus verlassen, will sterben, findet aber mit dem Gott des Rausches, dem jungen Bacchus in das Leben und die Liebe zurück. Die alte Erfolgsformel vom Theater im Theater ist hier selbst nur Schein, hinter dem das wahre Sein aufleuchtet. Denn im Innersten geht es dem Stück um die Verwandlung, das "Leben des Lebens", wie Hofmannsthal es einmal genannt hat: das überlebensnotwendige Vergessenkönnen, dem die Treue als Grund aller menschlichen Würde gegenübersteht. Hofmannsthal nennt dies einen "von den abgrundtiefen Widersprüchen, über denen das Dasein aufgebaut ist, wie der delphische Tempel über seinem bodenlosen Erdspalt." Robert Carsen gelingt es, für diese bodenlosen Paradoxie so einfache wie sinnreiche Bilder zu finden. Die innere Erstarrung und Verkapselung der Ariadne zeigt er durch eine vielfache Spiegelung. In einer Dunkelkammer (Bühne: Peter Pabst) sitzen rings um die - ihre Trauer in nobel geschwungene Gesangsbögen und edle Deklamation kleidende - Violeta Urmana ein gutes Dutzend Ariadnes und imitieren die ritualisierten Pathosgesten der Verlassenen: eine blickdicht-melancholische Welt. Auch dass sich fünf der Ariadne-Doppelgängerinnen als Zerbinetta und ihr Komödianten-Team entpuppen, vermag diesen Bann nicht zu brechen. Erst mit dem Auftritt des Bacchus (solide gesungen von Roberto Saccà), seinerseits von einem Gefolge von Herren umgeben, bricht sich die Erstarrung allmählich, so wie die Dunkelkammer durch einen gleißenden vertikalen Lichtspalt aufgebrochen worden ist, der sich mit jeder Strophe von Bacchus' Ankunftsliedchen erweitert hat (Lichtdesign: Manfred Voss). Die einfachsten Theatermittel sind eben doch oft die mit der stärksten Wirkung. Wenn der junge Komponist (Ruxandra Domrose) der Anführerin der Commedia dell'arte-Truppe, Zerbinetta, begegnet, müsste er dieser Bedienerin der ihm verhassten Spaßgesellschaft eigentlich seine Verachtung zeigen. Stattdessen findet er sich von ihr - während sich im Hintergrund eine Metallwand schräg herabsenkt und die beiden vom Getümmel abschließt, - sonderbar angezogen und innerlich berührt. Auch dies verdeutlicht Carsen mit den einfachsten Mitteln der Welt: Jane Archibald zieht ihre roten Pumps mit den sehr hohen Hacken aus und lässt unter ihrer schwarzen Kleopatra-Perücke einen blonden Haarschopf herausschlüpfen; plötzlich wirkt sie sehr mädchenhaft-unschuldig - und ein wenig verfroren, denn der Komponist hängt ihr fürsorglich sein Jackett um. Hier sind das Werk oder zumindest die Inszenierung auch menschenfreundlicher als der Librettist: Während Hofmannsthal Zerbinetta da "mit äußerster Coquetterie" taktieren sah, lässt es Carsen kunstvoll in der Schwebe, ob und wie der Idealist und die Kokette doch noch zueinander finden. So zeitlos diese Momente wirkten, so schwach wirkt der Abend in jenen - wenigen - Szenen, in denen eine pauschale Aktualisierung versucht wurde: Die peinliche Probe des Opernballetts, die schon vor Beginn der Vorstellung stattfand und die Ouvertüre zum Vorspiel kaputt trampelte, den allzu managerhaften Haushofmeister (Matthias Bundschuh), dem es an jenem pompös-gemeinen Wiener Lakaientum mangelte, dessen Ton Hofmannsthal so unvergleichlich traf. Auch die Zerbinetta-Nummer "Als ein Gott kam jeder gegangen", animiert durch einen Schwung knackärschiger und alsbald bis auf den Slip entkleideter männlicher Ballettkörper, macht zwar Effekt, aber nicht den richtigen. Zerbinetta ist eben nicht Madonna, sie spielt nicht die übertrainierte Domina, die das Frischfleisch unterjocht, sondern die Frau, die jedem neuen Reiz unwiderstehlich ausgeliefert ist: "Kam der neue Gott gegangen,/ Hingegeben war ich stumm!" Dennoch gerät die Szene begeisternd, und das ist der blühenden Stimme Jane Archibalds zu verdanken, die jede der grausam schwierigen Koloraturen und jedes Trillerchen in höchster Lage nicht nur bewältigt, sondern zum lockenden Balzton gestaltet, hier nun wirklich "mit äußerster Coquetterie". Archibald war denn auch neben Urmana die zweite umjubelte Heldin dieses Abends, der mit der schön, leider kaum textverständlich singenden Ruxanda Domrose, mit dem vorzüglichen Tanzmeister des Burkhard Ulrich, dem komödiantischen Harlekin (Simon Pauly), dem mythischen Trio Najade, Dryade und Echo (Burcu Uyar, Nicole Piccolomini und Martina Welschenbach) zahlreiche weitere Attraktionen aufwies. Nicht zuletzt trug Jacques Lacombe zum Gelingen bei, der dem Orchester der Deutschen Oper einen durchsichtig-leichten, in allen Farben schillernden Klang bei immer fließenden Tempi zu entlocken wusste, im Großrhythmus Carsens untrüglicher szenischer Intuition wie angemessen. Großer Jubel beim Publikum und ein dissidenter Buhruf beim Regieteam. Greift es jetzt endlich, das Getriebe, geht es wieder vorwärts mit dem alten Schaufeldampfer in der Bismarckstraße? Das hat man schon oft gedacht und auf den von der Intendantin Kirsten Harms seit drei Spielzeiten gebetsmühlenartig verkündeten Neuaufbruch gehofft. Ob die Verwandlung geglückt, das Werk gelungen sei, das erfährt man - wie der junge Komponist auf der großen, leeren, dunklen Bühne - erst nach dem allerletzten Ton. |
|
|
Deutsche Oper Berlin VON JÜRGEN OTTEN Kirsten Harms ist eine Dame, die weiß, was sich gehört. Sie hat, was in Berlin nicht unbedingt an der administrativen Tagesordnung ist, Manieren, sie hat Stil. Sie poltert nicht, weder im Haus selbst noch bei den Sitzungen im Kulturausschuss, sie denkt lieber erst nach, bevor sie etwas sagt. Im Gespräch, das sie gerne sucht, gibt sich sich offen; offen für Wünsche, Kritik und Anregungen. Bis hierhin ist alles wunderbar. Doch Kirsten Harms hat einen Vertrag, und der verpflichtet sie, eines der größten deutschen Opernhäuser zu führen: die Deutsche Oper Berlin. Und genau das stellt sie inzwischen vor kaum lösbare Probleme, weil gleich drei Komponenten nicht so funktionieren, wie sie es tun sollten. Die erste, immer noch mit Abstand relevanteste Komponente ist die Kunst selbst. Und da hat Kirsten Harms in dieser Spielzeit nicht eben glückliche Griffe getan. Ihre eigenen Inszenierungen (der Doppelabend "Cassandra/Elektra" sowie "Tannhäuser") gerieten doch sehr zahm und betulich, Regiearbeiten von Gästen wie etwa Tatjana Gürbacas Wagners "Fliegender Holländer" kamen beim Publikum und bei großen Teilen der Kritik nicht an. Das wäre noch verschmerzbar, wenn nicht gleich drei Pechsträhnen vom Dach der Deutschen Oper Berlin hinabhingen: Die erste war die Absage von Jürgen Gosch, der wegen einer schweren Krankheit die Regie für "Carmen" abgeben musste; gezeigt wird nun Anfang März eine polierte Version einer Inszenierung von 1979. Ebenfalls einen Korb gab Katharina Wagner dem Haus an der Bismarckstraße. Sie sollte "Marie Victoire" von Ottorino Respighi inszenieren, eine echte Wiederentdeckung, entschied sich aber dann urplötzlich und unter Angabe von vagen Gründen, ihn nicht zu unterschreiben - was insbesondere deswegen ärgerlich war, weil wenig später ihre Handschrift unter einem Kontrakt landete, der sie für eine Regiearbeit auf die kanarischen Inseln verpflichtete. Immerhin kommt das Stück jetzt in der Inszenierung von Johannes Schaaf heraus. Das Dilemma begann mit Geld Die dritte Strähne schließlich hat mit der Kunst schon wieder fast gar nichts zu tun: Die geplante Neuinszenierung von Straussens "Daphne" musste abgesagt werden, weil das Haus erneut in finanzielle Schieflage geraten war. Und eben an diesem Punkt betritt jener Protagonist das Spielfeld, der Kirsten Harms seit Jahren das Leben schwer macht: die hauptstädtische Kulturpolitik. Oder, um es zuzuspitzen auf die Person, die hier federführend handelt: Klaus Wowereit, ehemaliger Bezirksrat in kleinbürgerlichen Tempelhof und seit einiger Zeit Regierender Bürgermeister von Berlin und zugleich deren Kultursenator. Anfang vergangenen Jahres begann das Dilemma. Und es begann mit einem Geldsegen. Satte 20 Millionen Euro Überschuss verzeichnete die Berliner Opernstiftung auf ihrem Konto. Als es daran ging, das Geld zu verteilen, war es wie immer in der jüngeren Vergangenheit. Die Staatsoper Unter den Linden erhielt mit zehn Millionen den größten Batzen, die Komische Oper freute sich über sechs Millionen, und die Deutsche Oper, mit Abstand das größte Haus am Platz, bekam den kärglichen Rest von vier Millionen. Das Schlimme: Von den vier Millionen blieben ihr wegen der längst verfügten Zuschussabsenkung nur noch spärliche zweieinhalb übrig, womit vor allem ausstehende Gehälter bezahlt wurden. Und wie reagierte Kirsten Harms? Sie schwieg, betreten und innerlich vor Zorn bebend. Aber sie schwieg. Sie wollte keinen Streit vom Zaun brechen. Und das war ihr Fehler. Es muss in diesen Tagen gewesen sein, dass Klaus Wowereit einen Beschluss fasste. Diese Frau sollte länger nicht die Herrin im Hause Bismarckstraße sein. Natürlich war der Regierende so diskret, das nicht an die große Glocke zu hängen. Aber irgendetwas sickert immer durch. Und so wusste man bald, dass Wowereit seinen Staatssekretär André Schmitz auf der Suche nach einem Nachfolger für Kirsten Harms durch die Lande reisen ließ. Schmitz suchte. Er suchte eifrig, an mehreren Orten. Aber er wurde nicht fündig. Jedenfalls bis jetzt nicht. Es hagelte Absagen. Namen kursieren, sie sind nicht wichtig. Wichtig ist, dass es anscheinend keine besondere Ehre für die Intendanten in spe in dieser Musikwelt ist, den Job in Berlin zu übernehmen. Woraus sich die bizarre Situation ergibt, dass der Vertrag der Intendantin bislang nicht verlängert worden ist, was nach den Usancen in der Branche längst hätte geschehen müssen, aber eben politisch nicht gewollt ist, dass sie aber auch keinen Korb gekriegt hat, weil die Politik nicht weiß, ob sie einen geeigneten Nachfolger für sie präsentieren kann. Was sie indes kann, ist, dem politischen Willen Ausdruck zu verleihen: Als kürzlich bekannt wurde, dass die Deutsche Oper das Haushaltsjahr 2008 mit einem Defizit von rund 800 000 Euro abgeschlossen hat, stand niemand auf, um diesen Missstand zu korrigieren. Moralisch vertretbar wäre es allemal gewesen. Denn der Grund für die erneute Finanzkrise war nicht Misswirtschaft, sondern glich weit mehr einem Lehrstück aus der Beamtenrepublik: Das Haus zahlt Beiträge an die Versorgungskasse des Bundes und der Länder (VBL). Diese Rentenkasse aber stellte plötzlich fest, dass ihr Topf leer ist, und beschloss deswegen, "Sanierungsgelder" von den Arbeitgebern einzuziehen. Die Deutsche Oper Berlin muss - im Gegensatz zur Lindenoper und der Komischen Oper - nun sieben Jahre lang von allen gezahlten Gehältern zusätzlich mehr als elf Prozent an die VBL abführen. Damit nicht genug. Da im Jahr 2010 aufgrund von Tarifsteigerungen die Personalkosten in die Höhe schnellen werden, zugleich aber die bislang gezahlte Million des Sponsors Volkswagen wegfällt, steigt das Defizit so stark, dass die Deutsche Oper sich bereits genötigt sah, die Eröffnungspremiere der kommenden Spielzeit, einen "Fidelio", abzusagen. Ferner muss die Anzahl der Vorstellungen reduziert und eine Haushaltssperre verhängt werden. Zu den gegenwärtig unbesetzten 42 Planstellen kommen weitere 14 hinzu. Wenn man weiß, dass das Orchester der Deutschen Oper Berlin bereits jetzt mit einem Viertel an Aushilfen arbeitet, weiß man auch, wie schwer die Zukunft wiegt. Immerhin, einen Trost hat Kirsten Harms. Die Richard Strauss-Wochen an ihrem Haus waren ein voller Erfolg. Erst reüssierte Marca Arturo Marelli mit seiner Sicht auf "Die ägyptische Helena". Und nun kam mit Robert Carsens "Ariadne auf Naxos" aus München eine Inszenierung ans Haus, deren sinnliche Süffigkeit und choreographische Eleganz zu betören wusste, und die mit Sängern aufwartete, die der Galabesetzung in der bayerischen Metropole durchaus auf Augenhöhe zu begegnen wusste. Entdeckung des Abends war die junge kanadische Sopranistin Jane Archibald. Sie spielte die Zerbinetta mit großer Ausstrahlung, und sie sang sie mit einer Luzidität noch in höchsten Höhen, die schlichtweg beeindruckte. Am Ende Jubel in der Deutschen Oper Berlin. Ob er die weiße Dame, wie man Kirsten Harms ihrer Garderobe wegen gerne nennt, retten wird? Es steht dahin. Ariadne auf Naxos,Deutsche Oper Berlin: 11., 19., 21., 27. Februar. [ document info ] Dokument erstellt am 09.02.2009 um 16:56:02 Uhr Letzte Änderung am 09.02.2009 um 17:44:07 Uhr Erscheinungsdatum 10.02.2009 |
|
|
BERLIN Riesenerfolg für die von Geldsorgen geplagte Deutsche Oper Berlin: Die Neuinszenierung von Richard Strauss' "Ariadne auf Naxos" ist am Sonntagabend mit großem Jubel über die Bühne gegangen.
Die Produktion des kanadischen Regisseurs Robert Carsen sowie Sänger und Orchester wurden vom Publikum begeistert gefeiert. Es war ein unumstrittener Premierenerfolg an dem Haus an der Berliner Bismarckstraße. Vor allem die beiden Frauen in den Hauptrollen - Violeta Urmana in der Titelpartie sowie Jane Archibald als Zerbinetta - rissen die Zuhörer nach dem Schlussvorhang von ihren Sesseln. Der Italiener Roberto Saccá als Bacchus sowie Ruxana Donose als der Komponist begeisterten die Zuhörer ebenso wie das Orchester unter Jacques Lacombe. Der in London lebende Strauss-Fachmann Carsen hatte die Produktion bereits im vergangenen Jahr am Münchner Prinzregententheater herausgebracht. Er verlegt das Stück über den Wettstreit zwischen ernster und heiterer Kunst in die Theaterwelt der Gegenwart. Mit ausgeklügelter Beleuchtung (Manfred Voss) und schlüssiger Personenführung lässt Carsen das in einem fast leeren Raum spielen mit nur wenigen Requisiten wie Spiegel oder Klaviere (Bühne: Peter Pabst). Auch der Zuschauerraum dient Carsen als Arena für dieses Stück Theater im Theater. Das Libretto der 1916 in Wien uraufgeführten Oper stammt von Hugo von Hofmannsthal: Ein reicher Wiener hat die tragische Oper "Ariadne auf Naxos" in Auftrag gegeben, will aber auf eine Komödie nicht verzichten. Beide Werke sollen zeitgleich gegeben werden. Die ernsten Musiker sind verzweifelt, die Komödianten sofort dazu bereit. Dem größten Berliner Opernhaus fehlt wegen der Nachzahlung von Versorgungsbezügen und dem Wegfall von Sponsorenmittel mehr als zwei Million Euro in der Kasse, für die kommende Spielzeit wurde die Eröffnungspremiere mit Beethovens "Fidelio" abgesagt. |
|
|
Berlin: Robert Carsens "Ariadne"-Inszenierung bei Strauss-Wochen Tatsachen des Theaters Von Joachim Lange
Mit ihren Richard-Strauss-Produktionen kann die Deutsche Oper Berlin nicht nur Ehre einlegen, sondern auch mühelos ihre Strauss-Wochen bestreiten. Sie begannen heuer mit der bejubelten "Ägyptischen Helena" von Marco Arturo Marelli. Bis 27. Februar gibt es noch die bunt verspielte "Salome" von Achim Freyer, die "Elektra", die die Hausherrin Kirstin Harms ziemlich schlüssig mit der ausgegrabenen "Cassandra" Vittorio Gnecchis gekoppelt hat und den Götz-Friedrich- "Rosenkavalier" von 1993. Zu einem Höhepunkt wurde die von Strauss und Hugo von Hofmannsthal dem "Rosenkavalier" hinterdrein geschickte "Ariadne auf Naxos". Kirsten Harms war dabei auf Nummer Sicher gegangen und hat die schon in München gefeierte Produktion von Robert Carsen eingeladen. Mit der Neueinstudierung gab der kanadische Regisseur zugleich sein erstaunlich spätes Berlindebüt. In der kargen Ausstattung von Peter Pabst beginnt alles mit einer Ballettprobe. In einem Theater von heute. Mit einem schnöseligen Jungregisseur (mit dem Text des Haushofmeisters). Und mit Profi-Künstlern, die sich auch noch auf die willkürlichsten Wünsche einzustellen versuchen. Raumgreifendes Kammerspiel Selbst die Diva und der idealistische Komponist, landen alsbald auf dem Boden der Theatertatsachen und machen aus der Vorgabe, die tragische Oper und das Lustspiel gleichzeitig aufzuführen, das Beste. Am Ende ist selbst der Komponist (überzeugend: Ruxandra Donose) auf seinem Platz in der ersten Reihe fasziniert von dem Stück Theater, das da entgegen seiner ursprünglichen Intention entstanden ist. Bei Carsen wird das zu einem raumgreifenden Kammerspiel mit Ballett. Da kommt nicht nur der Musiklehrer durch den Zuschauerraum, da sind Ariadne und Bacchus in vervielfachter Gestalt auf der Bühne, zelebrieren in der scheinbaren Improvisation des Spiels das Exemplarische. Was in der Dunkelheit der Bühne beginnt, endet als eine Art utopischer Apotheose von Musik und Liebe vor einer strahlend weißen Wand aus purem Licht. Violeta Urmana bietet dabei nicht nur kraftvoll schlanke Höhen, sondern profitiert vom Unterfutter ihrer Mezzovergangenheit. Und überzeugt als geschäftige Diva der Rahmenhandlung im neureichen Milieu von heute ebenso wie mit der gesammelten Ernsthaftigkeit ihrer Ariadne. Roberto Saccà ist ihr tadellos strahlender Bacchus. Dass Jane Archibald als Zerbinetta abräumt, liegt vor allem an ihrer Koloraturmühelosigkeit. Aber Carsen hat ihren Auftritt mit strippender Männertruppe auch wie eine lustvoll erspielte Revuenummer in die Dunkelheit jener "wüsten Insel" platziert, von der sich allesamt überzeugend in eine betörend opulente Strauss-Welt hinweg singen. Jacques Lacombe hatte im Graben dabei ein Orchester vor sich, das derzeit sozusagen auf Strauss-Droge ist. Zufriedene Begeisterung an der Deutschen Oper. Wie schön! Oper Von Richard Strauss Robert Carsen (Regie) Jacques Lacombe Dirigent) Mit: Violeta Urmana, Roberto Saccà, Jane Archibald, Ruxandra Donose, Lenus Carlson u.a. Deutsche Oper Berlin (Tel.: 0049/30-343 84 343) Wh.: 19., 21., 27. Februar |
|
|
Jeder Mann ein Gott! Von Georg-Friedrich Kühn
So richtig glücklich war er nicht, der Librettist Hugo von Hofmannsthal, über den Versuch, Komödie und Tragödie miteinander zu verbinden. Und auch die Musik, die Richard Strauss zu seinem Text komponiert hatte, behagte dem Dichter nicht recht. Und dennoch wurde die Oper "Ariadne auf Naxos", 1916 ein Erfolg. Der kanadische Regisseur Robert Carsen hat "Ariadne auf Naxos" nun für die Deutsche Oper Berlin gemeinsam mit dem Choreographen Marco Santi inszeniert. Ballettstangen und Spiegel sind aufgebaut auf der Bühne. Mit einer Trainingseinheit und einer Probe für die Tänzer lassen Regisseur Robert Carsen und Choreograf Marco Santi die Strauss-Hofmannsthalsche "Ariadne" beginnen. Die Komödianten-Truppe um Zerbinetta reist mit Rollkoffern und einer Kostprobe ihrer Verwandlungskünste per Gummi-Ganzgesichts-Masken an. Zerbinetta gewährt dem Tanzmeister auch schon mal gleich eine Gesamtansicht ihres nur in ein Badetuch verhüllten ranken Körpers. Mit Stentorstimme knallt der Haushofmeister die immer neuen Anweisungen seines vermögenden Herren dazwischen. Die anfängliche Verzweiflung darüber - mal erst Tanzmaskerade und danach die Opera Seria, dann umgekehrt und schließlich ineinander verschränkt - verfliegt bei dem Komponisten schnell, als Zerbinetta sich ihm offenbart. Nur auf der Bühne spiele sie - in schwarzem Unterkleid und roten Pumps - die Kokotte. In Wahrheit sei sie einsam und traurig. Und sie lüftet dafür ihre schicke schwarze Vamp-Perücke. Zärtlich legt der Komponist seine Jacke als Liebespfand um ihre nackten Schultern. Gespannt beobachtet er von der Seite der Bühnenrampe dann ihre und ihrer Truppe Auftritte. Dass das ein "heikler" Balance-Akt war, die Tragödie der auf ihrer Insel Naxos einsam und von Theseus verlassen den Tod herbei sehnenden Ariadne mit den Zauber-Kunststückchen von Zerbinetta und ihrer Vierertruppe zu verschränken, waren Hugo von Hofmannsthal und Richard Strauss sich sehr wohl bewusst. Carsen zeigt das einander Anverwandeln der beiden Sphären in der aufkeimenden Liebe zwischen dem Komponisten und Zerbinetta. Die lässt sich im Stück von einer ganzen Truppe gut gebauter Männer zwar anhimmeln und auf den Händen tragen. Am Ende schlendert sie mit des Komponisten Jackett um die Schultern über die Bühne, Ausschau haltend nach ihm. Die Opera Seria selbst legen Carsen und Santi an als die antike Tragödie parodierendes Mysterienspiel. Zerbinetta und ihre Komödianten reihen sich in langen schwarzen Gewändern ein in den Schweif von Ariadne-Dienerinnen, die da Steinen gleich den vermeintlichen Todesgott erwarten, der sich dann aber als neuer Liebhaber Bacchus entpuppt. Einfallsreich und mit Liebe zum Detail ist das inszeniert, auch wenn die Spannung nicht immer hält. Für ihr großes Solo kommt Zerbinetta wie Kai aus der Kiste aus einem schwarzen Kastenklavier gesprungen. An vier Klavieren buhlen die mal transvestitischen, mal als Muskelmänner posierenden Komödianten um ihre Gunst. Zu Bacchus' und seiner Männer-Phalanx Eintritt öffnet sich in Peter Pabsts schwarzem Bühnenkasten ein gleißender Lichtspalt, der sich immer mehr weitet. Am Ende eilt der Komponist auf die schnell wieder leer geräumte Bühne, dirigiert die Applaus-Ordnung. Und schließlich verteilt der Haushofmeister unter den Künstlern die begehrten Geld-Briefe. Applaus vom Publikum gab es reichlich, sogar euphorischen und schon auf offener Szene für die wunderbar quirlig leichte Zerbinetta der Jane Archibald. Aber auch Violeta Urmana, mit freilich etwas scharfem Ton, Roberto Saccà als Bacchus, Ruxandra Donose als Komponist, der Dirigent Jacques Lacombe und das ganze Team wurden gefeiert. Ein Lichtblick in der bisher ja eher flauen Bilanz der Deutschen Oper Berlin. |
|
|
Deutsche Oper Berlin Oper von Richard Strauss Die Ariadne-Aufführungen bis 1940, welche die Deutsche Oper im Programmheft Revue passieren lässt, waren im Grunde sämtlich Reinfälle – trotz Mitwirkung etwa von Elisabeth Schwarzkopf und Rita Streich als Zerbinetta, von Lisa della Casa und Caterina Ligendza als Ariadne. Ein vertrackter Brocken also, dieses Stück. Dennoch bejubelte das Publikum gestern zu Recht eine von den Solisten her beachtliche, durch das Orchester hochmotivierte, von der Inszenierung her grandiose Aufführung. Ich scherze nicht: Wenn man sich an gelungene Produktionen dieses zwischen Gaukelei und Tiefhuberei schwankenden Problem-Stückes wird zurückerinnern wollen, muss diese Inszenierung dabei sein. Robert Carsen, der reichlich spät sein Berlin-Debüt gibt, ist ein ebenso bilderstürmerischer wie eleganter Regisseur. Was schon sein Grüner Ring in Köln, sein Capriccio in Paris (mit Renée Fleming, auch auf DVD) und seine badende Katja Kabanova (mit Michaela Kaune in Antwerpen) bewiesen haben. Er taucht Strauss in puristisches Schwarz-Weiß – von dem sich nur die roten Schuhe Zerbinettas bunt abheben, und lässt das Ganze brillant ausleuchten (von Manfred Voss, dem aus Bayreuth vertrauten Meister dieses Fachs). Carsens Trick: Die Allotria der Zerbinetta-Truppe (die bei Hofmannsthal eine Opernaufführung stürmt) wird tatsächlich als improvisiertes Alltagsgerede glaubhaft gemacht. Der Komponist sitzt auf der Seite, um sich die Bescherung anzusehen. Es ist Theater auf dem Theater, bei dem man erstaunlich oft lacht. Zweiter Trick: Der Tanz in dieser Oper wird reaktiviert (immerhin gibt es ja einen Tanzmeister). Schon das Opening im Ballettprobensaal lohnt den Besuch der Aufführung. So wird endlich mal deutlich, dass es sich bei Strauss' "Kammeroper" um eine Parodie von Wagners Gesamtkunstwerk handelt. (Kleiner Insiderwitz: Der "reichste Mann von Wien" wird dezent von dem Berliner Zitty-Kritiker Hermann-Josef Fohsel verkörpert.) Violeta Urmana in der Titelrolle hat sich vom Mezzo-Sopran zur Ariadne "hochgearbeitet"; was für ein schönes Klangfundament, allerdings auch für einige biestig-gläserne Höhen sorgt (sie hat zu viele Verdi-Leonoren gesungen). Während sie wie auf dem Silbertablett inszeniert wird, gelingt ihr dennoch eine geschmackssichere und kluge Deutung. Bacchus (Roberto Saccà) ist gottlob kein abgehalfterter Heldentenor, sondern ein mozartesker Jüngling. Auch Ruxandra Donose, bei gelinder Lippenfaulheit, überzeugt als Komponist. Die Abräumerin: Jane Archibald als Zerbinetta; weil sie ihr Großmächtige Prinzessin nicht nur prächtig singt, sondern als psychologischen Verführungsakt toll spielt. Die zumeist glänzende Orchesterleistung mag auf die zurzeit gute Stimmung am Haus zurückzuführen sein. Jacques Lacombe jedenfalls rudert den Sängern zu oft davon, dirigiert klanglich überschlank, disponiert allerdings spannungsreich bis zum Schluss. So ist dies die bislang beste Klassiker-Premiere der Ära von Kirsten Harms – obgleich in München eingekauft; aber auch Einkaufen will gelernt sein. Dass Robert Carsen einer der wichtigsten Opernregisseure der Welt ist, wusste man schon vorher. Hier bestätigt er eine positive Trendwende an der Bismarckstraße. So viel Laune war lange nicht. Kai Luehrs-Kaiser Bewertung: |
|
|
Berlin „ARIADNE AUF NAXOS"Sternstunde ist keine Übertreibung An diesem Abend in der Deutschen Oper Berlin stimmt einfach alles. Da wird sozusagen der Faden entwirrt, der dieses sonderbare Werk oft verheddert erscheinen lässt. Das Verdienst dafür gebührt in erster Linie dem kanadischen Regisseur Robert Carsen, der international mit sensationellen Inszenierung (z.B. dem „Grünen Ring" in Köln) Furore gemacht hat und auch für die bejubelte Münchner Premiere der „Ariadne auf Naxos" im Sommer 2008 verantwortlich war. Mit einem solchen „Pfeil" im Köcher, gelingt diese zweite Premiere aufs Allerbeste. Und es darf bei Carsens Einfällen auch mal gelacht werden. Fabelhaft! Seine Münchner „Crew" ist fast vollständig mit dabei, so der Choreograph Marco Santi und der Lichtdesigner Manfred Voss, beide Könner ihres Fachs. Die Ideen für die Kostüme im minimalistischen schwarz-weiß kann Falk Bauer hier ebenfalls verwirklichen. Die Bühne betreut wiederum Peter Pabst. Er nutzt die große Fläche, und auf der ist fast immer etwas im Gange. Während der pausenlosen zweistündigen Aufführung entsteht nie Leerlauf oder Langeweile. Unterstützt vom großartig aufspielenden Orchester der Deutschen Oper Berlin unter Jacques Lacombe und dem Opernballett des Hauses sorgen sie alle meisterlich dafür, dass dieser „Ariadne" tatsächlich neues Leben eingehaucht wird und sie nicht dahinsiecht vor lauter Trauer über Theseus, den sie einst mit ihrem Faden aus dem Labyrinth gerettet und der sie nun treulos auf die einsamen Insel Naxos verfrachtet hat. In einem solch gelungenen Rahmen kann nun die Musik von Richard Strauss ihre volle Wirkung und ihre gewollt unterschiedlichen Facetten ebenfalls bestens entfalten. Gemeinsam mit hochkarätigen Interpreten erleben wir einen außergewöhnlichen Abend. Wenn Intendantin Kirsten Harms bei der Premierenfeier strahlend von einer „Sternstunde" spricht, dann ist das in diesem Fall keine Übertreibung. Nach der sehr gelungenen „Ägyptischen Helena" nun ein weiterer, noch größerer Erfolg und erneut „Große Oper". Was sehen wir? Schon vor Beginn der Aufführung übt ein jugendliches Ballett auf der Bühne und macht klar, dass diesmal – anders als zumeist – dar Tanz mit dabei ist, und zwar in einer anspruchsvollen und offenbar ausführlich geprobten Choreographie. Zunächst und bekanntlich geht es jedoch um einen jungen Komponisten, dessen tragische Oper „Ariadne auf Naxos" im Haus des reichsten Mannes von Wien uraufgeführt wird. Für Auflockerung soll eine muntere Einlage sorgen, betitelt „Zerbinetta und ihre Liebhaber". Über dieses Ansinnen ist der ernsthafte junge Mann empört und unglücklich. Diese Rolle ist hier in Berlin mit Ruxandra Donose besetzt, die sowohl gesanglich als auch darstellerisch überzeugt. Man glaubt ihr/ihm den geschwinden Sinneswandel durch die attraktive Zerbinetta (Jane Archibald). Der Komponist – prima Idee! – schlängelt sich schließlich durch die erste Parkettreihe und drückt dem Dirigenten die Partitur in die Hand. Jane Archibald, eine junge Kanadierin, wird zur Königin dieses Abends und erhält nach ihrem Part gleich wahre Ovationen. Leicht, locker und doch kraftvoll strömen ihr die Koloraturen aus geschmeidiger Kehle. Figürlich und schauspielerisch ist sie ebenfalls Sonderklasse. Mit Charme, Chuzpe und roten „high heels" verführt sie sämtliche Männer. Die Gruppenbilder dieser kessen Biene mit den ihre Muskeln herzeigenden Liebhabern amüsieren das Publikum köstlich, ohne ins Billige abzurutschen. Als Ulk-Quartett glänzen Simon Pauly, Jörg Schöner, Roland Schubert und Paul Kaufmann. Richard Strauss, der mit dieser Oper Richard Wagners Gesamtkunstwerk karikieren wollte, und der Libretto-Dichter Hugo von Hofmannsthal liefern die zu jeder Situation passende musikalische und textliche Tonlage. Mal klingen auch kurz Takte aus „Tristan und Isolde" oder vom „Fliegenden Holländer" an. Der Auftritt der Zerbinetta ist à la Mozart instrumentiert. Noch größer ist die darstellerische und wortwörtliche Diskrepanz der beiden Frauen. Da steht die tieftraurige Ariadne, die in Berlin zu Recht beliebte Violeta Urmana, auf fast nachtdunkler Bühne, umgeben von schweigenden Damen und Herren, die als Schatten jede ihrer Bewegungen nachahmen. Sie hat also nicht nur ein musikalisches Echo, gesungen von Martina Welschenbach und den Meerjungfrauen Nicole Piccolomini und Burcu Uyar (beim zweiten Auftritt tonschöner als im ersten), sondern auch schemenhafte Doppelgängerinnen. Zerbinetta versucht der Ariadne vergeblich klarzumachen, dass auch anderen Frauen die Männer davonlaufen und dann halt neue kommen. Ariadne, ganz starr in ihrer Trauer - und auch sonst sehr statuarisch – mag davon partout nichts wissen, sie will nur jammernd ins Jenseits. Als nun der junge Bacchus anlandet, meint sie, er wäre der ersehnte Totengott und möchte sofort mit ihm gehen. Erst allmählich begreift sie, dass er ihr neuer Liebhaber wird. Schon sind der ungetreue Theseus und all’ der Kummer über ihn vergessen. Die lebenskluge Zerbinetta hat es ja gleich erkannt, dass diese Ariadne nicht den Tod braucht, sondern nur einen neuen Mann. So einfach ist das. Roberto Saccà meistert die trickreiche Partie des Bacchus angenehmerweise nicht in Heldentenor-Manier, sondern mit feinerer Nuancierung. Doch Strauss hat sich hinreißen lassen. Seine Musik trumpft nun mächtig auf, also doch ähnlich wie bei Wagner. Die Leichtigkeit des Seins der Commedia dell’arte und die Ironie sind passé. Regisseur Robert Carsen stellt jedoch die angestrebte Distanzierung Strauss-Wagner mit zwei gelungenen Einfällen wieder her: Während der rauschenden Schluss-Takte stelzt Zerbinetta in ihren roten Pumps noch einmal über die Bühne und winkt dem Komponisten neckisch zu. Der nun ist es, der glücklich alle Beteiligten wie im richtigen Opernleben zum Applaus auf die Bühne bittet. Frenetisch werden alle gefeiert. Ovationen ernten (erneut) Jane Archibald, Violeta Urmana, Roberto Saccà und Regisseur Robert Carsen. Ursula Wiegand |
|
|
'Ariadne auf Naxos' an der Deutschen Oper Berlin Kritik von Andreas SchubertStrauss-Gourmets finden in Berlin derzeit einen reich gedeckten Tisch vor. Nach einer fulminanten 'Ägyptischen Helena' und prominent besetzten Wiederaufnahmen von 'Elektra', 'Salome' und 'Der Rosenkavalier' servierte die Deutsche Oper nun als letzten Gang der Richard-Strauss-Wochen den buffonesk-mythologischen Repertoireliebling 'Ariadne auf Naxos'. Die heikle Frage, ob die szenische Anrichtung dieses exquisiten Desserts auch den Geschmack der Premierenbesucher treffen würde, stellte sich dabei nicht, denn Robert Carsens Produktion war schon bei den letztjährigen Münchner Opernfestspielen begeistert aufgenommen worden. Die Ovationen der Berliner empfand man trotzdem nicht als vorprogrammiert, sondern als genuine Danksagung an ein Regieteam, dessen Arbeit sowohl das Stück als auch das Publikum ernst nimmt. Tatsächlich ist Carsen eine ausgesprochen elegante Umsetzung von Hofmannsthals Libretto geglückt, in der Elemente der Opera buffa und Opera seria nicht bloß assoziativ durcheinander gewirbelt werden, sondern sich im Spannungsfeld einer quasirealistischen Theateratmosphäre mal kontrastierend, mal komplementär gegenüberstehen. Inszeniert wird nicht das Werk allein, sondern der gesamte (pausenlose) Abend: Wenn die Zuschauer den Saal betreten, probt das Ballet bereits eine Choreographie, die sich der Haushofmeister (herrlich schnöselhaft gespielt von Matthias Bundschuh) dann zur Ouvertüre vorführen lässt, während die Zäsur zwischen Vorspiel und Oper dadurch überbrückt wird, dass der Komponist dem Dirigenten seine Partitur übergibt und die restliche Aufführung nervös von der Seite aus verfolgt. Auch auf der Bühne sind es Details, die Carsens Inszenierung von Anfang bis Ende in würzige Theaterluft hüllen. Im Vorspiel verbreiten die ausgefeilten, mit virtuoser Natürlichkeit ablaufenden Parlando-Gefechte eine chaotische Stimmung, die jedoch suspendiert wird, wenn sich in ariosen Passagen das Seelenleben der Figuren offenbart. Besonders deutlich geschieht dies in der zentralen Begegnungsszene zwischen Komponist und Zerbinetta, die optisch so stark reduziert ist, dass Strauss’ Musik ihre volle suggestive Kraft entfalten kann – an diesem 'einen Augenblick' ist eben nichts gespielt oder arrangiert. Ganz im Gegensatz zur folgenden Oper. In einem dunklen Bühnenraum, dessen Rückwand sich während der finalen Apotheose zu einem blendend hellen Horizont öffnet, apostrophiert Carsen das Geschehen als plakative Inszenierung in der Inszenierung, indem er die theatralischen Gesten von Ariadne und Bacchus durch Tänzer verdoppelt und die Choreographie zur Textausdeutung nutzt, etwa wenn sich klare Formationen in Momenten der Unsicherheit ('Ich weiß nichts mehr') plötzlich auflösen. Die Figuren der Commedia dell’arte agieren wie Chamäleons in diesem artifiziellen Habitat und mischen sich – sehr zum Amüsement des Publikums – auch mal unbemerkt unter die Ballettdamen. So sehr man sich freuen konnte, Carsens 'Ariadne' in Berlin zu erleben, so problematisch erwies sich ihre Einrichtung für ein anderes Haus in klanglicher Hinsicht. Anders als im Prinzregententheater, dessen kompakte Akustik einen offenen, weitgehend leeren Bühnenraum problemlos kompensieren kann, gingen die Stimmen in den Parkettweiten der Deutschen Oper teilweise unter. Verschärft wurde die Lage durch Jacques Lacombe, der es versäumte, sein Dirigat an diese besonderen Gegebenheiten anzupassen und die Partitur wenig differenziert und oft viel zu laut herunterspielen ließ. Opfer dieses Missverhältnisses wurde vor allem Ruxandra Donose, die den Komponisten einfühlsam gestaltete und mit sahnigem Mezzo-Timbre ausstattete, sich in der Höhe aber durchweg zum Forcieren gezwungen sah. Eine Sängerin wie Violeta Urmana konnte das Orchester freilich nicht in Bedrängnis bringen. Nach verhaltenem Beginn fand sie spätestens in Ariadnes Monolog 'Es gibt ein Reich' zu gewohnt grandioser Form und flutete den Saal mühelos mit ihren leuchtenden, perfekt platzierten Spitzentönen. Obwohl Urmana nun schon seit fünf Jahren im (hoch)dramatischen Sopranfach reüssiert, zeigt ihre Stimme keinerlei Verschleißerscheinungen und ist nach wie vor zu feinsten Nuancierungen fähig – ein Trumpf, den sie in der gefürchteten, sich mit einem Oktavsprung zum hohen ‚b’ aufschwingenden Piano-Phrase 'Und ging im Licht' souverän ausspielte. Etwas weniger Strahlkraft und Flexibilität brachte Roberto Saccà mit, der als 'junger Gott' Bacchus zwar eine ausgezeichnete Figur machte und auch alle geforderten Töne in anständiger Qualität ablieferte, sein im Kern lyrisches Material hierfür aber mit einigem Aufwand zurechtbiegen musste. Zum szenischen Fixpunkt der Aufführung wurde die Zerbinetta von Jane Archibald. Die junge Kanadierin überzeugte durch ihr blendendes Aussehen ebenso wie ein extrovertiertes, quicklebendiges Portrait der schillernden Verführerin, das in der Showstopper-Arie 'Großmächtige Prinzessin' in einem dreifachen Hochseilakt kulminierte: dem Stolzieren auf roten Pumps mit Zehnzentimeterabsatz, dem Balancieren auf den Händen zehn muskulöser Unterwäschemodels und dem Bewältigen der haarsträubenden Gesangslinie. Zweifellos gelang auch letzteres beeindruckend gut. Archibald verfügt über einen duftigen, sehr beweglichen Koloratursopran, für den Triller und Dynamikwechsel in der Stratosphäre jenseits des hohen ‚c’ ein Kinderspiel zu sein scheinen. Nur eine gleichmäßige Fokussierung in der Mittellage und den letzten Rest Staccatibrillanz vermisst man noch. Die kleineren Partien waren mit Hauskräften auf unterschiedlichem vokalen Niveau besetzt, wobei Nicole Welschenbachs klangvolle Dryade als Positiv- und Lenus Carlsons mehr gesprochener als gesungener Musiklehrer als Negativbeispiel herausgegriffen seien. Carsens Inszenierung schaffte es jedoch, dieses Gefälle weitgehend zu nivellieren, so dass sich am Ende das Bild einer vitalen, durchweg erfreulichen Ensembleleistung einprägte. |
|
|
Le Strauss Wochen alla Deutsche Oper di Berlino Successo alla Deutsche Oper di Berlino della rassegna straussiana con la rara "Elena Egizia" e l'"Ariadne" vista da Carsen
Può capitare solo nei teatri di repertorio che, grazie alla copiosità di titoli normalemente offerti al pubblico durante la stagione, si creino stimolanti percorsi tematici. È il caso delle Strauss Wochen alla Deutsche Oper di Berlino, che fra gennaio e febbraio hanno offerto una significativa panoramica del teatro musicale straussiano attraverso titoli noti e frequentemente eseguiti e un’interessante riproposta. "Elena Egizia", probabilmente la meno riuscita delle opere del sodalizio Strauss-Hofmannstahl nonostante l'impegno e l’entusiasmo profuso del librettista e la rigogliosa vena melodica del compositore, ha troppi spunti che tuttavia non sembrano integrarsi in un disegno unitario convincente. Per superare i limiti di una drammaturgia sbilanciata e frammentata, Marco Arturo Marelli la immagina in un bordello esotico, cornice nella quale re Menelao rielabora il trauma della guerra e dell'uccisione di Paride e celebra l'amor coniugale con Elena, complici la ruffiana Aithra con la sua corte di colorate maitresse e compiacenti ufficiali di marina. Al tocco esotico della scena (dello stesso Marelli), Andrew Litton aggiunge la sua preziosa direzione musicale solo in parte sostenuto da un cast nel quale le voci maschili latitano e convincono davvero solo la robusta Elena di Ricarda Merbeth e la petulante Aithra di Laura Aikin. Pienamente riuscita anche l'altra novità della rassegna, cioè l'"Ariadne auf Naxos" firmata da Robert Carsen, che arrivava a Berlino a soltanto qualche mese dal debutto al Prinzregententheater di Monaco di Baviera. Spettacolo di esemplare semplicità, fatto di corpi e sui corpi degli interpreti che con la semplice forza dei gesti disegnano ambienti e modulano i registri del tragico e del comico. Formidabile la compagnia - completamente rinnovata rispetto a Monaco - con Violeta Urmana, Arianna di spessore tragico, Jane Archibald, strepitosa Zerbinetta, e Roberto Saccà, Bacchus dai begli accenti lirici. Ricca di colori anche la briosa direzione di Jacques Lacombe, che contribuiva in maniera deterninante al successo della serata. Interessanti anche le tre riprese a cominciare dall'accoppiata fra la straussiana "Elektra" e la "Cassandra" di Vittorio Gnecchi, interessante combinazione di temi classici e accenti veristi fra Mascagni e Puccini. Il racconto del ritorno di Agamennone dalla guerra di Troia e del suo massacro davanti agli occhi di un’Elettra bambina è concepito pertinentemente come 'prequel' dalla regista Kirsten Harms che sfrutta lo stesso ambiente - uno spazio oppressivo rinchiuso fra tre alte pareti e coperto di terra - per le due opere per sottolinearne il legame ideale e le simmetrie (e del resto le due opere si aprono con quasi lo stesso motivo). Musicalmente più riuscita la seconda parte della serata per un cast complessivamente più omogeneo e la solida direzione di Kazushi Ono, più a suo agio con i furori straussiani. Per l'occasione la Deutsche Oper rispolverava, dopo qualche anno di assenza dalle scene, anche la "Salome" stralunata ed espressionista di Achim Freyer, lontanissima dalle morbose atmosfere decadenti di Oscar Wilde. Spettacolo riuscito solo a metà, soprattutto per le debolezze di un cast che aveva in Manuela Uhl una troppo debole protagonista e ripescava un esagitato Chris Merritt per Erode. Chiudeva la rassegna un vecchiotto "Rosenkavalier" firmato da Götz Friedrich nel 1993. Cast onesto e bilanciato guidato dall’esperienza del veterano Peter Schneider sul podio. Il pubblico numeroso (specie per le novità) ha salutato con calore i vari spettacoli. Un plauso particolare va dato all'Orchestra della Deutsche Oper, sempre all'altezza della sfida che la densa e sempre mutevole scrittura straussiana pone agli esecutori, protagonisti in buca al pari della scena. Gli spettacoli continuano fino al 27 febbraio. Stefano Nardelli |
|


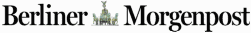





 Mittwoch, 11. Februar 2009
Mittwoch, 11. Februar 2009







