|
DEUTSCHE OPER Ricarda Merbeth singt die Titelrolle in der Strauss-Oper „Die Ägyptische Helena" VON UWE FRIEDRICH
Die Prophetin Aithra befragt gleich zu Beginn der Oper „Die Ägyptische Helena" ihre „allwissende Muschel", und die verrät ihr, dass Menelaus auf einem Schiff seine untreue Gattin Helena ermorden will. Das klingt komisch und war ursprünglich von Richard Strauss auch so gemeint. Sein Librettist Hugo von Hofmannsthal lieferte allerdings einen mythenschweren, arg bildungsbürgerlichen Text, so dass aus dem Operettenplan des Garmischer Komponisten nichts wurde und er stattdessen einen „griechischen Wagner" für großes Orchester schrieb. Da ist es nur folgerichtig, dass die Sopranistin Ricarda Merbeth sich an die Titelrolle der „Ägyptischen Helena" wagt. Schließlich hat sie über mehrere Jahre in Bayreuth die Elisabeth im „Tannhäuser" unter Christian Thielemann gesungen und hatte als Elsa im „Lohengrin" weltweit großen Erfolg. In den letzten Jahren kamen nach und nach auch die großen Strauss-Partien hinzu: Daphne, Chrysothemis, Marschallin, Salome. „Diese Rollen mit ihren weitgespannten Linien kommen mir sehr entgegen. Die Frauenrollen in den Opern von Richard Strauss sind miteinander verwandt, auch wenn sie sehr unterschiedlich sind. In der Arbeit mit dem Regisseur finde ich dann einen Weg, die Rolle zu charakterisieren. Marco Arturo Marelli liebt das Stück und kennt die Musik genau. Dafür bin ich sehr dankbar." Ebenso wie von den Sängern erwartet wird, dass sie ihre Rollen bei Probenbeginn genau einstudiert haben, erwartet Ricarda Merbeth von einem Regisseur, dass er nicht erst auf der ersten Probe ins Textbuch schaut und dann improvisiert. „Gerade bei meinen Strauss-Rollen habe ich bisher allerdings großes Glück gehabt. Wenn ein Regisseur gegen die Musik inszeniert, kann das einen Sänger von den eigenen Gefühlen ablenken. Dann wird es schwierig." Für das Publikum stehe sie auf der Bühne, betont die Sängerin bemerkenswert ernsthaft, nicht zur bloßen Selbstverwirklichung oder um die vermeintlich originellen Ideen eines Produktionsteams umzusetzen. „Ich fühle das Publikum im Saal, ich spüre seine Resonanzen auf der Bühne. Das ist ein wunderschönes Geben und Nehmen." Dabei bleibt Ricarda Merbeth eine sehr selbstkritische Künstlerin, die nur selten mit sich selber zufrieden ist. „Das kommt aber in letzter Zeit öfter vor", lacht sie laut. „Ich habe immer wieder mit sehr guten Dirigenten, Sängerkollegen und Regisseuren gearbeitet. Da steigen auch meine Ansprüche an mich selbst. Singen ist ein lebenslanges Suchen, immer mit Hoffnung auf Perfektion. In diesem Beruf darf man keine negativen Gedanken aufkommen lassen, um aus dem Geschenk der Stimme das Beste zu machen." Die Rolle des Dirigenten kann dabei gar nicht hoch genug bewertet werden, und so wünscht sie sich vor allem Dirigenten, die ihr sehend zuhören: „Gute Dirigenten merken, wenn ein Sänger etwas mehr Zeit für eine Phrase benötigt oder in einer Passage ein schnelleres Tempo braucht. Auch hier hatte ich immer wieder großes Glück. Wir wollen ja schließlich auch gemeinsam musizieren." Auch wenn die Proben und Aufführungen noch so gut laufen, ist das Sängerleben längst nicht so glamourös, wie sich das mancher Fan vorstellt. Auch im besten Hotel ist man nicht zu Hause, während der Probenphase ist jede Sängerin allein in einer fremden Stadt. Dennoch hat Ricarda Merbeth nie daran gezweifelt, dass dies der richtige Beruf für sie ist. „Ich habe angenommen, was mir geschenkt wurde", sagt die Sopranistin, die seit frühester Kindheit tief in ihrem Glauben verwurzelt ist und Kraft und Ruhe aus der Gewissheit zieht, geliebt zu werden. „Mir ist sehr bewusst, dass nichts im Leben selbstverständlich ist. Als Sängerin muss man sich in einer Balance befinden, um seelisch und körperlich gesund zu bleiben, vor allem stimmlich. Ich liebe diesen Beruf. Häufig in Hotels zu leben, gehört einfach dazu. Wenn dann der Vorhang aufgeht und die Musik in ihrer Größe zu strömen beginnt – das ist ein großartiges Gefühl." Premiere 18.1., 18 Uhr. Weitere Vorstellungen 22. u. 30.1., jeweils 19.30 Uhr |
|
Sonntag: Klassik Das Goldfieber grassiert an der Deutschen Oper. Das Haus holt ein lange vergessenes Fundstück aus den Schatzkammern des Opernrepertoires ans Licht. "Die ägyptische Helena" von Richard Strauss. Die Musik der Oper ist über jeden Zweifel erhaben. Doch dem Libretto von Hugo von Hofmannsthal warf man immer wieder dramaturgische Schwächen vor. Es ist leicht, die Geschichte als unlogisch und ein bisschen albern abzutun. Marco Arturo Marelli sieht aber ein bewegendes Psychodrama hinter der Zauberopernfassade. In seiner Inszenierung steht nicht die Titelfigur im Mittelpunkt, sondern König Menelas, der nach dem trojanischen Krieg verstört durch die Fremde irrt. Der Züricher Regisseur glaubt daran, dass Strauss und Hofmannsthal in ihrer 1928 uraufgeführten Oper auch die Schrecknisse des Ersten Weltkriegs darstellen wollten. Er lässt Menelas eine Trauma-Therapie durchleben, bei der Drogen eine wichtige Rolle spielen. Der Amerikaner Robert Chafin und die Chemnitzerin Ricarda Merbeth übernehmen die Hauptpartien bei der Neuproduktion im Rahmen der Richard-Strauss-Wochen. |
|
Oper Von Klaus Geitel Die "Ägyptische Helena" war nie gut zu Schiff. In den 80 Jahren ihres Dahinkreuzens im Opernrepertoire ist sie nie und nirgends fest vor Anker gegangen - und dies trotz ihrer beiden namhaften Kapitäne: Richard Strauss und Hugo von Hofmannsthal, der weltweit gefeierten Dioskuren der Oper. Aber nun plötzlich dieses Wunder: Das beinahe schon verstoßene Werk erlebt in der Deutschen Oper einen unangefochtenen Triumph. Es erntet Begeisterung. Endlich einmal hat das bislang schier unentbehrliche Buh gründlich Pause. Selbst Marco Arturo Marelli, den Regisseur, der sein eigener Bühnenbildner ist, empfängt nichts als uneingeschränkten Jubel. Seine Regiesicht hat tendenziell dazu geführt, dass er beim Publikum international beliebt ist, von den Spezialisten gern auch übersehen wird. Seine bildnerische Seher-Fähigkeit wird dann als oberflächlich gedeutet. Debussys "Pelléas et Mélisande", ein Dreieckskonflikt im Untergang einer Familiendynastie, die 2004 an der Bismarckstraße ihre gefeierte Premiere hatte, verlegte Marelli in einen riesigen finsteren Bunker. Eine Mixtur aus Phantom der Oper und unterirdischer Toteninsel. Und damit für jedermann deutbar. Als er, der Strauss-Kenner, angerufen wurde, um "Die ägyptische Helena" zu machen, gibt Marelli zu, musste er sich erst einmal die CD besorgen. Er kannte das Stück nicht. Zumal die ziemlich erfolglose Strauss-Oper seit dem Zweiten Weltkrieg nur drei Mal richtig inszeniert worden sei. Irgendwie muss gerade diese Vergeblichkeit Marellis Jagdinstinkt geweckt haben - ihm schwebt nichts Geringeres vor, als die "Helena" in den Repertoirebetrieb hieven zu wollen. Trotz des schwierigen Librettos von Hofmannsthal. "Nein, es ist kein Meisterwerk", sagt Marelli: "aber es ist das Werk eines Meisters." Und außerdem: Ein Regisseur müsse immer die Stärken und Schwächen eines Stückes kennen, um am Ende die Stärken herauszustellen. In den zweiten Akt hat er selbst kräftig umstellend eingegriffen. Vermutlich hat auch der Bühnenbildner in ihm wieder ein Machtwort gesprochen. Die Oper spielt an einem orientalischen Wohnort, der sich in den beiden Akten gleichsam in Kriegsraum, Zauberort und Paradies verwandelt. Das Mobiliar ist zerstört oder schwebt, das Bett wird zum Drogenraum. In gewisser Weise wird das Bett bei Marelli, der vor einiger Zeit seinen Hauptwohnsitz von Wien nach Berlin verlegt hat, wohl auch zur Roten Couch, denn er will für seine Inszenierung den Wiener Psychoanalytiker Sigmund Freud bemühen. Die Botschaft der Inszenierung: "Die Menschen sollen sich gegenseitig helfen, ihre Traumata zu überwinden." Das Operntrauma ist schnell umschrieben. Menelas, der Mann, kommt aus dem Krieg heim; Helena, die Frau, ist fremdgegangen. Er glaubt, alle Männer umbringen zu müssen, die sich ihr nähern. Sie muss verdrängen. Der Weg einer Annäherung, die Möglichkeit der Vermittlung werden in der neuen Inszenierung durchgespielt. Das Trauma des Krieges ist zeitlos, immer aktuell, glaubt Marelli, und verweist auf die Heimkehrer aus dem Irak-Krieg oder Afghanistan. Die würden auch mit Drogen und Therapien behandelt. Sagt Marelli, trinkt seinen To-Go-Papp-Café aus und will auf die große Bühne zurück. Es gibt noch einiges zu tun bis zur Premiere am Sonntag. Er arbeite gerne am Haus, betont der Regisseur, aber mittlerweile sei die Probenarbeit mühsam, weil die Kapazitäten des Opernhauses ausgereizt seien. |
|
DAS INTERVIEW
„Ägyptische Helena feiert einen Triumph" titelte eine Berliner Zeitung. Sie haben die Kritiken gelesen? Ja, aber mein Mann liest die Kritiken zuerst. Zwischen zwei Vorstellungen soll man sich „positiv halten!" Wie gehen Sie mit Erfolg um? Ich freue mich selbstverständlich über Erfolg, aber dann gehe ich weiter. Ich bin sehr selbstkritisch, also arbeite ich viel mit mir und meinen Tönen, und ich weiß, dass ein Sänger nie „fertig" ist. Man ist immer dabei, etwas zu verbessern, etwas auszuarbeiten und zu verändern. Warum bin ich Sängerin? Ich singe für das Publikum und habe sehr viel Freude dabei, wenn es diesem gefällt. Das ist für mich das Wichtigste. Sonst könnte ich auch etwas Anderes machen. 2009 feiern Sie Ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum. Sie haben am 8. Januar 1989 an der Städtischen Bühne Magdeburg debütiert mit einer Wagnerrolle – die Roßweiße in der "Walküre" –, was wohl ein Omen für Ihre weitere gesangliche Laufbahn war. Mittlerweile haben Sie sieben Jahre am „Grünen Hügel" gesungen, 2000 in der Neuproduktion vom "Ring des Nibelungen" in der Regie von Jürgen Flimm und von 2002 bis 2007 die Elisabeth im "Tannhäuser" unter Christian Thielemann. Welche Beziehung haben Sie zu Bayreuth? Die Bayreuther Zeit hat mir wahnsinnig viel gegeben, und ich bin sehr dankbar, dass ich die Bayreuther Festspiele erleben durfte. Die Bühne ist etwas ganz Spezielles und Wunderbares. Sie ist sehr groß, und die Akustik ist fantastisch. Ich habe natürlich auch Christian Thielemann viel zu verdanken, weil er mich damals für die Elisabeth engagiert hat. Die Bayreuther Festspiele haben mich künstlerisch sehr geprägt. Sie leben in einer sonnigen Wohnung mit Blick über die Dächer der Wiener Innenstadt. Über dem Klavier hängt Ihr Porträt, gemalt von Ihrem Gatten, Mads Svendsen-Merbeth, der Kunstmaler ist und hier sein Atelier hat. Sie haben in Wien ein neues Zuhause gefunden? Ja, ich lebe hier in Wien mit meinem Mann und unseren beiden Hunden, und das Heim ist sehr wichtig für mich, um Kraft zu schöpfen und zur Ruhe zu kommen. Mein Mann ist ja auch viele Jahre Sänger gewesen. Wir haben uns in Magdeburg kennen gelernt, wo er in den "Meistersingern" den Stolzing gesungen hat und ich die Eva. Er hat eine wunderschöne Tenorstimme. Dadurch, dass er viele Jahre gesungen hat, unterstützt er mich sehr in meiner Karriere und in meinem Leben. Sie haben vor kurzem eine CD mit den "Vier letzten Liedern" und den „Brentano-Liedern" von Richard Strauss aufgenommen, die auf großes Echo gestoßen ist.
Besteht bei Wagner nicht die Gefahr, dass die Stimme in einer gewissen „Tessitura", d. h. Lage, ermüdet, wenn sie lange darin beansprucht wird? Ich werde nie müde in der Stimme...(sie lächelt). Die Partien, die ich singe, sind für mich eher dankbare Partien und gleichzeitig große Herausforderungen. Maria Callas sprach immer von „der Callas" und „Maria". Zu ihrer Stimme hatte sie ein gespaltenes Verhältnis und meinte, die Stimme würde sie gelegentlich „verraten" oder „im Stich lassen". Was haben Sie für ein Verhältnis zu Ihrer Stimme? Ich bin natürlich wahnsinnig dankbar für alles, was ich stimmtechnisch gelernt habe, das ist keine Frage, aber als Sänger gibt es einen gewissen Punkt, wo man „sich selbst" finden soll. Wenn die Callas so von ihrer Stimme sprach, ist das schade. Das ist eigentlich traurig. Foto: Das Opernglas / Olah |
|


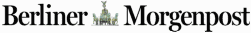

 Als „ Ägyptische Helena" feierte sie an der Deutschen Oper Berlin einen persönlichen Triumph und gleichzeitig ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum. Karin Wolfsbauer traf die sympathische Sängerin in Wien. Ausschnitte aus dem Gespräch.
Als „ Ägyptische Helena" feierte sie an der Deutschen Oper Berlin einen persönlichen Triumph und gleichzeitig ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum. Karin Wolfsbauer traf die sympathische Sängerin in Wien. Ausschnitte aus dem Gespräch. Ja, die Strauss-Lieder habe ich schon öfter gesungen, und ich liebe sie sehr. Die Brentano- Lieder habe ich in Moskau gesungen und letztes Jahr in einem Liederabend auf die Initiative „Lied. Bühne" von Direktor Ioan Holender in einer Kooperation der Wiener Staatsoper mit dem Wiener Musikverein. Das ist eine wunderbare Sache, und ich war sofort begeistert dabei.
Ja, die Strauss-Lieder habe ich schon öfter gesungen, und ich liebe sie sehr. Die Brentano- Lieder habe ich in Moskau gesungen und letztes Jahr in einem Liederabend auf die Initiative „Lied. Bühne" von Direktor Ioan Holender in einer Kooperation der Wiener Staatsoper mit dem Wiener Musikverein. Das ist eine wunderbare Sache, und ich war sofort begeistert dabei.