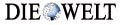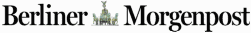|
Peter Ruzicka für Hölderlin-Oper in Berlin gefeiert Berlin (dpa) - Den Eklat gab es vor der Premiere: Weil der frühere Intendant der Berliner Staatsoper Unter den Linden, Peter Mussbach, seine Textvorlage entstellt sah, hatte er in letzter Minute seinen Namen aus dem Programmheft streichen lassen. Doch trotz Querelen und Drohung mit dem Anwalt - am Sonntagabend ging wie geplant die Oper "Hölderlin. Eine Expedition" über die Bühne. Für den Komponisten und Dirigenten Peter Ruzicka wurde es ein großer Erfolg. Mit "Celan" hatte Ruzicka vor zwei Jahren viel Kritikerlob bekommen. In seinem zweiten Werk für das Musiktheater kehrte er zu einem Dichter zurück. Wer eine musikalische Biografie erwartete, gar einen Einblick in den in geistiger Umnachtung vollzogenen Rückzug des schwäbischen Dichtergenies in den Tübinger Turm, wurde enttäuscht. Oper eigne sich nicht für Biografien, hatte der frühere Intendant der Salzburger Festspiele zuvor wissen lassen. Hölderlin (1770-1843), in seinen jungen Jahren ein Bewunderer der Französischen Revolution und Freund der Philosophen Hegel und Schelling, tritt als Zeitdiagnostiker an. Er begleitet 13 Menschen auf eine Reise durch 150 Jahre Geschichte. Die Gestalten (gesungen unter anderem von Dietrich Henschel, Stephan Rügamer, Carola Höhn und Anna Prohaska) werden sekundiert von ebenso vielen griechischen Göttern. Sie bekommen nach einer Katastrophe die Chance, ihr Leben neu zu beginnen. Dabei bleibt ihnen nichts ausgespart: Die Zeit der Revolutionen, der Nationalsozialismus, die Studentenrevolte - sogar die Klimakatastrophe der Zukunft. In der Hölderlin-Welt wie sie Regisseur Torsten Fischer und Bühnenbildner Herbert Schäfer geschaffen haben, ist es vor allem nass. "Und einmal sah ich noch in die kalte Luft der Menschen zurück und schauerte und weinte vor Freuden", leitet zu Beginn ein Zitat aus Hölderlins "Hyperion" in die eisige Tiefe. Ein großes Becken nimmt fast die ganze Bühne ein, durch das die Menschen knöcheltief waten, stolpern oder laufen. Manchmal regnet es von der Decke auf das triste Dasein, das sich vor dem Hintergrund von gigantischen Sozialbauten entfaltet. Verwahrloste Menschen suchen nach einem Halt, den sie aber weder bei den vielen Göttern noch bei dem Einen bekommen. "Wir durchlaufen alle eine exzentrische Bahn", heißt es bei Hölderlin, der schon sehr früh geahnt hatte, wie sehr der Bruch der Moderne mit den alten Gewissheiten seine Spuren in der geistigen Verfassung der Menschen hinterlässt. Ein Madonnengemälde reißen sie zu Boden, schleifen es über die Bühne - Gott ist tot, menite bereits Hölderlin. Aus den Untoten auf der Suche nach dem besseren Leben werden wechselweise Sozialfälle und Kindermörder, die Götter mutieren zu Effizienzaposteln, die im Managerslang mit Begriffen wie "Synergieeffekte" oder "Clustergespräche" um sich werfen. Lyrisch kann man Mussbachs Text nicht wirklich nennen. Es ist eine zuweilen derbe, direkte Sprache, in der das "F-Wort" zwar nicht vorkommt, dafür aber Sabine Christiansen und Franz Beckenbauer. Ruzicka und Fischer dürften nach einem Gegengewicht zu soviel Sprachballast gesucht haben und bauten noch einige Hölderlin-Zitate ein - zu Mussbachs Verdruss, der auch andere Striche und Hinzufügungen im Text nicht hinnehmen wollte. Es könne doch nicht falsch sein, Hölderlin in einer Hölderlin-Oper zu zitieren, hatte Ruzicka gekontert. Dramaturgische Tricks lenken vom simultan eingeblendeten Text ab. Ein roter Faden durch die Jahrzehnte fehlt - es sind die Gestalt der neu geschaffenen Hölderlin-Figur des Empedokles und der Dichter selbst, die sich als Lotsen dieser Expedition durch das beschädigte Leben anbieten. Versehrte im Rollstuhl, eine Kinder mordende Mutter der Soldaten in SS-Uniform - die Bilderflut löst Rätsel aus, Hölderlins Dichtung machen sie nur sehr grobkörnig sichtbar. Angesichts der Irrungen und Wirrungen bietet Ruzickas Musik Halt: Etwas Wagner, ein wenig Mahler, gleißend-kalte Geigentutti. Hochfrequenztöne und Perkussion verleihen Schärfe. Als sich am Ende zu den Unisono-Violinen die Götter von der Welt verabschieden, entgleiten die Menschen in die Utopie der Schwerelosigkeit, in ein unbeschädigtes Leben, in dem es wohl auch keine Anwälte gibt. Mussbach, der vor sechs Monaten im Streit mit Generalmusikdirektor Daniel Barenboim und dem Regierenden Bürgermeister und Kultursenator Klaus Wowereit (SPD) die Staatsoper verlassen hatte, will nun vor Gericht prüfen lassen, ob sein Urheberrecht verletzt wurde. |
|
Leben im Gegenuhrzeigersinn Zwölf Jahre ist es her, seit der deutsche Komponist und Dirigent, Jurist und Intendant Peter Ruzicka als Nachfolger von Hans Werner Henze die Leitung der Münchener Biennale für neues Musiktheater übernommen hat. Der Wechsel in der Leitung stand auch für eine grundlegende ästhetische Veränderung. Während Henze auf zwar gegenwärtige, aber doch sinnliche und fassliche Oper gesetzt hatte, richtete Ruzicka den Blick ganz auf abstraktes, keinem Erzählstrom verpflichtetes Musiktheater. Ganz in diesem Geist postulierte er mit der Konzertreihe "Passagen" im Rahmen der von ihm geleiteten Salzburger Festspiele im Sommer 2005 eine "Zweite Moderne". Die Postmoderne mit ihrer Beliebigkeit lasse sich, so Ruzicka, im 21. Jahrhundert nicht mehr weiterdenken, eine neue ästhetische Ausrichtung tue not, und dabei dürfe der Begriff des Fortschritts wieder zu seinem Recht kommen. Ideenreich Das sind klar lesbare Wegweiser – und darum kam der Uraufführung von Peter Ruzickas zweiter Oper in Berlin besondere Bedeutung zu. Zusätzliche Aufmerksamkeit erhielt das Projekt dadurch, dass Peter Mussbach, Librettist wie schon bei "Celan", der ersten Oper Ruzickas, als Intendant der Staatsoper Unter den Linden entlassen worden war und auch als Regisseur der Uraufführung nicht mehr zur Verfügung stand. Weil Torsten Fischer, der neue szenische Leiter, den Text an drei Stellen ergänzt hatte, liess Mussbach nach einem über die Medien ausgetragenen Streit seinen Namen auf dem Besetzungszettel streichen und eine Anmerkung einfügen, dass er die gespielte Fassung nicht billige. Die Pressestelle der Lindenoper gab den Berichterstattern zudem ein Blatt mit den hinzugefügten Textstellen ab. Ruzicka selbst gab seinem Erstaunen über Mussbachs Verhalten Ausdruck; es handle sich da um Freiheiten der Interpretation, die sich Mussbach als Regisseur oft selbst genommen habe. Wie auch immer: "Hölderlin", so der Titel des Stücks, bleibt "Hölderlin" – vor allem in der Hinsicht, dass es in dieser Oper in keiner Weise um Hölderlin geht. Mussbach und Ruzicka arbeiten bloss mit Texten Hölderlins. Zudem ist der Dichter als Figur auf der Bühne präsent, ebenso wie Empedokles, dem Hölderlin ein grosses, unvollendetes Drama gewidmet hat. Gezeigt wird, in weitgehend pantomimischer Darstellung, eine Gruppe von Menschen, die sich nach einer nicht näher identifizierbaren Katastrophe auf einem Eisfeld ausgesetzt finden, nach und nach zu Bewusstsein kommen und dann gegen den Uhrzeigersinn in ihr verlorenes Leben zurückkehren: "eine Expedition", so der Untertitel des Werks, in eine zerstörte, später in ihren ursprünglichen Zustand zurückversetzte Grossstadt, in der sich sehr heutiger Alltag voll von Egoismus und Brutalität abspielt. Wie in Max Frischs Stück "Biografie" stehen diese Menschen vor der Frage, wie sie ihr Leben lebten, könnten sie es noch einmal leben. Sie bleiben ratlos und gelangen dafür im vierten und letzten Akt in ein Elysium, in dem Zeit und Raum aufgehoben scheinen, in dem sich aber doch die vier Jahreszeiten ereignen. Auf unterschiedlichste Weise wird hier mit der Zeit gespielt. Angehalten wird sie, scheinbar, oder zum Zurücklaufen gezwungen – womit das zentrale Problem angesprochen ist. Wie soll das Musiktheater auf das Erzählen einer Geschichte verzichten, wo doch der prozesshafte Charakter von Musik in jedem Fall Zeit vergehen lässt und aus sich selbst heraus Geschichten erzeugt? Ruzicka setzt hier auf die musikalischen Möglichkeiten des Diskontinuierlichen, ja Fragmentarischen. Auf drei Ebenen scheint sich die Musik von "Hölderlin" zu entwickeln, und unentwegt gleitet man von der einen auf die andere Ebene. Immer wieder erklingt aus dem üppig besetzten, auch mit reichem Schlagwerk versehenen Orchester eine tiefe, warm instrumentierte Dominante, die in einen Trugschluss mündet – ein Anklang an Wagner, zum Beispiel an den "Parsifal". Ebenso oft kommt es zu heftigen Schlägen: zu Eruptionen im Schlagwerk, zu mächtigem Glockenklang, zu dissonanten Ballungen von schmerzhafter Schärfe. Und dann bleibt die Musik aber auch gerne wieder stehen, liegt mit einem Mal eine sirrende Fläche über der Bühne. Wenig Sog Das ist alles, man merkt es auf Anhieb, blendend erdacht und virtuos erfunden – nur strahlt es wenig aus. Die angehaltene und zur Umkehr gezwungene Zeit, sie wird einem bisweilen doch arg lang. Der im Gedankenlabor angerichtete Versuch entwickelt wenig sinnliche Attraktion, wenig von jenem Sog, den ein gelungener Theaterabend unbedingt braucht. Dazu kommen ein Tonfall und eine szenische Anmutung, die, wenn überhaupt, mehr an die Erste als die Zweite Moderne denken lassen. Die dreizehn Schauspieler neigen zu einem Dauerschreien, das einen bald strapaziert, und auch die dreizehn nicht mit Rollen, sondern anonymen Chiffren bezeichneten Vokalsolisten, unter ihnen der Bariton Dietrich Henschel, pflegen den getragenen Ton der lieben alten Oper. Der musikalische Gestus ist nicht frei von Spuren der Alterung, und wenn dann noch zum Mittel des Sprechchors gegriffen wird, faltet sich die Stirn erst recht in Runzeln. Auf der opulenten, von Herbert Schäfer mit einem echten Wassergraben versehenen Bühne wird unter der Anleitung des anstelle von Peter Mussbach engagierten Regisseurs Torsten Fischer nach Massen gehüpft, gerannt, gezerrt und gerungen – auch davon hat man bald genug. Bleiben der Staatsopernchor und die Staatskapelle Berlin, die sich unter der Leitung des Komponisten tapfer schlagen. Mag sein, dass die Umstände der Uraufführung an der Berliner Lindenoper nicht die besten waren – der Verdacht bleibt, dass Peter Ruzickas "Hölderlin"-Expedition im Büchergestell enden wird. PETER HAGMANN |
|
Oper
Die deutschsprachige Musikprominenz saß in der Berliner Lindenoper und verfolgte die Uraufführung des neuen Musiktheaters von Peter Ruzicka. Nur der Regisseur, Ex-Intendant und Librettist des aus der Taufe gehobenen Werks, Peter Mussbach, der das Haus vor einem halben Jahr nach Intrigen im Zorn verlassen musste, war nicht erschienen. Oder war er inkognito gekommen, um beim Schlussapplaus einige Male die Scheinwerfer auszuknipsen, damit das Produktionsteam während der gepflegt gelangweilten, von ein paar müden Bravo- und Buhrufen durchsetzten Publikumsreaktionen vorübergehend im Dunkeln stehen musste?
Vor der Premiere hatte Mussbach, der die Uraufführung ursprünglich hätte inszenieren sollen, ein Skandälchen angezettelt, indem er seinen Namen zurückzog von einem Werk, das er in den Fingern eines anderen Regisseurs angeblich nicht mehr wiedererkannte. Ausgerechnet Mussbach, dem als Regisseur der aktualisierende Geist seiner eigenen Inszenierungen stets um einiges heiliger zu sein pflegt als der schnöde Buchstabe einer Oper von Mozart oder Berg oder Henze, will nun vor Gericht prüfen lassen, ob sein Urheberrecht verletzt wurde. Zank um Autorenrechte Dabei müsste er doch wissen, dass Peter Ruzicka, der nicht nur Komponist, Ex-Intendant der Salzburger Festspiele und Leiter der Münchner Musiktheater-Biennale ist, sondern auch ein studierter Jurist, und der als solcher, wie es der Zufall will, ausgerechnet über das Urheberrecht promoviert hat, das Libretto sicher nicht ungeprüft um drei kleine Einfügungen erweitert hätte. Aber vielleicht ist alles ganz anders, und der läppische Zank um Autorenrechte und künstlerische Freiheiten diente einzig und allein dem Zweck, dem Werk schon vor der Uraufführung mediale Beachtung zu sichern. Dies vermutete nach dem Premierenbesuch jedenfalls einer der anwesenden namhaften deutschen Komponisten - womöglich weil er meinte, das Werk habe eine solche Reklame auch nötig.
„Hölderlin. Eine Expedition" ist Ruzickas zweites Werk auf ein Libretto von Mussbach. Wie schon in der 2001 uraufgeführten Oper „Celan" wollten die Autoren auch jetzt erklärtermaßen keine klingende Dichter-Biographie auf die Bühne bringen. Worum es ihnen stattdessen geht, das wird indessen zwei lange Stunden über nicht recht klar und lässt sich am ehesten wohl mit dem Begriff Weltanschauung umschreiben. Um diese - eine bedeutungshuberisch kritische, unbequeme, sensible, gutmenschenhafte - zu transportieren, erfinden Ruzicka und Mussbach so etwas wie eine neue, negative Schöpfungsgeschichte. „Gott ist", das versteht sich, ganz nietzscheanisch „tot". Nach einer „nicht näher definierten Katastrophe", so führt Ruzicka aus, ,,erhalten dreizehn Personen die Möglichkeit, ihr Leben ein zweites Mal anzugehen". In diesem zweiten Leben diene Hölderlin als ein „Kompass". Es gehe, so fasst Ruzicka zusammen, „um die Sehnsucht des Menschen nach Einheit mit sich und der Natur, mit sich und der Welt". Pack schlägt sich, Pack verträgt sich Auf der Bühne geht das in Torsten Fischers Inszenierung so: Dreizehn Personen plus noch einmal dreizehn Personen suchen eine Handlung - und sehnen sich hauptsächlich nach trockenen Füßen, weil sie den ganzen Abend in einer Riesenpfütze waten müssen, die das Bühnenbild von Herbert Schäfer ausmacht. Jene, die gelegentlich singen, heißen M1 bis M7 (darunter Dietrich Henschel, Arttu Kataja, Stephan Rügamer) oder F1 bis F6 (Anna Prohaska, Carola Höhn und andere). Jene, die hauptsächlich brüllen und nach guter Stadttheatermanier fluchen, sind Schauspieler, die griechische Götter darstellen sollen - was man aber nicht erkennen kann.
Miteinander halten sie es nach dem Spruch „Pack schlägt sich, Pack verträgt sich", um die Verderbtheit der Menschheit darzustellen. Wenn es einen Toten gibt, ist immer schnell ein kleiner Junge zur Stelle, der sich weinend auf ihn legt. Manchmal stellt sich jemand an die Rampe, damit Stellen, die besonders aufrütteln sollen, auch wirklich ankommen: etwa die mit mahnendem Blick ins Publikum zitierte Nachricht über ein Kind namens Zicke, das die Eltern im Kinderzimmer verhungern ließen. Qualmiger Textschwall Abgesehen davon, dass Hölderlin keine Auskunft mehr darüber geben kann, wie es sich anfühlt, als Kompass gebraucht zu werden, gehen die verwendeten Zitate aus seinem Werk in den qualmigen Strudeln des Mussbachschen Textschwalls auch unter - in Szenen, die „Transzendentale Obdachlosigkeit" oder „Der kollektive Abgrund" oder „Das schnadernde Gedränge. Die tränenvolle Welt. Winkel des Trugs" heißen. Und auch Ruzickas Musik scheint selten etwas Besonderes an Hölderlins Sprache zu entdecken. So wünscht man immer wieder, das viele Gequatsche und frei atonale Parlando auf der Bühne und die sich mal in parsifaleskem Pathos, mal in aktionistischer Kleinteiligkeit, dann wieder in bedeutungsschwangeren Unisono-Strecken der Violinen ergehende Redseligkeit im Graben möchten für einen Moment verstummen - damit man die über die Übertitelungsanlage huschenden Hölderlin-Texte ungestört lesen könne.
Ruzickas Partitur breitet ein Arsenal relativ fest umrissen wirkender Ausdruckslagen in immer neuen Wiederholungen aus. Da gibt es ein wagnerisch klingendes Schicksalsmotiv, das schon am Anfang der Oper erklingt, atemlos gehetzt und abgehackt nebeneinandergesetzte Bläserfiguren, hochsymbolische Farbwirkungen mit Xylophon, Tam-Tam, Gralsglocken und Gongs und immer wieder diesen leer und melodisch vage tönenden, aber hohe Expressivität suggerierenden Unisonogesang der Violinen. Nur im dritten Akt plötzlich, in der Szene „3.3. Empedokles", hört man eine längere Passage Musik, die viel prägnanter klingt. Sie erinnert aufs Haar an eine symphonische Skizze von Alban Berg. Ob der Komponist Ruzicka sich dessen während des Kompositionsprozesses wohl bewusst war? Immerhin dürfte der Jurist Ruzicka im Kopf gehabt haben, dass die Urheberrechte an dieser Skizze seit 2006 frei sind. JULIA SPINOLA |
|
Oper Von Manuel Brug In der Opernwelt der Hauptstadt kracht es gern. An der Staatsoper zerstritten sich Komponist Peter Ruzicka und der entlassene Intendant Peter Mussbach über das Stück "Hölderlin. Eine Expedition". Jetzt ist das Werk zu sehen: Eine wüste Geschichte über Sex, Philosophie, Apocalypse. Ein Untergang. Kaum ein deutscher Komponist, nicht einmal Wolfgang Rihm, ist so gut vernetzt wie der ehemalige Berliner, Hamburger, Salzburger und gegenwärtige Münchner Intendant Peter Ruzicka (60). Weil viele ihm einen Gefallen schulden, wird er regelmäßig aufgeführt. Und so kamen sie nun alle, die Beweger und Schüttler des Musikbetriebs, die Verleger, Stipendienauslober, Festivalleiter, Theaterchefs, Presselobbyisten, vor allem auch aus seinen früheren und aktuellen Arbeitsorten, in der Berliner Lindenoper zusammen, um seiner jahrelang angekündigten „Hölderlin"-Oper zu huldigen. Kritiklos, aber auch ein wenig pflichtschuldig war nach zwei pausenlos öden Stunden der Beifall, freilich gewürzt von ein paar hartnäckigen in ihrer Emotionalität fast schon befreienden Buhs. Schimpftiraden per E-Mail Im unmittelbaren Vorfeld war diese Uraufführung zudem angeheizt worden durch die öffentlich geführten juristischen Scharmützel, die sich der Librettist und vor einem halben Jahr demontierte Lindenopern-Intendant Peter Mussbach mit seinem ehemaligen Arbeitgeber über Veränderungen im Text lieferte. Das reichte bis zu peinlichen, am Premierentag verbreiteten E-Mail-Schimpftiraden zwischen Mussbach und Ruzicka, bei denen letzterer den „verbalisierten Drogentrip" seines Textlieferanten online abbrach und eine ehemalige Männerfreundschaft wohl endgültig in Trümmern aufging. Mussbach hatte zudem im „Hölderlin"-Programmzettel wie auch auf der Staatsopern-Webseite seinen Namen zurückziehen lassen; für die übrigen Drucksachen wie für den Beamer am Bebelplatz, der auf der Gebäudeseitenwand das Abendprogramm ankündigt, langte das aber nicht mehr. So war außen Mussbach noch drauf, aber innen offiziell keiner mehr drin. Was immer noch zu viel scheint. Glücklicherweise hat niemand Mussbachs ausufernde Regieanweisungen zu diesem unausgegorenen, sich in dandyhaftem Weltekel zwischen Hölderlin und Houellebecq wälzenden Apokalypse-Szenario vorgetragen. Denn alle die von der Hochsprache zum Gossenjargon switchenden Worthülsen und Gemeinplätze dieses sinistren Reigens zwischen Rentnermord vor dem Fernseher, Endzeitstimmung im Fitnessstudio, im Swingerclub oder in der Arktis kann man höchstens gequält lächelnd als eine kleine Küchentischphilosophie vom Untergang des Abendlandes abtun. Kein Ätna, nirgends Da Kollege Bruno Maderna sich bereits 1964 beim „Hyperion" bedient hat, musste nun der „Der Tod des Empedokles" mit weiteren Zitattrümmern, sowie Beckett und Rilke als Textbausteinlieferanten herhalten. Kein Ätna, nirgends, wohinein man dieses wie zähe Lava klebenden Bedeutungswust aus zusätzlichen, nicht gesprochenen Zitaten und absurd-albernen Szenenanweisungen hätte entsorgen können. Ursprünglich war als Regisseur ebenfalls Mussbach vorgesehen. Der eiligst engagierte Torsten Fischer stand dem Ganzen hilflos gegenüber. Uninspiriert, aber routiniert wurde sich hier einer so undankbaren wie unmöglichen Visualisierungsaufgabe entledigt. Herbert Schäfer lieferte austauschbare Versatzstücke geklonter Wohnwaben als Begrenzung und das bei Untergängen obligatorische Wasserbecken für die immer gut kommenden Nasseffekte. Andreas Janczyk holte aus dem Fundus bourgeoise 19. Jahrhundert-Garderobe für die von Dietrich Henschel als pathosgesättigtem Ersatz-Empedokles angeführten 13 anonymen, aber aufopferungsvoll ausgefüllten Sängerrollen. Die hinzuerfunden 13 Schauspieler, die die vorhanden, aber auch weitere, von Mussbach abgelehnte, den Wortwirrwarr freilich verständlicher machende Hölderlin-Verweise sprachen, sowie eine Statistenschar trat mal im schwarzer Uniform mal im aktuellen Freizeitlook auf. Eine Madonnen-Ikone wurde herabgelassen und durchs Wasser gezerrt, Gitter protestgeschwungen. Meist aber ertrug dieses Placebo-Menschengeschlecht starr stehend oder liegend sein feuchtes Opernschicksal. Es geht ums Opernganze Peter Ruzicka, der an diesem drögen Abend auch am Pult der animiert folgenden Staatskapelle vorstand, will bei „Hölderlin", wie auch schon 2001 bei seinem ersten „Celan"-Musiktheaterversuch in Dresden, keine schnöde Klangbiographie, sondernd das große Opernganze. „Ein Experiment" nennt er vorsichtig, sein sich jeder Historie vom umnachteten Philosophenschriftsteller im Tübinger Turm verweigernde Versuchsanordnung. Stattdessen muss Hölderlin vom langatmigen Instrumentalprolog bis zum endlosen Jahreszeiten-Epilog mit drei Touristinnen als ganz weit oben angesiedelter hochkultureller Kronzeuge für aktuellen, natürlich nur verklausulierten Weltschmerz herhalten. Dem aber kann der Komponist tönend nichts wirklich Originelles, Anrührendes, oder wenigstens Aufrüttelndes entgegenhalten. Noch nie hat sich Peter Ruzicka als so etikettenlos und glatt, so ungreifbar, vielleicht auch unangreifbar präsentiert wie in diesem Stück. Der teilweise elektronisch aufgepeppte „Hölderlin" mit seiner gewöhnlichen, im Perkussionsapparat ausgeweiteten Orchesterbesetzung, reflektiert wie ein seelenloser Scanner die Möglichkeiten heutigen Komponieren. Er fügt ihm aber nicht hinzu, ja er hat nicht einmal einen eigenen Sound. Hier wurden fleißig und mit viel Clusteraufwand Fertigteile aus dem Klangbaumarkt, Abteilung Kuschelavantgarde zusammenmontiert, überzogen mit einer teflonartigen Lamentoschicht, die mit ihren unisonoartigen Streicherflächen sediert. Das reiht sich so dahin, reift nie zur geschlossenen Form, entwickelt aber auch keinen rauen Reiz des Fragmentarischen. Genauso wenig wie Text und Inszenierung die anvisierten Revolten und Katastrophen mit ihren schatten- wie folgenlosen Politiker-, Manager und Rebellenschemen bis hin zur Klimaklimax in den dramaturgischen Griff bekommen, gelingt der Musik eine klare Haltung oder wenigstens ein tönender Anstoß. Das alles bleibt so feinsinnig verkopft, dabei so brav konventionell, dass es kalt lässt. Hölderlin wird zwar nicht in seinem steinerneren Gefängnis sichtbar, aber der isolierte Elfenbeinturm des zeitgenössischen deutschen Musiktheaters mauert diese aufgeplusterte Todgeburt von Anfang an ein. Komm ins Geschlossene, Feind, mag man dem höchstens zurufen. Termine: 21., 25., 29. November, 2. Dezember; Karten: (030) 20 35 45 55 Photos
|
|
Oper Uraufführung als Hindernislauf: Peter Ruzickas „Hölderlin" an der Berliner Lindenoper. VON CHRISTINE LEMKE-MATWEY
Im schönen Mittelfranken dürfte das Kulturradio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg schlecht zu empfangen sein, jedenfalls nicht über UKW. Wie hat Peter Mussbach – der geschasste Intendant der Berliner Staatsoper und Librettist auch der zweiten Oper von Peter Ruzicka – also bei sich zuhause den Sonntagabend verbracht? Ein leckeres Schlückchen zur Linken, ausreichend Rauchwerk zur Rechten, die Füße hoch und genüsslich der rbb-Liveübertragung von Ruzickas „Hölderlin" am Laptop gelauscht, dem sanft kakophonisch gründelndem Wagner-Mahler-Berg-Mix aus dem Orchestergraben, dem schütteren Applaus am Ende, den notorischen Buhs für die Regie? Weit gefehlt. Zum einen liegt Mussbach alles Gelassene und Gemütliche von Haus aus fern. Zum anderen kann man ihm angesichts des nun zu besichtigenden Ergebnisses den Furor nicht verdenken, mit dem er bis zuletzt versucht hatte, diese Uraufführung, nun ja, zu ramponieren. Zur Erinnerung: Als Mussbach vor einem halben Jahr sein Intendantenbüro Unter den Linden räumte, trat er notgedrungen auch von der „Hölderlin"-Regie zurück. Torsten Fischer sprang ein, ehedem Direktor des Kölner Schauspiels, und machte sich seine eigenen kreativen Gedanken über den schwäbischen Dichter Hölderlin und dessen Griechenträumen, über den deutschen Idealismus und was uns in unserer verkorksten, verhetzten, vernetzten Zeit überhaupt noch metaphysische oder wenigstens spirituelle Autorität sein mag. 13 Götter in Gestalt von 13 Schauspielern (zusätzlich zu den 13 Sängerinnen und Sängern, darunter bewährte Kräfte wie Stephan Rügamer, Simone Nold oder Carola Höhn) resultierten aus diesen Überlegungen sowie vier weitere Hölderlin-Zitate nebst minimalen Kürzungen im Text. Mussbach schäumte, zog schließlich seinen Namen zurück und will nun auf „Verletzung des Urheberrechts" klagen. Die Lindenoper scheint dies nur mäßig zu beeindrucken. Sowohl die Leuchtschrift an der Fassade des Knobelsdorffbaus als auch das Libretto im Programmheft nennen Mussbach nach wie vor. Der schmallippige Rest beschränkt sich auf den Hinweis, dass die „Berliner Fassung" des Werks vom Librettisten Mussbach so „nicht autorisiert" sei. Ob das reicht, rechtlich, haben andere auszumachen als die beiden studierten Juristen und ehemaligen Busenfreunde Peter R. und Peter M.. Müßig, darüber zu spekulieren, ob der Abend unter Mussbachs eigener Regie womöglich ein glücklicherer geworden wäre. Sein wie auch immer endender Protest ist – nur zu verständlich – persönlichen Verletzungen geschuldet: Daniel Barenboim, der mit den Achseln zuckte, als Wowereit seinen Intendantenvertrag nicht verlängerte; und, schlimmer noch, Ruzicka, der ihm die Treue brach, als er eben nicht mit auszog in die Wüste, sondern ehrgeizig auf seiner Uraufführung beharrte. Hart ist die Kunst. Die an- und herbeigerufenen 13 Götter indes vermochten Torsten Fischer nicht recht beizustehen. Wie das schlechte Gewissen der deutschen Romantik höchstselbst wandeln sie zu Beginn in Frack und Zylinder durchs Geschehen respektive knöcheltief durchs Wasser (was Bühnenbildner Herbert Schäfer dazu wohl gedrängt haben mag?), mal erwecken sie Tote zum Leben, mal verknäueln sie sich mit diesen zu einem Laokoon verdächtigen Haufen an der Rampe oder radeln in Rollstühlen umher. Überhaupt dominiert an diesem Abend, als wär’s mehr eine Messe, ein oratorisches Ritual, das kollektive Schreiten: von hinten nach vorne, von links nach rechts. Ermüdend. Die behauptete Verortung des Ganzen im Hier und Jetzt begreift man frühestens im zweiten Akt, wenn sich die seitlichen Prospekte eines Plattenbaus samt Wäscheständern und Satellitenschüsseln mehr in die Mitte schieben. Und wer hier was von wem will, die Menschen von den Göttern, die Götter von den Menschen, Hölderlin (mit angestrengter Inbrunst: Dietrich Henschel) von seinem Empedokles (Markus Gertken), Empedokles von Hölderlin, wir alle von der Oper des 21. Jahrhunderts, die(se) Oper von uns, das begreift man zwei pausenlose Stunden lang überhaupt nicht. Eine „Expedition" – so der Untertitel – ins wattige weiße Rauschen eines gewiss nicht mager dotierten Auftragswerks. Ein Regisseur Mussbach hätte zweifellos mehr auf die Szenen abgehoben, die der Librettist Mussbach gleichsam wie versiegelte Kokons des Handgreiflich- Realen in den Hölderlinschen Hallraum implantiert hat. Szenen, die, nun ja, im Swingerclub spielen oder im Mediamarkt, vor der Glotze, im Großraumbüro, im Bus, im Pflegeheim. Oft grässlich banal in ihrem Sprachduktus wie vor allem im Versuch, einer neuerlichen Sprachfindung beizuwohnen („FARC. DHKP. RCD. UDA. LURD. KLO. ANO ..."), manchmal aber auch witzig. Dramaturgisch mag der Text oft wirr sein, ja unzurechnungsfähig: Eine szenische Umsetzung wie die von Torsten Fischer, in der alles über den gleichen raunenden Kunstleisten geschlagen wird und in der niemals klar wird, wer wann singt und wer es wann warum gerade nicht tut, hat er in all seiner Hybris nicht verdient. „Hölderlin" spielt, so erklärt es die Inhaltsangabe, „an einem Unort ... nach einer zerstörerischen Katastrophe". Munter läuft die Zeit rückwärts, um dann plötzlich doch wieder vorwärts zu preschen, die Menschen verjüngen sich und altern und fragen, was wäre, wenn sie ihr Leben noch einmal leben könnten. Ähnliches muss auch den 60-jährigen Komponisten Peter Ruzicka umgetrieben haben, der sich nach einer „Celan"-Oper 2001 in Dresden (ebenfalls auf ein Mussbach-Libretto) nun mit „Hölderlin" dem zweiten „Fixierungspunkt" seines künstlerischen Denkens nähert. Die ästhetische Wegstrecke vom einen Werk zum anderen (in der der Auch-Dirigent, Auch-Musikmanager Ruzicka hauptsächlich mit der Leitung der Salzburger Festspiele befasst war) ist flugs zurückgelegt. „Celan" verstand sich als Oper über den Holocaust und kam ohne ein einziges Wort Celans aus. In „Hölderlin" hingegen wird sehr wohl auch Hölderlin vertont (aus dem „Tod des Empedokles", aus „Hyperion", aus „In lieblicher Bläue"): Weil der eine Dichter mehr Raum für Musik lässt als der andere, weil es leichter ist, die „Vaterländischen Gesänge" zum Klingen zu bringen als eine „Todesfuge", weil das Fragmentarische, das Prozesshafte bei Hölderlin nichts anderes abbildet als ein musikalisches Prinzip selbst? Mutmaßungen, denen Ruzickas Musik wenig Kerniges entgegenzusetzen hat. Der Stoff scheint mehr in einen symphonischen Malstrom eingebettet, als dass er dramatische Gestalt annähme. Hier ächzt es wie im „Wozzeck", dort klimpern Schlagwerk und Klavier fast pfingstwunderlich, da singen schülerdünne Geigen Empedokles den Trauermarsch. Jenseits aller rhythmischen Erregungszustände und jeden summenden, sphärischen Schweigens aber hat Ruzicka es auf ekstatische Leidausstülpung abgesehen. Das Streicher-Unisono im höchsten Diskant samt nachfolgendem, harmonisch ausgereiztem Tutti, das kann in den besten Momenten eine Art ozeanisches Grauen erzeugen. Oft ist es freilich auch nur Filmmusik, nur Querschnitt durchs Material der Moderne. Die chorischen Verdichtungen wiederum überzeugen auf Anhieb, ebenso die Staatskapelle (unter Leitung des Komponisten) mit ihrer Präzision und Lust. Am eindücklichsten gewiss: der Schluss, jenes irrwitzig lange Decrescendo-Flirren, das keine Musik mehr ist. Mussbachs letztes Wort, auch dazu? „Schöne Einsamkeit." Wieder am 16., 25., 29. November. |
|
Uraufführung Von Klaus Geitel Die Uraufführung war skandalumweht: Der Ex-Intendant drohte seinem alten Arbeitgeber, der Deutschen Staatsoper, rechtliche Schritte an und zog seinen Namen zurück. Jetzt ist es trotzdem vollbracht: Am Sonntagabend ging die Oper "Hölderlin/Eine Expedition" über die Bühne. Ein „Auftragswerk der Staatsoper Unter den Linden" – so liest es sich im Programmheft des Hauses, nicht ohne Stolz, anlässlich der Uraufführung des „Hölderlin". Peter Mussbach, vor Zeiten noch Intendant der Oper, hat diesen Auftrag, verantwortungsfroh und voller Gottvertrauen, an Peter Ruzicka, den Komponisten, Dirigenten, Festival-Manager, weitergereicht. Quasi im Gegenzug hat sich Ruzicka für Mussbach als Librettisten seines neuen Werkes entschieden. Was in der Wirtschaftspolitik möglicherweise vor Gericht geführt hätte, schlüpft in der Kulturpolitik unabgestraft durch, wenn auch sozusagen mit roten Ohren. LEDIGLICH RESPEKTVOLLER ERLÖSUNGSJUBEL Sie wären nicht einmal besonders aufgefallen, hätte Mussbach, inzwischen seines Postens an der Staatsoper verlustig gegangen, sich nicht über einige Änderungen in seinem Libretto (und über Torsten Fischer, den Ersatz-Regisseur) empört und prompt versucht, seinem Ex-„Hölderlin" auf dem sowieso steinigen Bühnenweg unvorhersehbare Schwierigkeiten zu machen, als habe der arme Hölderlin auf seinem tragischen Lebensweg nicht schon reichlich genug zu erdulden gehabt. Aber mit Hölderlin und seinem Leben hat das nach ihm benannte Bühnenwerk sowieso wenig zu tun, außer, dass es sich zitatweise seiner Lyrik bedient. Es geht ja bei dieser „Expedition", wie Ruzicka sein Musiktheaterstück im Untertitel genannt hat, um weit mehr als die biographische Aufarbeitung eines Dichterlebens. Es geht, zusammengedrängt auf vier pausenlos in einander übergehende Akte, um eine Art Biographie der Menschheit: ihre Errettung durch Götterhand vor dem sicheren Untergang, ihre Abkehr von den Rettern, ihren Dauerstreit, ihre Dauerangst, ihre eher beklemmenden Hoffnungen. Es setzt anschaulich gemachte Philosophie, serviert in fein abgeschmeckter, kennerisch aufbereiteter musikalischer Sauce. Keine Frage: Drei Sterne für „Hölderlin"! Nur kann sich das neugierige Ohr an Ruzickas durchaus bewunderungswürdiger Kunstleistung nicht gerade satt essen. Es bleibt auf seinem Appetit lange und bange sitzen. Es versucht, sich in das Neuland, das diese „Expedition" unter Ruzickas ungemein verständiger Leitung durchpflügt, durchaus geduldig einzuhören. Es durchsitzt artig und kunstergeben die pausenlos zweistündige Aufführung. Es muckst keinen Augenblick auf. Am Ende rafft es sich auf zu einem geradezu freundschaftlich respektvollen Erlösungsjubel. Ruzicka sieht sich gefeiert. Er hat es verdient. Seine Musik bläst nie musikdramatisch die Backen auf. Sie bleibt eher aphoristisch, beschränkt sich auf geistvolle Einwürfe, Unterstreichungen, Ausrufungszeichen. Sie führt Instrumentationskünste vor, die von der Staatskapelle mit ausgezeichnetem Sachverstand realisiert werden. Stets bleibt Ruzicka geschmackvoll am Ball. Doch diesen Ball gibt es nicht immer. Er verschwindet unter dem inszenatorischen Hin und Her, zu dem Torsten Fischer das um 13 Schauspieler aufgestockte vorzügliche Sänger-Ensemble treibt, an seiner Spitze markant Dietrich Henschel. Fischer treibt es geradezu mit Vorliebe durch immerfort hoch aufspritzende Pfützen. Die Menschheit steht bis zu den Knöcheln sozusagen im Dauerregen. Herbert Schäfer hat dem Geschehen wie dem Nicht-Geschehen die höchst sehenswerte, immer kregele Bühne gebaut, deren Nacktheit in immer wechselndem Licht eindrucksvoll zu leuchten, wenn auch nicht immer einzuleuchten versteht. Am packendsten gelingt die Nachzeichnung des Menschenelends unter der Diktatur, auch der des Krieges mit ihren anrollenden Panzern, den Verhaftungswellen, der namenlosen Ängste. In diesen Szenen des 3. Aktes nehmen Ruzicka, Mussbach und Fischer im düsteren, von Projektionen durchwaberten Verein die Aufmerksamkeit voll gefangen. Es setzt Pessimismus pur. AM ENDE TUT SICH DAS HIMMELSTOR AUF Ruzicka singt der Menschheit das Hohe Lied der Hoffnungslosigkeit. Er komponiert beklemmende Bilder. Immer wieder heißt es: „Was geht denn hier vor? Das darf doch nicht sein!" Aber es vollzieht sich dennoch, wenn auch vor erschrockenen Augen. Die Menschheit bekommt sich, wie im Leben so auch in Ruzickas verstörendem Musiktheater, nicht in den Griff. Wenn am Ende dieses langen Tages bitterer Reise in die Nacht dennoch lyrisch bewegte Violinstimmen sich in immer höheren Diskant hinaufsingen, als wollten sie der Menschheit zumindest das Himmelstor aufsperren, klingt diese unvermutete, plötzliche Sanftheit wie eine schöne Lüge aus dem heiligen Hölderlin-Fundus. Staatsoper Unter den Linden 7, Berlin-Mitte. Tel.: 030-20354555. Nächste Aufführungen: 21. 25. und 29. November. Photos
|
|
Aber was soll's Peter Uehling In den 70er- und frühen 80er-Jahren, als man das Wort "Verstörung" noch ohne Ironie aussprechen konnte, wurden allüberall "Hölderlin-Fragmente" komponiert, die späten, inhaltslosen Jahreszeiten-Gedichte zu Kassibern des Tiefsinns umgedeutet, und selbst das Streichquartett Luigi Nonos war dank in die Partitur geschriebenen Hölderlin-Zitaten mehr als ein Streichquartett. Friedrich Hölderlin wurde mit seinen lyrischen Fragmenten und seinem Scheitern im Wahnsinn zu einem der künstlerischen Leit- sterne einer ganzen Komponisten-Generation. Es klingt somit nach einer gewaltigen Verspätung, wenn Peter Ruzicka erst jetzt ein Musiktheater "Hölderlin. Eine Expedition" komponierte und am Sonntag in der Staatsoper Unter den Linden uraufführte. Wer allerdings ein biografisches Musiktheater im Stil der damaligen Innerlichkeit erwartete, wurde enttäuscht. Der Dichter und seine Sensibilität sind im 21. Jahrhundert nicht mehr szenisch darzustellen, weil seine seismografischen Leiden und "Verstörungen" seit ihrem Boom vor 30 Jahren erfolgreich vergesellschaftet und längst von den plumpen "Problemen" des Talkshow-Prekariats karikiert wurden: Hier wurde der leidende Mensch zur seriellen Spottfigur, die bewusstlos, aber nicht weniger zerstörerisch, vom gesellschaftlichen Zerfall benagt wird. Also bringen Ruzicka und sein Librettist Peter Mussbach gleich die gesamte "verstörte" Menschheit auf die Bühne, und Hölderlin darf der sein, der er immer sein wollte: Der Kompass in eine andere Welt, in eine Welt der - und jetzt kommt ein Wort, das man auch nicht mehr ohne Ironie gebrauchen kann, aber Mussbach und Ruzicka versuchen es dennoch - "Spiritualität". Die allerdings braucht eine Weile, ehe sie zum Zuge kommt. Die ersten drei Akte des zwei pausenlose Stunden dauernden Werks bauen die Welt auf und ab. Der erste zeigt mythologische Szenen, in der die Götter die Menschen aus einer nicht weiter genannten Katastrophe retten und diese den klassischen Zivilisationsprozess durchlaufen - ein erster Mord, Sprachverwirrung, Religion und ihr Sturz. Der zweite Akt fasst es konkreter und reiht Szenen aus unserer Gegenwart aneinander, wir sehen unsere überalterte, fitness-, konsum- und sexbesessene Gesellschaft, und endlich gibt es auch auf der Opernbühne Szenen, die im Kaufhaus, im Swingerclub und in der Muckibude spielen. Die Inszenierung Torsten Fischers malt diese Szenerien nicht eigens aus, sondern zeigt sie innerhalb eines unaufhörlich ziehenden Menschenstroms. Und den dritten, "Transzendentale Obdachlosigkeit" überschriebenen Akt, verlegt Fischer in ein totalitäres Regime, das die Menschen mit einer geschwätzigen Revolution am Ende stürzen. Hier und da eingelegte Hölderlin-Zitate sollen den geistigen Niveau-Unterschied zwischen uns und damals markieren. Im vierten Akt wandeln die Götter durch eine friedliche Landschaft und singen die späten Jahreszeiten-Gedichte - das soll dann die spirituelle Utopie sein. Es gibt keine Personen in dieser Dramaturgie, der eine Schauspieler, Markus Gertken, der Hölderlin-Zitate spricht, könnte immerhin Hölderlin sein, und der eine Sänger, Dietrich Henschel, singt vor allem Zitate aus Hölderlins "Empedokles", jenes Philosophen, der mit der Natur eins wurde, indem er sich in den Ätna warf. "Hölderlin" versucht sich an einem Welttheater, am ganz großen Entwurf - und endet als witzlose Kabarettnummer. Es ist ein Abend von knieschlotternder Unkräftigkeit, und das noch am wenigsten von Seiten der Regie, die Peter Mussbach so entstellend dünkte, dass er seinen Namen aus der Produktion gestrichen sehen wollte. Um der Konkurrenz mit Hölderlin aus dem Weg zu gehen, schreibt Mussbach Trivialdialoge. Sie dürften zu den unerwünschtesten Errungenschaften der Librettistik seit den Wagnerschen Stabreimen gehören: "Du bist nicht ehrlich zu mir. Und du hast eine andere!" - "Und da steht dein Stecher. Aber was soll's." - "Gott sei Dank, dass wir nicht verheiratet sind." Und Ruzicka, der auch dirigierte, unterlegt dem auf weite Strecken eine sehr wiederholungsselige Bühnenmusik, deren seit 30 Jahren bewährte Expressiv-Bausteine weder das Ganze tragen noch den Moment prägen können. Ausgehend von einem Bruchstück, das aus der Auslaufrinne des "Parsifal"-Vorspiels gefischt scheint, baut Ruzicka die Felder ziemlich vorhersehbar auf. Typische Beeindrucker wie der dissonante Bläserakkord, die große Violinkantilene oder der bedeutsam einsetzende Basston vermögen derart stereotyp eingesetzt nicht mehr zu beeindrucken. Im letzten Akt gerät die Musik kurz in Fluss, und das Zaghafte daran berührt auch für einen Moment. Schließlich ist es eine Musik, die den Sängern wenig Material gibt. Für Henschel ist die Partie oft zu hoch. Die Frauen, vorab Simone Nold, Anna Prohaska und Carola Höhn, können ihre Stimmen in gemäßeren Lagen präsentieren, fallen aber dennoch mangels kompositorischer Differenzierung in die Reihen des 13-köpfigen Ensembles zurück. Aber es fehlen nicht nur die formenden Kräfte. Das ganze Konzept macht keinen funktionstüchtigen Eindruck. Es scheint ja, als wollten Ruzicka und Mussbach ein musiktheatralisches Bild der Gegenwart geben. So wird etwa in einer Szene des zweiten Akts die Geschichte von Jessica aus Hamburg-Jenfeldt erzählt, die von ihrer Mutter in einem dunklen Verschlag eingesperrt wurde bis sie verhungerte. Wie Boris Groys feststellte, entstehen die großen Symbole für den Zustand der Gegenwart nicht mehr in der Kunst, sondern in den Medien. Die von den Medien immer wieder variierte Erzählung von Eltern, die ihre Kinder vernachlässigen, verhungern lassen oder gleich umbringen, ist das umfassendste Symbol für die tiefen deutschen Zukunftsängste und den verlorenen Glauben an den Sinn der Generationenfolge. Diese symbolische Kraft hat die Erzählung aber eben nur als Erzählung - im Kontext dieses nicht-erzählenden Musiktheaters steht sie als ein Beispiel unter vielen für die dekadente Gegenwart. Die angezapfte Realität muss ihre symbolische Reichweite einschränken, statt sie zu entfalten - wenn aber die Nachricht über eine größere symbolische und auch gesellschaftskritische Potenz verfügt als das Kunstwerk, hat dieses Kunstwerk ein Legitimitätsproblem. Vielleicht kann man das auch alles ganz anders sehen. Schließlich wurde Peter Ruzicka mit Beifall bedacht, während Fischer aufs Stichwort ein paar Buhrufe zu hören bekam. Ruzicka hat als amtierender und ehemaliger Intendant verschiedener Institutionen einen großen Bekanntenkreis. In ihm haben sich schon vor der Uraufführung Leute gefunden, die "Hölderlin" für so bedeutend halten, dass sie ihm 22. November ein Symposium mit sieben Vorträgen widmen. Damit wird innerhalb nur einer Woche das Welttheater akademisch entsorgt. |
|
"Hölderlin - Eine Expedition" VON JÜRGEN OTTEN
Der Dichter schreibt einen Brief an Ebel, der als Anhänger der Revolution in die französische Kapitale gegangen und nun, wir befinden uns am Jahreswechsel 1796/97, vom Paris des Directoire enttäuscht ist. Hölderlin tröstet ihn, formuliert seine Überzeugung, "dass nämlich jede Gärung und Auflösung entweder zur Vernichtung oder zu neuer Organisation notwendig führen muss", und folgert, dass kein Tod in der Schöpfung nur Verwandlung sei, was zugleich die Erneuerungskraft der Völker einschließe: "Man kann wohl mit Gewissheit sagen, dass die Welt noch nie so bunt aussah wie jetzt. Sie ist eine ungeheure Mannigfaltigkeit von Widersprüchen und Kontrasten." Wir wissen: Hölderlin, kam nicht zurecht in dieser Welt; immer weniger, je länger er lebte. Das Menschengeschlecht, wie es sich befand, ließ ihn zurückweichen; er fürchtete, das warme Leben in sich zu erkälten an der eiskalten Geschichte des Tags. Hilfe fand er bei den Göttern Griechenlands, nicht bei den Menschen, aber auch das änderte wenig an seiner eigenen Tragödie, die eine des Sängers und Propheten einer ersehnten, als das Andere einer entfremdeten Welt gesuchten Umkehr war, des verzweifelten Erweckers einer Gemeinschaft, die ihn ohne Antwort ließ. Dies in Klänge zu fassen, scheint ein Ding der Unmöglichkeit. Gleichwohl hat es Peter Ruzicka - der schon Celan 2001 in einer Oper huldigte - versucht. "Hölderlin - Eine Expedition" nennt sich sein zweistündiges Opus, das am Sonntag in der Berliner Staatsoper Unter den Linden (beauftragt von diesem Haus) seine Uraufführung erlebte. Soll man jetzt sagen: nach einem Text von Peter Mussbach? Oder: trotz eines Textes von Peter Mussbach? Oder sogar: gegen einen Text von Peter Mussbach? Man glaubt es kaum, aber drei Passagen, die vom Regie-Team um Torsten Fischer mit dem Einverständnis des Komponisten dem Libretto hinzugefügt wurden (zwei aus "Hyperion", eines aus dem Gedicht "In lieblicher Bläue"), haben genügt, um diesen Dichter der Welt dieser Produktion zu entrücken und zu entfremden. Wutschnaubend ließ Mussbach verlauten, dies sei nicht mehr sein Text, somit sei dies auch nicht mehr seine Produktion. Sprach's und dampfte von dannen, nicht ohne zu verkünden, die nunmehr gespielte Fassung sei nicht von ihm autorisiert. Fraglos eine Posse. Eine Katastrophe aber ist es, die am Anfang der Oper steht. In dunkler Welt, in unbestimmbarer Zukunft, liegen leblos zwölf Wesen im Wasser. Dies die Menschen, dargestellt von zwölf Schauspielern (der dreizehnte mimt den Hölderlin), und im Begriff, das postapokalyptische Dasein zu erkunden, eine neue Sprache zu finden (was misslingt), soziale Bezüge zu erstellen (was ebenso misslingt). Um sie herum ein Empedokles (Dietrich Henschel) und zwölf Götter (sechs weibliche und sechs männliche Gesangssolisten, unter denen Simone Nold herausragt), die allerdings von Andreas Janczyk nicht in mildes Weiß getüncht wurden, sondern als Begräbnisgesellschaft in matt glänzendem Schwarz auf der Bühne (Herbert Schäfer) erscheinen. Aus dem Orchestergraben dringt ein Grummeln, das irgendwelchen Katakomben zu entweichen scheint. Ruzicka ist nicht Lachenmann. Seine Musiksprache orientiert sich mehr oder minder an der Symphonik des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Sie besitzt also stark narrative Züge, sie will breit strömen, untermalen, sie will nach Kräften suggestiv sein. Nimmt man dies als idealischen Zustand zeitgenössischer Musik und nimmt man es als idealisches interpretatorisches Konzept, dass die Staatskapelle unter des Komponisten Leitung ein dichtes Orchester-Espressivo zelebriert, dann hält der Abend in der Lindenoper einige anspruchsvolle eklektische Stellen bereit: Klangflächen, die mit mehreren Schichten pastos übermalt oder auch mal entkernt sind; rhythmische Modelle, die, gleichsam leitmotivisch, bei bestimmten Szenen immer wieder auftauchen; wohl geformte Figuren, die sich momentan in clusterähnliche Aufbauschungen verwandeln; gleichermaßen monoton-kantable wie obsessive Streicherlinien mit weit gespannter Amplitude, wie am Ende der Oper. Es ist eine Musik illustrativen Zuschnitts, die sich kaum scheut, ihren affirmativen Charakter zu offenbaren. Die aber eines vergisst: dass Oper auch heißt, dass Sänger singen, und dass Oper begründet, warum sie singen. In Ruzickas Klangkosmos wird nur deklamiert. Und demonstriert. Die Inszenierung ist von ähnlichem Geist. Aber sie ist bei weitem nicht so geistreich wie Ruzickas Konversationsmusik. Dass sie es nicht ist, hat wiederum mit dem Ausweichen des Librettos vor Hölderlins Wucht zu tun. Bekundet noch der erste Akt ein hohes Interesse an einer tiefer gehenden Auseinandersetzung mit den Topoi Hölderlins, kippt der Text im zweiten Akt ins Triviale weg. Das Bild einer Hochhaussiedlung, das den ganzen Abend über als Bühnenrahmen dient, rückt jetzt zusammen zum Vollbild. Menschen laufen davor hin und her, immer rascher, immer irrer, eine Frau erzählt die grausame (und wahre) Geschichte eines Mädchens, das von seinen Eltern dem qualvollen Hungertod "überantwortet" wurde. Auch Empedokles wird in den Strudel der Ereignisse gerissen, die in ihrer Plakativität jedweden Gedanken an eine Utopie unmöglich machen. Akt drei bringt uns auch nicht weiter. Ein totalitäres Regime ist zu besichtigen, und wie Menschen darin zugrunde gehen. Doch die Wahl der Metaphern ist hausbacken: tiefrotes Licht, eine riesige Skulptur, verängstigtes Personal. Und miserable Dialoge, die weit aus dem Hölderlinschen Kosmos hinaus führen. Immerhin, im Schluss-Akt, dem vierten, keimt etwas wie Hoffnung, Sein und Zeit haben zusammengefunden, da gibt es eine Beziehung zwischen dem, was ist, und dem, was sein könnte, kurz: utopisches Potenzial. Diese schöne Einsamkeit, von der am Schluss die Rede geht. Staatsoper Unter den Linden, 21., 25., 29. November, 2. Dezember. [ document info ] |
|
Flucht aus dem Eis Von Georg Friedrich Kühn Schlagzeilen machte das Werk schon vorab. Der Librettist von "Hölderlin. Eine Expedition", Peter Mussbach, drohte die Aufführung an der Berliner Staatsoper zu kippen. Die Uraufführung wollte er eigentlich selbst besorgen. Nach seiner "Freisetzung" als Intendant im Frühjahr erübrigte sich das. Als Regisseur sonst nicht gerade zimperlich im Umgang mit fremden Vorlagen, glaubte er seinen Text durch den neuen Regisseur Torsten Fischer verfälscht. Der hatte im Einvernehmen mit dem Komponisten Peter Ruzicka an drei Stellen Hölderlinsätze eingefügt, die ihm für seine Sicht wichtig schienen. Mussbach zog mittlerweile seinen Namen von dem Projekt zurück. Die Staatsoper nennt den Abend eine "Berliner Fassung". Die Idee zu der neuen Oper kam Ruzicka nach der gemeinsam mit Mussbach gestalteten ersten Oper "Celan" in Dresden 2001. Konzipiert ist "Hölderlin. Eine Expedition" als eine Versuchsanordnung, die die alte Frage stellt: Was wäre wenn? Was wäre, wenn man sein Leben noch einmal leben könnte? Was würde man ändern? Hier sind es dreizehn Figuren, die nach einer Katastrophe von den Göttern eines imaginären Griechenland wiedererweckt werden und diese Chance erhalten. Hölderlin, seine Philosophie der Selbstfindung, des Eins-Seins mit der Natur nehmen sie dazu als Quasikompass. In seinem Libretto mischt Mussbach eigene Texte, reale Geschehnisse wie die Geschichte jenes Hamburger Mädchens, das die Eltern verhungern ließen, mit Texten von Hölderlin. Der Dichter und seine Kunstfigur Empedokles durchwandern und durchleiden eine ihrer Spiritualität verlustig gegangene Welt bis ins Außerirdische. Ruzickas Musik grundiert das mit "Als-ob-Zitaten", die Romantik assoziieren. Bestimmte "Module" kehren immer wieder: eine Art "Tristan"-Musik am Beginn der Akte, ein Mahler"scher Trauermarsch oder langgezogene Streicher-Unisoni. "Ferne Choräle" der Erinnerung nennt Ruzicka sie. Aufgerissen werden sie immer wieder durch harte Orchesterschläge. Der Regisseur Torsten Fischer und der Bühnenbildner Herbert Schäfer versuchen mit einer der Innerlichkeit Hölderlins entgegengesetzten Turbulenz die Hermetik aufzubrechen, was zunächst auch sinnvoll scheint. Die zylindertragenden Götter fischen anfangs aus einem fast bühnenfüllenden Pfuhl die Menschen, die sie wiederbeleben. Der zweite Akt ist eine Erkundung des beschädigten Lebens zwischen Hochhaussilo und Pflegeheim. Die in dem Pfuhl als Plattform ausgelegten Gitterroste werden im dritten Akt zu Barrikaden gegen eine Diktatur aufgerichtet. Am Ende ist das Hölderlin"sche "geschmolzene Eis" eine Art Lethefluss des Vergessens, durch den hindurch der Bühnen-Hölderlin den Menschen den Weg weist. "Leben ist Tod, und Tod ist auch ein Leben", wie es im Zitat heißt. Über die Schwächen des textlastigen Buchs und der darum meist nur sphärisch-grundierenden Musik kann das nicht hinwegtäuschen. Der zweistündige Abend wirkt langatmig, je länger er dauert, flüchtet sich in Äußerlichkeiten, hat durch die vielen von Schauspielern gesprochenen Hölderlinzitate auch mehr von Melodram und Vorlesestunde als Musiktheater. Offen bleibt auch die Frage, was Utopien heute noch bedeuten können, wo es doch eher ums Überleben geht. Ruzicka will mit seiner gleichsam ins Unendliche ausklingenden Streichermelodie am Schluss das Stück öffnen hin zum Zuschauer und diesem das "Heft des Geschehens", wie er sagt, zurückgeben. Genügt das für ein Nachdenken über Utopie? Durch den Komponisten am Dirigentenpult erhielt der Abend musikalisch gleichwohl hohe Authentizität. Dietrich Henschel ist ein höchst präsenter Hölderlin, vom Publikum wurde ihm am meisten applaudiert. Auch Ruzicka selber und die übrigen Sänger und Schauspieler bekamen freundlichen Beifall. Mussbach zeigte sich nicht. Die Prügel durfte der Regisseur einstecken. Derweil deutet sich Bewegung an bezüglich der Rekonstruktion der Staatsoper. Im Sommer hatte die politische Führung der Stadt wider alle Vernunft den von einer Fachjury prämierten Entwurf von Klaus Roth zu einer Modernisierung des Innenraums kassiert. Nun hat Stephan Braunfels sich an einen neuen Entwurf gewagt, der das äußere Erscheinungsbild des Rokokoinnenraums wahrt, aber durch Modifikationen der Ranggestaltung und Anhebung der Decke die Mängel reduziert. Abzuwarten bleibt, ob die auf eine unhistorische Wiederherstellung des Paulick-Innenraums von 1955 erpichte Denkmalpflege eine solche Variante akzeptiert. Die Zeit rennt davon. |
|
Nach dem Streit mit Peter Mussbach: Peter Ruzickas Oper "Hölderlin" an der Berliner Staatsoper uraufgeführt "Das ist ja hier wie in Sodom und Gomorra!" Der Mann, der das singt, hat recht. Hinter den Kulissen der Berliner Staatsoper Unter den Linden haben sich Komponist und Librettist vor der Uraufführung von "Hölderlin - Eine Expedition" aus konzeptionellen Gründen und wohl auch aus gekränkter Eitelkeit heillos verkracht, und auf der Bühne selbst herrscht Katastrophenstimmung. VON SUSANNE BENDA Die Menschen, verkündet die zweite Oper des Komponisten, Dirigenten und Festivalleiters Peter Ruzicka (60) und des im Streit von der Lindenoper geschiedenen ehemaligen Intendanten und Textdichters Peter Mussbach (59), sind fremd und heimatlos geworden in einer zerstörten, verbauten Natur. Sie wissen weder, wer sie sind, noch, woher sie kommen und wohin sie gehen. Sie heißen je nach Geschlecht M oder F, hinzu kommen Zahlen zur individuellen Unterscheidung, so dass mit M 6 und F 6 die Reihe der Apostel komplett wäre. Hinzu kommt eine Dichter-Figur (Hölderlin?), die das Geschehen kommentiert und poetisch-assoziativ unterfüttert. Wir sehen, wie ein Madonnenbild niedergerissen wird, wir verfolgen in einem Zeitstrudel Lebensstränge zurück bis in banalste Situationen, wir erleben das Scheitern einer Revolution gegen ein totalitäres Regime, und wir entdecken schließlich im vierten Akt zarte Andeutungen, dass ein Neubeginn möglich wäre. "Schöne Einsamkeit", lautet sibyllinisch die letzte Regieanweisung des Textbuchs. Man hört sie nicht, man liest sie nur. Leider fehlt der Messias. Und die Bühne ist wüst und leer. Nur die Prospekte öder Hochhaus-Plattenbauten, mit denen Herbert Schäfer sein Bühnenbild begrenzte, dürfen einmal in sich zusammenfallen. Ihr ausgesprochen ästhetisches Abknicken spiegelt sich dann wirkungsvoll glitzernd im Wasser, das man - ganz im Inszenierungs-Trend unserer Tage - auf die Bühne gießen ließ, auf dass es dort bei jeder Bewegung der Darsteller gluckere und platsche. Vielleicht soll das Element auch eine Aussage treffen wie etwa die, dass hier das Leben wieder an seine Wurzeln zurückkehrt oder so. Man weiß es nicht. Doch dunkel ist in diesem bedeutungsschweren Stück, in dem mehr gesprochen als gesungen und mehr Masse als Individuum gezeigt wird, noch vieles mehr. Das muss wohl auch so sein, denn der Beschreibung der metaphysischen Heimatlosigkeit des Menschen, wie sie hier im freien Spiel mit Gedanken vor allem aus Friedrich Hölderlins "Hyperion" und den "Empedokles"-Fragmenten vorgenommen wird, erwächst eine strukturelle Ziellosigkeit. Diese ließe sich vom Zuhörer über die zwei Stunden Spieldauer hinweg mittragen, denn Peter Ruzicka hat seine feine Partitur, die er selbst dirigiert, aus einer Vielfalt unterschiedlicher, höchst sinnlicher Klangmomente und (vor allem) Klangflächen gewoben, die im Laufe des Abends leicht verändert wiederkehren. Seine hörbar von Mahlers Brechungen der Romantik inspirierte Musik, die mit Erinnerungen an sich selbst wie an die weiter entfernte musikalische Traditionen spielt, macht die Ohren wach und sensibel - auch für die Sehnsucht nach einer Zielgerichtetheit zeitgenössischer Klänge, die zuletzt im postmodern Beliebigen verloren ging. Probleme bereiten das Pathos des Stücks und die Konzeption der Inszenierung. Beides greift ineinander. Torsten Fischer, der nach dem intrigenbedingten Spontan-Abgang des Intendanten als Regisseur für Mussbach einsprang, hat dem bewusst fragmentarisch gehaltenen Libretto, das mit Regieanweisungen förmlich gespickt ist, zusätzliche Texte Hölderlins einmontiert. Zudem hat er den zwölf Sängern zwölf Schauspieler (und dem Dichter ein poetisches Geschöpf) zur Seite gestellt: eine Art antiker Götterschar, welche die Menschen, die sich hier immer wieder zu neuen Haufen ballen, die sich umarmen und umbringen, stärken, stützen und fragend begleitet. So wird der doppelte Boden zum Sicherheitsnetz. Der Beschreibung einer gottlosen Welt entspricht dieses Konzept nun gerade nicht. Und vor allem aber entsteht so eine Art schöner Utopie - ein Traum davon, dass alles doch noch gut werden könnte. Diesem pathetischen Ansinnen arbeitet auch die Partitur zu, wenn sie um Schönheit und Bedeutung ringt und ihr Heil in emphatischen Wiederholungen und Anspielungen sucht. Deshalb ist man am Ende von "Hölderlin" leider nicht klüger als zuvor. Gehört und gefühlt hat man viel Schönes, doch das Musiktheater als Ganzes glückte nicht. Und unbeirrt wirft ein Beamer die Namen von Komponist und Textdichter an die Fassade der Berliner Staatsoper, als sei weiterhin alles eitel Sonnenschein. Dabei fällt uns ein, dass der Regisseur auch einen Satz aus Peter Mussbachs Libretto strich. Diesen nämlich: "Aufhören, Schluss, wer gibt mir, was mir genommen wird, die Schmuddelmaus, die Schmuddelmaus." Peter Ruzicka hatte glatt vergessen, diese zentrale Aussage zu vertonen. |
|
Hölderlin [...] Vermutlich hat Fischer Schauspieler sowie drei kurze Texte nur eingefügt, um diesen szenisch wie musikalisch spannungsarmen Zweistünder und seine verkopfte Erzählstruktur bühnentauglich zu machen - was trotz handwerklicher Souveränität kaum gelingt. Auch die meisten der zahlreichen Bühnenanweisungen ignoriert Fischer bis hin zu dem in Berlin nicht mehr erkennbaren Jahreszeiten-Zyklus des letzten Akts. Eine erstarrte Welt in Eis nach der finalen Katastrophe: Das sieht man nicht, ist aber Ausgangspunkt. Auch für Ruzickas Musik, die mit statischen Chorklängen einsetzt, in die das Orchester eine befremdliche Reminiszenz des Tristan-Vorspiels einschreibt: Gefrorene Liebe. Ruzicka ist ein gewandter Routinier, der Hochglanzklänge schreibt, quirrliges Gewusel entfacht, hohe einsame Streicherlinie nach dem Guten, Wahren und Schönen schreien lässt, Mahler mehr als nur verehrt [...] Das ist eine famos polierte Bühnenbegleitmusik, die der Szene nie Impulse gibt, sondern nur vornehm uneigentlich Stimmungen und Befindlichkeiten ziseliert. Ruzicka & Mussbach sind spätbildungsbürgerliche Moralapostel und bilden Wirklichkeit platt ab. Da hören Jugendliche laute Musik aus einem Ghettoblaster, eine Frau beschwert sich und wird von den Jugendlichen ertränkt. Solche szenische Plattitüden treffen auf musikalische Hölderlin-Inseln, in denen Dietrich Henschel dominiert. Er ist meist Empedokles, der Menschheitsbeglücker, der Revolutionär, der sich aus Verzweiflung über die Geistlosigkeit der Welt in den Ätna stürzt. "In lieblicher Bläue" träumt er von einer versöhnten Welt, von Spiritualität, und Fischer findet im Bild der sich im Kreis um Henschel kuschelnden, brillant singspielenden Bühnencrew eine szenische Entsprechung, die übers Stück hinausgeht. Doch diese Hoffnung ist schlicht behauptet, da durch die vorhergehenden zwei Stunden nicht gerechtfertigt. Kurzer Beifall, auch Buhs für Peter Ruzicka und die Regie. W. SCHREIBER |
|
Nass und trüb ist die Welt VON FRIEDER REININGHAUS Unter Expeditionen werden Forschungsreisen in unerforschte Regionen verstanden, auch militärische Interventionen und Versandabteilungen von Wirtschaftsunternehmen. Kriegerische Abenteuer oder Export von Wirtschaftsgütern dürften Peter Mussbach und Peter Ruzicka freilich nicht im Sinn gehabt haben, als sie den klangvollen Namen Hölderlins nutzten, um eine literarisch-musikalische "Entdeckungsreise" zu konzipieren. Mit "Hölderlin. Eine Expedition" ging ihre Reise in eine "unbestimmte Zukunft" der altgriechischen Götter, zu "beschädigtem Leben" einer unscharf umrissenen Menschengruppe und schließlich in einen extraterrestrischen Raum. Nach dem Erfolg einer Oper über die Biografie des Dichters Paul Celan 2001 in Dresden entschloss sich das Autoren-Duo Ruzicka/Mussbach zu einem Folgeprojekt. Der selbst auch dirigierende Komponist verlängerte seinen Vertrag als Intendant der Salzburger Festspiele nicht, um sich auf die Partitur von "Hölderlin. Eine Expedition" konzentrieren zu können. Mussbach erteilte sich, damals noch als Intendant der Berliner Staatsoper, selbst den Auftrag, als Librettist tätig zu werden und sich dem schwäbischen Dichter auf zeitgemäße Weise zu "nähern". Wie schön. Seit dem späten 18. Jahrhundert haben Gedichte wie "Stille", "An Diotima", "Empedokles", "Hälfte des Lebens", das "Schicksalslied" und vor allem der Briefroman "Hyperion" einen sich immer wieder neu rekrutierenden Verehrerkreis. Die in der Götterwelt des philologisch wiedererweckten griechischen Altertums wurzelnden Metaphern, die exaltierte Kunstsprache Hölderlins war im Kulturbetrieb stets - und gerade auch in der Nazizeit - präsent: "Wo bist du, Jugendliches!" - "Wo bist du, Nachdenkliches!" Größeren Bekanntheitsgrad erlangten leicht überspannte Sentenzen zu Geist und Größe eines Volkes oder auch die gern vorm Hintergrund der Begeisterung für die Französische Revolution gelesene Aufforderung "Komm! Ins Offene, Freund!". Die Hölderlin-Rezeption mit all ihren Kapriolen wäre fürwahr ein weites und ergiebiges Feld für eine Exkursion gewesen. Doch das weithin triste, in geistiger Verwirrung verdämmernde Leben von Friedrich Hölderlin (1770-1843) interessierte den Librettisten Mussbach so wenig wie die Hölderlin-Moden. Selbst den hochtönenden exzentrischen Gedichten wies er nur eine marginale Rolle zu. Der im Mai 2008 aus dem Amt des Staatsopernintendanten gedrängte Psychiater und Regisseur plünderte seinen Zettelkasten, in dem sich auch Zitate von Walter Benjamin, Paolo Coelho, Friedrich Nietzsche, Thomas Nipperdey und anderen klugen Köpfen befanden. Dazu ließ er sich "aktuelle" Dialoge einfallen. Da gibt es, aufgeteilt auf 13 Stimmen, "Aufschrei der Leiber", einen stöhnenden "Wichser" und eine Sie, die "in heißem Begehren" fordert: "Fick mich, wer auch immer!" Im Rahmen eines Rückblicks auf die nach dem Niedergang der Götter verwahrlosten Menschen kommt es beiläufig zu einem Tötungsdelikt, weil eine junge Frau den zu lauten Musikkonsum ihrer Kumpel kritisiert. Insgesamt ergibt die Sammlung des heterogenen Materials, von Mussbach fahrig kompiliert, bestenfalls den Fahrplan zu einem Ausflug an einen umgekippten Wörtersee. Den betönte Ruzicka auf die bereits bei "Celan" probate Weise und mit Mitteln, die aus den verschiedensten Zonen des 20. Jahrhunderts stammen: Die Vokal-Partien, die gelegentlich an Gustav Mahler erinnern, erheben sich über heftigen Bläser-Stößen, Schlagzeug-Akzenten und sattem Streicher-Sound. Dort, wo sich die Stimmen chorisch verdichten, entwickelt die Musik ihre intensivsten Momente. Schließlich gleitet sie in eine lange ausgezogene, im Unisono sich quälende Streicher-Linie aus: So mag sie das Hinausgleiten in einen jenseitigen Raum vor Ohren führen. Der Regisseur Torsten Fischer und sein Bühnenbildner Herbert Schäfer haben aus dem Textkonglomerat und seiner nur wenig prickelnden Musik-Unterfütterung das denkbar Beste gemacht. Fischer half dem Unternehmen durch zusätzliche Hölderlin-Zitate auf philologisch solidere Beine und strich einige ordinäre Vokabeln. Mussbach sieht dadurch seine Urheberrechte verletzt und behält sich juristische Schritte vor. Bespielt wird vor allem eine große Pfütze, deren bewegter Wasserspiegel sich raffiniert auf Folien spiegelt: Wie gefordert, konstituiert sich so ein höchst irrealer Raum in undefinierter Zeit. Freilich kann auch dieser optische Kunstgriff die grenzenlose Unverbindlichkeit und Verquastheit des Projekts nicht ins Gegenteil kehren. Die Premiere fand, trotz der erkennbaren Webfehler im Grundstoff, freundlichen Zuspruch. Obwohl doch der von den Veranstaltern versprochene experimentelle Charakter der Expedition nicht hörbar wurde. Wieder am 21./25. + 29. November |
|
Nichts würde sich ändern Von Irene Constantin Nach der zweistündigen pausenlosen Uraufführung von Peter Ruzickas neuester Oper "Hölderlin" gab es einen ziemlichen Jubel. Er konnte nach menschlichem Ermessen nur Hartmut Litzinger gegolten haben, dem Mann, der für das Licht zuständig war. Er hatte das dankbarste Betätigungsfeld: Die Bühne war ein Wasserbassin. Lichtreflexe in allen denkbaren Farben und Mustern konnten über Wände und Courtinen tanzen – eine Pracht, wie sie manche Wagnersche Waberlohe nicht zustande bekommt. Leuchtend klare Farben im Bühnenhintergrund, scherenschnitthafte Schattenwirkungen, sanfte Übergänge, alles da und eine Augenweide. Auch die exzentrisch eleganten schwarzen Gründerzeitkostüme von Andreas Janczyk waren es wert, bejubelt zu werden. Selbst die diversen Insel-Lösungen in Herbert Schäfers Bühnengewässer funktionierten und sahen gut aus. Einen Glanzpunkt der Inszenierung setzte auch Vasilis Triantafillopoulos mit einem handlungstragenden riesigen Madonnenbild im orthodoxen Ikonenstil. Der kurzfristig in die Produktion eingesprungene Regisseur Torsten Fischer bemühte sich, der ziemlich kryptischen Bühnenhandlung eine Art narrativer Verständlichkeit zu geben. Die singenden Protagonisten M1 bis M7 und F1 bis F6 verdoppelte er durch Schauspieler und teilte damit gleichzeitig das Personal in einander gegenüberstehende Götter und Menschen ein. Durch den Umgang beider Personengruppen miteinander ergaben sich zaghafte Handlungselemente, Auseinandersetzungen, Entwicklungen. Erstaunlicherweise aber bekam ausgerechnet das Produktionsteam im allgemeinen Beifall einige Buhs entgegengeschleudert. Gerechterweise hätten sie der Komposition Peter Ruzickas gelten müssen und noch mehr dem Librettisten, der wegen der von der Regie vorgenommenen Hinzufügung einiger Hölderlin-Zitate aus "Hyperion" und "In lieblicher Bläue" ungenannt bleiben wollte. Alle Welt weiß, es ist Peter Mussbach, der geschasste Intendant des Opernhauses. Nach einer medientumultösen Auseinandersetzung um die Zitate erwägt er nun, Klage zu führen. Peter Ruzicka, der eine prominent besetzte Entourage – man sah Christoph Schlingensief und Richard von Weizsäcker, Alfred Biolek und Helmut Lachenmann – hinter sich hatte, konnte sich freundlichen Beifalls erfreuen. Verdient hat er ihn als Dirigent. Die Staatskapelle musizierte mit einer Hingabe, die bewunderungswürdig war. Viele schöne Kantilenen und einige eher zaghafte orchestrale Aufregungen gelangen makellos. Die Perfektion dieser Interpretation kann jedoch nicht verwundern, die Musiker haben Erfahrung mit dem Sound, den Peter Ruzickas Komposition ihnen zu spielen aufgab. "Tristan"-Vorspiel, "Lohengrin" und ein bisschen "Sieg- fried"-Trauermarsch waren zu hören, es gab eine nach 18. Jahrhundert klingende klassizistische Periode, es klang nach Mahler, Alban Berg und Hans-Werner Henze und überhaupt nach luxuriös überglänzter Spätromantik. Second Hand der Luxusklasse das alles; spannend allein der Beginn. Ein tonloses Schaben und Rauschen und Wispern entwickelt sich fast unhörbar aus dem Summen und Brausen der Bühnentechnik heraus, wird lauter, gewinnt Eigenleben, gebiert eine erste Spannung, die dann aber sofort untergeht in der Masse gesprochenen Textes. Der Schluss konnte der Qualität der musikalischen Anfangsphase wenig entgegensetzen. Zwar hatte die Lento-Adagio-Strecke in höchsten Violinlagen eine starke Intensität des fein gesponnenen Tones, aber in ihre nicht enden wollende Länge schlich sich immer deutlicher der Gedanke an eine gewisse Selbstgefälligkeit des Komponisten. Verdienter Beifall schließlich für die Sänger und Schauspieler. Dietrich Henschel als herausgehobener M1, als die Hölderlin-Figur Empedokles, wirkte herausfordernd durch seine Zärtlichkeit und Fragilität, ein Aufrührer und Märtyrer gleichermaßen. Ein Schauspieler stand ihm als "Dichter", als sein Schöpfer Hölderlin wohl, zur Seite. Den übrigen Darstellern blieb eine definierbare Identität verwehrt, aber die Ensembles funktionierten, stimmlich erfreulich jedes Solo. Die Handlung driftete von einem fantastischen "Unort in einer unbestimmten Zukunft" (1. Akt) über die banalsten Untiefen der Gegenwart (2. Akt) in eine "Situation eines totalitären Regimes" (3. Akt) und von dort in eine Art Arkadien (4. Akt), allesamt Wasserlandschaften. Sänger und Schauspieler platschten zwei Stunden durch das knöcheltiefe Bassin und man fragte sich, wann die ersten Indispositionen gemeldet werden würden. Hochfliegenden Dichterverse von Hölderlin, Rilke, Beckett und gnadenlose Plattitüden aus Vulgärsprache und Medien-Worthülsen wechselten in munterer Folge, darin eingestreut die Schilderung des grausamen Schicksals des verhungerten Kindes Jessica. Unüberhörbar ist hier der Moralist Mussbach. Sein Gedankenexperiment für die Akte 1 bis 3 besteht in der Frage, was der Mensch beginnen würde, wenn die Zeit rückwärts liefe und er sein Leben noch einmal beginnen könnte. Nichts würde sich ändern, stellt er erwartungsgemäß fest und die Oper endet in banalstem Hedonismus bei hellblauem Licht zur erwähnten Violinkantilene. Die Götter sind auf Menschenniveau herabgesunken, Empedokles-Hölderlin haben sie eingemeindet. Nächste Vorstellungen: 21., 25., 29. November und 2. Dezember |
|
Kritik Unsagbares in Musik gesetzt „Den Namen von der Produktion zurückgezogen"? Das, so denkt man, müsste doch anders aussehen. Doch wer sich der Deutschen Staatsoper nähert, stutzt. Von Weitem leuchtet „Peter Mussbach" auf der Außenwand, in trauter Zweisamkeit neben dem Komponistennamen Peter Ruzicka.
Markus Thiel Im Programmbuch mussbacht es munter weiter, und nur ein schamhafter Passus verweist auf den Zoff. Denn diese Produktion ist ja in doppelter Hinsicht typisch fürs Berliner Edelinstitut. Einmal natürlich, weil sich hier eins der großen internationalen Häuser an eine spektakuläre Uraufführung wagt: an „Hölderlin", die zweite Oper eines der wichtigsten Kulturmanager unserer Zeit, der mittlerweile aber am liebsten Notenblätter füllt. Und zweitens: Weil dies alles weniger das Wohl, sondern das Wehe der Lindenoper widerspiegelt, die als kommissarisch verwalteter, maroder Musentempel ihrer Zukunft und dem Umbau entgegendümpelt. Mussbach, der geschasste Intendant und Librettist des Stücks, durfte bekanntlich nicht mehr ans Regiepult. Er sann auf Rache, drohte mit Justitia, überwarf sich mit Ruzicka, sah – welch pathologischer Fall – seinen Text durch Hölderlin-Einfügungen des neuen Regisseurs befleckt. Was einen dann doch zum Gedankenexperiment drängt: Ohne solch Gezicke, auch ohne den Glanz Daniel Barenboims, den dort selten gesehenen Chefdirigenten – wer würde eigentlich von der Staatsoper noch Notiz nehmen? Das teuerste Berliner Haus, es gründelt derzeit auf Augenhöhe mit der Provinz. Dass „Hölderlin" also tatsächlich über die Bühne ging, ist weniger Wunder, sondern Kraftakt. Ruzicka, da steht er in der Tradition der von ihm geleiteten Münchener Musiktheater-Biennale, schildert nicht das Schicksal des irren Dichters im Tübinger Turm. Es ist ein Ideendrama, heruntergebrochen auf unsere Zeit. Hölderlin, sein Streben nach dem verlorengegangenen Ganzheitlichen, nach der Wiedervereinigung von Geist und Gefühl, von Kunst und Leben, von Mensch und Gott: Solch Unsagbares sollte doch ein wunderbares Thema für die Musik sein. Und 120 pausenlose Minuten lang scheint sich Ruzickas Partitur nach diesem Unwiderbringlichen zu sehnen. Mahler’sche Adagio-Gesten leisten Trauerarbeit, Klangflächen kreisen um einzige Töne: homophone Momente, die wie Pflöcke im manchmal kakophonischen Umfeld wirken, die Halt geben in der Haltlosigkeit. Und immer wieder erhebt sich die Fragefigur des Wagner’schen „Tristan-Akkords": jener Moment der Musikgeschichte, der die Tür zum Entgrenzten aufstieß. Es ist eine Musik, in Varianten wiederkehrend, schleichend und suchend, fein verästelt und sorgsam instrumental abgeschmeckt, auch von hoher theatraler Qualität (und gern plakativ aufgeregt), die fast die Kulinarik, mit Sicherheit aber die Spätromantik von Ruzickas großem Mentor streift: von Hans Werner Henze. Die dunkle, geerdete Klanglichkeit kommt der Staatskapelle Berlin, von Ruzicka selbst geleitet, entgegen. Und am Ende verengt sich alles zu einer starken Gebärde: einem Streicherton, der sich bald fortissimo in die Gehörgänge bohrt, bevor er zusammensackt, zu einer Bitte. Wortlos, dringlich und unbeantwortet. In solchen Passagen dominiert Ruzicka mühelos. Da transportiert seine Musik mehr Hölderlin, als es der Text zu leisten vermag. Mussbach bietet uns zwölf Menschen, die in eine Katastrophe geworfen werden, die über ihr Leben reflektieren, mit zwölf Gottheiten konfrontiert werden und am Ende in einer Art Utopia stranden. Schlaglichtartige Szenen sind dies, rätselhaft, auch grotesk. Und bei Letzterem gibt’s das bekannte Problem: Humor, ob Text oder Musik, funktioniert in der modernen Oper eben kaum. Torsten Fischer, der die Regie von Mussbach übernahm und einige Buhs kassierte, ist kaum ein Vorwurf zu machen. Ein Wasserbecken beherrscht – wieder einmal – die Bühne (Herbert Schäfer). Ein mystischer Ort zwischen Hochhaus-Siedlungen, in denen schwarze Hölderlin-Zeitgenossen wandeln. Mal senkt sich ein Spiegel, mal fahren durchsichtige Vorhänge hernieder: eine schöne, offene, zuweilen dürftig choreographierte Versuchsanordnung. Gesungen wird phänomenal, gesprochen achtbar. Einer ragt heraus: der von Hölderlin thematisierte Philosoph Empedokles, den Dietrich Henschel hochintensiv verkörpert, dabei deklamatorisch genau und fast rücksichtslos singend. Und doch krankt alles an einem Grundkonflikt: Hölderlin, dessen Texte zum Unsagbaren drängen, der traditionelle Sprachlichkeit verzweifelt überwinden wollte – wie sollte dies mit konkreten Situationen zwischen „Du spinnst" und „Ich brauche meine Freiheit" funktionieren? Dem Ganzen droht also die Verplattung. Man hält sich an Ruzicka und zieht daher zwei Schlüsse: Einfach Hölderlin l e s e n. Oder Ruzicka nimmt das Thema, vielleicht sogar symphonisch, wieder auf – ohne Mussbach. |
|
Dichter im Berliner Schick
Eine Expedition" nennt der Komponist sein neuestes Bühnenwerk. Eine Forschungs- und Bildungsreise also in die Welt des Friedrich Hölderlin, in die philosophischen Abgründe des im Tübinger Turm dahinvegetierten Dichters. Keine biographische Oper im Sinne eines Dramas wollte Ruzicka schreiben, sondern die klangliche und szenische Umsetzung eines höchst komplexen Gedankengebäudes! Es geht um die ewige Sehnsucht des Menschen nach Einheit mit sich und der Natur, mit sich und der Welt. Peter Ruzicka und sein Librettist Peter Mussbach haben den waghalsigen Versuch unternommen, solch differenzierte Denkprozesse in musikalisch-szenische Sprache zu übersetzen. Sie sind damit grandios gescheitert. In der Imagination eines Dichters und seiner literarisch erfundenen Figur Empedokles erleben zwölf Menschen und genausoviele Götter Griechenlands ein wiedergefundenes Leben. Die Zeit läuft rückwärts: Alle Akteure beginnen den Strudel ihres Daseins gewissermaßen von vorn, bis sie sich der Utopie einer Versöhnung von Natur und Kosmos hingeben. Bis zum Überdruss strapaziert Was hier in zweistündigem Szenenablauf über die Berliner Bühne ging, ist die sprachliche und musikalische Vereinfachung von Denkprozessen und deren poetischer Reflexion. Ruzickas Musik entbehrt jeder strukturellen Dichte und formalen Konzeption. Banale Kantilenen der Streicher werden bis zum Überdruss strapaziert. Was bisweilen an Mahler gemahnen könnte, ist von dessen Suggestivkraft meilenweit entfernt. Wie zufällig greift Ruzicka dann immer wieder auf Versatzstücke zeitgenössischer Musik zurück und schwärzt die simplen melodischen Floskeln durch modisch-schicke Geräuschelemente ein. Man fragte sich ernsthaft, ob Ruzicka dem Griff in die Trickkiste erprobter Effekte nicht allzu häufig erlegen war. Jedenfalls wird mit solch simplen musikalischen Verfahrenweisen Hölderlins philosophische Poesie auf niedrigstem Niveau karikiert. Die pausenlosen zwei Stunden hätten sich zur Ewigkeit ausgeweitet, wäre da nicht Torsten Fischers Regiekonzept gewesen: Die episch zerdehnten Musikabläufe wurden mit ausbalancierter Langsamkeit abgefangen, und den Revolutionsszenen des dritten Aktes fehlte glücklicherweise jeglicher aktueller politische Bezug. Schmerzhafte Erneuerung Das Ineinanderwirken von zwölf Sängern (die Götter) und zwölf Schauspielern (die Menschen) nutzte Fischer zu einer Trennung beider Ebenen. Mit der zerbrechlichen Transparenz des Bühnenbilds (Herbert Schäfer) stand ihm eine ästhetisch überzeugende Szene zur Verfügung. Dass die Akteure durch ein riesiges Wasserbecken waten mussten, setzte dagegen keine erhellende Deutung frei. Der Premierenbesetzung aus Schauspielern, Sängern sowie dem Chor und Orchester der Staatsoper unter Leitung des Komponisten steht herausragender Rang zu, allen voran Dietrich Henschel als Empedokles. Die bisweilen schmerzhafte Erneuerung und Verjüngung der Staatskapelle hat sich wieder einmal als Segen erwiesen. Rüdiger Schwarz Wieder am 21., 25., 29. 11. und 2. 12., Karten: www.staatsoper-berlin.org |
|
URAUFFÜHRUNG Götter im Plattenbau In der Berliner Staatsoper dirigiert der Komponist Peter Ruzicka seinen „Hölderlin"
Von Antje Rößler BERLIN - Das erlebt man nicht alle Tage: eine Opern-Uraufführung gegen den Willen des Librettisten. Die Streitigkeiten in der Chefetage der Berliner Staatsoper zeitigten nun auch Folgen auf der Bühne. So hat Peter Mussbach, einstiger Intendant des Hauses, seinen Namen vor der Uraufführung der Oper „Hölderlin" zurückgezogen. Als Verfasser des Librettos zeigte er sich verstimmt über die Bearbeitungen der Regie und behält sich rechtliche Schritte vor. Der Komponist Peter Ruzicka hält dagegen, es würden lediglich an drei Stellen Hölderlin-Zitate eingefügt. Die Sache ist deshalb pikant, weil Mussbach den „Hölderlin" ursprünglich selbst inszenieren wollte – bevor er von Klaus Wowereit als Intendant entlassen wurde. Vollzieht er nun einen Racheakt? Der Premierenbesucher sollte sich um solche Intrigen besser nicht kümmern, verlangt doch das Stück die Auseinandersetzung mit viel grundlegenderen Problemen. „Wenn du dein Leben noch einmal hättest, was würdest du dann anders machen?", diese Frage ist Mussbachs Ausgangspunkt für eine Versuchsanordnung im Rückgriff auf den großen Lyriker Hölderlin: Zwölf Verstorbene müssen die Etappen ihres Lebens noch einmal durchmachen. Ihr Begleiter ist die Hölderlin-Bühnenfigur Empedokles. Jene sanfte, entrückte Stimmung, die einen beim Lesen Hölderlins ergreift, kommt an diesem Abend nicht auf. Peter Ruzickas Musik ist überwiegend laut und direkt. Er leitet den Abend selbst. Ein riesiges Sinfonieorchester mit dominantem Bläsersatz füllt den Graben; vier Schlagzeuger belegen die beiden Seitenlogen. Abwechselnd wiederholen sich stilistisch ganz unterschiedliche Themenfelder: Mal erinnert elegischer Streicherschmelz an Wagner, dann wieder bilden punktuelle Bläser- und Schlagwerk-Einwürfe ein dichtes Tongeflecht. Textintensive Passagen werden durch einen einzigen hohen, lang ausgehaltenen Ton begleitet, den die Instrumente sich weiterreichen. Zu einer eigenen, prägnanten Sprache findet Ruzicka in dieser Stilvielfalt nicht. Auch auf der Bühne lässt sich kein Bezug zu Hölderlin entdecken. Des Dichters großes Thema war das Eingebundensein des Menschen in die Kreisläufe der Natur. Aber in dieser Inszenierung spielt die Natur nirgendwo eine Rolle. Regisseur Torsten Fischer schickt die dem Tode entrissenen Menschenkinder in eine anonyme Plattenbausiedlung, die sie mit Schrecken als ihre frühere Heimat erkennen. Nun kämpfen sie sich im Rückwärtsgang durch verschiedene Etappen ihres Lebens, vom Pflegeheim über den Swingerclub bis zur pupertären Ghettoblaster-Gang. Dann findet sich die Gruppe in einem totalitären Regime wieder; das orange ausgeleuchtete Diktatoren-Standbild ist eines der vielen effektvollen Bilder des Abends. Schließlich wird mit einem heiteren Sonntagsspaziergang die Utopie eines guten Lebens gefeiert. Es ist gar nicht einfach, den auf dem Zeitstrahl vor- und zurückspringenden Szenen zu folgen. Doch der Regisseur will es noch komplizierter! Er verdoppelte die 13 Protagonisten, indem er jede Figur in einen Menschen (Schauspieler) und einen Gott (Sänger) aufteilte. Auch das gefiel Peter Mussbach nicht, der das Stück lieber götterfrei gesehen hätte. Ein Großteil der Bühne ist von knöcheltiefem Wasser bedeckt. Die Geräusche, die beim Schreiten und Rennen durch das Becken entstehen, bereichern auf interessante Weise die Musik. Obwohl ein dramaturgischer Grund für das nasse Requisit nicht erkennbar ist. Ratlosigkeit bleibt der vorherrschende Eindruck. Mit Mussbachs Eingangsfrage, was man denn nun mit einem zweiten Leben anfangen würde, bleibt der Besucher allein. Letztlich scheitert dieser „Hölfderlin" an der Theaterpraxis. Es ginge darum, die „philosophischen, kosmologischen und geschichtlichen Dimensionen Hölderlins auf die Opernbühne zu bringen", heißt es im Programmheft. Ergibt aber eine dramatische Kunstform ohne Handlung – ja, ohne konkreten Gegenstand – einen Sinn? Ist ein Zeitverlauf, der sich erst rückwärts und dann wieder vorwärts abspult, überhaupt nachvollziehbar? Der hohe Anspruch verliert die Zuschauer aus den Augen. |
|
Musiktheater Von Volker Hagedorn Peter Ruzickas neue Oper "Hölderlin" scheitert in Berlin – aber nicht, weil er sich mit dem Librettisten Peter Mussbach zerstritten hat
Den Göttern geht es ja schon seit Längerem nicht gut, schon gar nicht in der Oper. Menschlich, allzu menschlich werden sie meist inszeniert, zänkische Individuen, machtversessen, spätestens Richard Wagner komponierte sie schon erdennah. Die "seligen Genien", "droben im Licht", die Friedrich Hölderlin so liebte, sind für das Musiktheater nicht dramatisch genug. Oder doch? In Berlin lösen sie sich im Bühnenhintergrund aus jähem Licht, zwölf Gestalten, und beginnen Menschen zu retten. Die Götter tragen strenge, hochgeschlossene Kleider und schmucke schwarze Gehröcke der vorletzten Jahrhundertwende, die Menschen sind heutig und hell und dürftig bekleidet und liegen im Wasser. Sie werden herausgezogen und nach vorn gebracht, dorthin, wo Hölderlin sitzt. "Ich hab ihn ausgeträumt, von Menschendingen den Traum", hat er gerade halb wütend, halb nölig gerufen, nicht gesungen, und das Orchester hat seltsam spätromantisch geraunt, in einer Harmonik, die vor hundert Jahren noch so in Mode war wie Glockenrock und Gehrock und die um so eigentümlicher berührt, als der Komponist Peter Ruzicka sie in einer ganz anderen, harschen und kargen Klangumgebung platziert. An Götter dachte er noch gar nicht, als er das schrieb, und das Hölderlin-Zitat war ebenfalls nicht vorgesehen. Dass sich nun doch alles abgründig fügt, geschieht aber durchaus im Sinne des Komponisten. Er dirigiert die Uraufführung seines Hölderlin in der Berliner Staatsoper selbst und im Einverständnis mit dem Regisseur Torsten Fischer. Der Librettist aber schäumt vor Wut. Peter Mussbach fühlt sich "verhohnepipelt". Furchtbares braut sich zusammen hinter der "dumpfen Stirne" des Volks Mit Erwägung einer Urheberrechtsklage kurz vor der Uraufführung tat er der Produktion den denkbar größten Gefallen, denn ein Zwist unter Promis ist medienwirksamer, als es die klügsten Erwägungen über Hölderlin und die Gegenwart sein könnten. Den Echoraum der Kontroverse bildeten die schwer durchschaubaren Umstände, unter denen Mussbach in diesem Jahr sein Amt als Intendant der Staatsoper verlor, an der er andernfalls selbst Hölderlin inszeniert hätte. So aber sprang Torsten Fischer ein, erfand neue Gestalten, fügte dem Stück zusätzliche Zitate ein und realisierte die erste Hälfte der zwei pausenlosen Stunden intensiv, schlüssig, ideenreich und präzise. Jene Hälfte, deren Texte im Wesentlichen von Hölderlin selbst stammen, vertont wie gesprochen, und in der Ruzickas Musik so suggestiv wie stringent wirkt. Mit Hölderlin hat sich Peter Ruzicka immer wieder auseinandergesetzt. Der umnachtet gestorbene Dichter ist für den Komponisten gleichsam das Pendant zu Paul Celan, um den herum er sein erstes Musiktheaterwerk konzipierte. Die beiden an der Welt zerbrochenen Dichter sind Gegenbilder zum weltgewandten Praktiker Ruzicka, zum erfolgreichen Intendanten in Hamburg und Salzburg. Doch dem hochreflektierten, skeptischen Kunstsinn des Komponisten sind sie nahe. Neben den splittrigen Extremen seiner Celan-Oper von 2001 wirkt die neue Partitur übersichtlicher: Karge, weit ausgespannte Kontrapunktik und einsame Linien einerseits, andererseits motorische Attacken und historisierende Intarsien, in denen man neben romantischem Sehnsuchtsklang auch mal einen ausgedörrten Rest Mozart hört. Zu einem solchen Rest zeigt Fischer einen Opfergang: Nachdem Hölderlin wider die "dumpfe Stirne" des Volks gewütet hat, zerfleischen die als "willenlose Leichname" beschimpften Menschen sein (singendes) Alter Ego, und auch die rettenden Götter sind ihnen nichts mehr wert: In Rollstühlen werden die Boten einer anderen Welt an die Rampe geschoben, entkräftet, zu Abfall fast verwandelt. Die Plattenbauten, die als bühnenhohe Fotografien zuerst nur die Seiten des Raumes begrenzten, schließen nun auch den Horizont. Atemberaubend ist die Fallhöhe von Hölderlins Sprache zu dem Gestammel, das sich nun ausbreitet. Im Alltagsjargon beschwört der Librettist Mussbach das Elend der Gegenwart. "Scheißleben", "Wichser", "Dass ich nicht lache": Das ist nicht bloß Sozialmisere 2008, sondern die Art Realität, vor der schon Hölderlin floh. Himmelfahrtskommando für einen gebrochenen Helden Der Dichter spielt im Folgenden auch kaum eine Rolle mehr. Mussbach textet ein Panoptikum der Verrohung zwischen dokumentierender Anklage (Kindesmisshandlung in Hamburg-Jenfeld) und dadaistischer Zuspitzung: "Deine ewige Ironie", sagt der Mann, "dein ewiges Leben", sagt die Frau und schießt ihn tot. Peng. Tja. Ab und an leuchtet noch mal eine Hölderlinzeile auf, dann staunt man, wie geradezu unantastbar, unrelativierbar seine Sprache ist – aber an Spannung hat der Abend längst verloren. Bezeichnenderweise kommt in der vom Regisseur ersonnenen, scheinbar weltfernen Konstellation aus Göttern, Menschen und verdoppeltem Dichter viel mehr Gegenwart, Angst und Hoffnung zum Vorschein als da, wo Fischer den bemüht aktualisierenden und zugleich mystifizierenden Dialogen Peter Mussbachs folgt. Ruzickas Komposition fällt nun deutlich ab. Seine Kunst der Übergänge und Überlagerungen beginnt in der zweiten Hälfte stereotyp zu wirken, sein Signalement plakativ. Gesten wie ein Bläsercrescendo, hinter dem ein anderes sich hervorschiebt, klingen mehr nach bewährtem Fundus der Avantgarde als nach durchdachter Notwendigkeit. Auch Hölderlins Zeilen wirken nun musikalisch unterbelichtet, allzu beflissen eingebunden in den Fortgang. Es ist ein Himmelfahrtskommando, so etwas zu inszenieren. Torsten Fischer hat mit dem Bühnenbildner Herbert Schäfer und dem Kostümbildner Andreas Janczyk zwar ein Team ersten Ranges, kann aber auch nicht alles retten. So wiederholt er sich: nochmal der kleine Junge, noch eine Exekution, nochmal den Vorhang runter und wieder rauf …Wie es Göttern und Menschen geht, ist einem am Ende völlig egal. Nicht aber, dass 28 fantastische Sänger und Schauspieler und eine großartige Staatskapelle alles gaben für einen Abend, der so unrettbar zerbrach wie sein Titelheld. |
|
Viel Geschrei, wenig Gesang Von Albrecht Dümling
Selten traf eine Opernuraufführung auf ein derartiges Medieninteresse. Schon Wochen vorher war der Streit zwischen Peter Mussbach und Peter Ruzicka durch die Presse gegangen. Die beiden Intendantenkollegen hatten eine Hölderlin-Oper geschrieben, die Mussbach an der Berliner Staatsoper herausbringen wollte. Nach seinem Hinauswurf war dies nicht mehr möglich. Als der Ersatzregisseur Torsten Fischer Änderungen vornahm, sah der sonst als Regisseur freizügige Mussbach seine Urheberrechte gefährdet und drohte mit Klage. Besseres hätte Ruzic-ka gar nicht passieren können, denn auf diese Weise drängte noch mehr Prominenz (von Biolek bis Weizsäcker) und Presse in die skandalumwitterte Premiere seiner unversehens zum Pièce de Résistance geratenen Weltanschauungsoper.Mussbachs Libretto konfrontiert poetische Texte Friedrich Hölderlins mit dem modernen Alltagsjargon der Ellbogengesellschaft in Kaufhaus-, Fitness-, Fernsehstudio- oder Swingerclubszenen. Fischers routinierte Inszenierung verschleierte diese Kontrastdramaturgie wie auch das Vor und Zurück zwischen Gegenwart und Vergangenheit und machte so die Chronologie der Expedition undurchsichtig. Namenlosen Menschen standen als Alter Ego ebenso namenlose Götter gegenüber; sie waren im Stil der Hölderlin-Zeit mit Frack und Zylinder gekleidet, obwohl schon der Dichter seine eigene Epoche als gottlos angesehen hatte. Im Zentrum ein Darstellerpaar: ein Schauspieler (Markus Gertken), der Hölderlin-Texte deklamierte, und ein Sänger, der sie gelegentlich auch sang (optisch beeindruckend, aber stimmlich gelegentlich überfordert Dietrich Henschel). Mehr als Singen und Musizieren charakterisierten Sprechen, Schreien und Schreiten die Aufführung. Der unverzerrt dargebotene Text blieb trotz zusätzlicher Untertitel rätselhaft. Es geschah einfach zu viel und zu unstrukturiert in zu kurzer Zeit, wenn die zu Beginn aufgesammelten Katastrophenopfer erneut sprechen lernten, zum Glauben fanden, eine Madonnenfigur aufhängten und wieder herunterrissen und schließlich – vor der Silhouette des Palasts der Republik – in eine Diktatur gerieten. Die Geschichte der Menschheit als eine Geschichte der Menschenverachtung, Brutalität und Gottlosigkeit. Im Einerlei des Zeitflusses und einheitlicher Plattenbauten (Bühnenbild: Herbert Schäfer) gingen die vier Akte ohne Zäsur ineinander über. Statt in einer Eislandschaft lagen zu Beginn die Opfer einer apokalyptischen Katastrophe in großen Wasserbecken, die insgesamt mehr zur Verwässerung als zur Verdeutlichung beitrugen. Sinn ergaben sie erst bei schweren Regenfällen und im Schlussbild, als eine arkadische Landschaft am Meer zu sehen war. Der hier vorgestellten Vision einer „schönen Einsamkeit" im Einklang mit der Natur entsprachen hochtönende Hölderlin-Worte („wir können uns auf dem Berge des weiten Himmels und der freien Luft freuen") und eine emphatische Streicherlinie, die anschwoll und verschwand. War das die versprochene spirituelle Errettung der Menschheit? Der Komponist, der selbst am Pult stand, hatte bis dahin mit Ausnahme weniger Klanginseln, sirrenden Flächen und einer leitmotivisch wiederkehrenden Tristan-Reminiszenz der tiefen Streicher Musik aufge-spart und fast verweigert. Die hohe Streicherlinie bedeutete einen Ausgleich, aber keine Erfüllung. Die Dichtung Friedrich Hölderlins hat schon zeitgenössische Komponisten wie Holliger, Maderna, Nono, Pousseur, Reimann, Rihm und Zender beflügelt. Für Peter Ruzicka ist ihre Aktualität heute, „zu Beginn eines spirituell geprägten 21. Jahrhunderts", sogar gewachsen. Erwartungen an seine Oper schürte er durch die Veröffentlichung von Vorstudien wie sein Orchesterstück „Vorecho" und das Streichquartett „Erinnern und Vergessen" sowie durch Interviews, in denen er nach der früheren Fragmentästhetik eine neue sinfonische Großbogigkeit ankündigte. Davon wie von einer „Wiedergewinnung des Kantablen" war wenig zu verspüren. Es schien, als hätte der Respekt vor dem Dichterwort die musikalische Phantasie beschnitten. Der freundliche Beifall der zur Premiere erschienenen Freunde des Komponisten (darunter die Kollegen Halffter, Lachenmann, Matthus, Reimann und Rihm) verbarg nicht die Enttäuschung der hohen Erwartungen. Ein neues spirituelles Zeitalter dürfte diese neue Oper noch weniger einläuten als die von Messiaen und Stockhausen. Albrecht Dümling |
|
Gedränge um das zweite Leben Ljubiša Tošic aus BerlinDie Leuchtreklame an der Fassade der Staatsoper unter der Linden bewirbt noch die alten friedlichen Zeiten: "Uraufführung. Peter Ruzicka. Peter Mussbach", steht da, während das Programmheft schon auf den Konflikt reagiert hat. In der Namensliste fehlt Librettist Mussbach. Als Intendant des Hauses war er schon vor einiger Zeit (nach einem Konflikt mit Musikchef Daniel Barenboim) zurückgetreten. Dann zog er sich als Regisseur der neuen Oper zurück. Und nun, einige Tage vor der Uraufführung von Hölderlin. Eine Expedition, protestierte er gegen als unzulässig empfundene Änderungen im Libretto, die der nunmehrige Regisseur Torsten Fischer mit eingefädelt hat. Keine Autorisierung Mussbach zog seinen Namen zurück, kolportiert wird auch seine Drohung, die Änderungen im Libretto auf Verletzung des Urheberrechts hin prüfen zu lassen. Das Programmheft weist denn auch darauf hin, dass die aufgeführte Version von Mussbach ausdrücklich nicht autorisiert wurde, wegen - wie es nicht ironiefrei heißt - "weiterer Einfügungen" von Hölderlin-Texten. Keine Ahnung, ob der zürnende Librettist, hätte er der Uraufführung beigewohnt (Ruzicka hatte ihn noch extra eingeladen), sich wieder beruhigt hätte. Keine Opernbiografie hätte er erlebt. Dichter Hölderlin wird hier zu einer Art erzählendem Begleiter und Zeitdiagnostiker des enigmatischen, ins Heute ragenden Geschehens. Vereinfacht ausgedrückt hat man es mit einer Art Agatha-Christie-Konstellation zu tun: 13 Menschen findet sich in einer undurchschaubaren Situation wieder und begreifen langsam, dass ihnen ein zweites Leben geschenkt wurde. So klar, wie das klingt, wirkt es auf der Bühne allerdings nicht. Da wäre ja auch noch die Gruppe der Götter, welche die Toten zum Leben erweckt haben. Es herrscht also gewaltiges Figurengedränge auf der Bühne, und man erlebt einiges: die Geburt des Sprechens, die in Massenstreit und -gewalt mündet, die Vermenschlichung der Götter, neu durchlebte biografische Momente, den Auftritt eines totalitären Systems und den Versuch einer Revolution samt Streit über diverse Zukunftskonzepte. Schließlich landet im vierten Akt alles in einer idyllischen Sphäre, in der Raum und Zeit aufgehoben scheinen. Ein friedvoll-heiteres Ambiente steht für die umgesetzte Utopie eines mit dem Kosmos versöhnten Lebens. Ein Ort der Hoffnung. Nicht zu vergessen: Als „roter Werkfaden" fungiert auch noch die Beziehung Hölderlin/Empedokles (als historische und auch als von Hölderlin erfundene Figur). Regen, Eis und Sommerhitze So kommt es etwas verwirrend: In einem gleichsam die Jahreszeiten spiegelnden Bühnenbild mit Wasserfläche, Eis, Regen und brütender Hitze lösen sich Einzelfiguren aus dem etwas undefiniert wirkenden Ganzen, das womöglich eine Menschheitsgeschichte sein will, ohne Kompaktheit zu entfalten. Mehr Klarheit aus dem Orchestergraben: Ruzicka hat das Ganze mit schillernder und Extreme auslotender Musik zwischen Romantik-Assoziationen und klassischer Moderne versehen. Der Chor produziert bedrohliche Flächen, im Orchester kehrt ein Verweis auf Wagner mehrmals wieder. Und: Katastrophische Verdichtungen treten als perkussiv geprägte Schläge in Erscheinung, begleiten Gesprochenes wie Gesungenes. Immer wieder düstere Adagio-Anklänge, Stille und vokale Passagen im erprobten Opernstil. Mitunter wird es ganz tonal-melodiös, dann wieder dominieren artifizielle, schrille Soundflächen. Die vielfache Repetition von Strukturen bringt zuweilen maschinelles Flair und sorgt auch für formale Organisation. Am Ende, da die Figuren im Zwischenreich landen, übernehmen die Streicher mit einer insistierend-bohrenden Linie die Führung. Und hier nun endlich, spät, stellt sich auch etwas szenische Klarheit ein. Respektabler Applaus für die tolle Ensembleleistung und für Komponist und Dirigent Ruzicka. Mit der Ankunft des Regieteams aber dann einige Buhs, die Ruzicka - vortretend - auf sich nimmt, bevor er mit einem Anflug von Gekränktheit abgeht. Aber immerhin: Es ist vollbracht. |
|
Uraufführung EVA MALE Trotz vorangehender Querelen ging Peter Ruzickas Oper „Hölderlin. Eine Expedition" am Sonntagabend Unter den Linden wie geplant über die Bühne. Musikalisch wie szenisch ein großer Erfolg. Die Buhrufe gingen in dem allgemeinen Jubel unter, die Querelen, die der Premiere vorausgegangen waren, schienen vergessen: In der Berliner Staatsoper Unter den Linden wurde der Komponist und Dirigent Peter Ruzicka Sonntagabend nach der Uraufführung seiner Oper „Hölderlin" lautstark gefeiert. Zwei Stunden Musiktheater, gefüllt mit wenig Hölderlin und umso mehr (teils rätselhaften) Bildern. Eine Flut, die die Zuschauer, zusammen mit der eindringlichen Musik, in ihren Bann zieht. Die Welt auf der Bühne besteht vornehmlich aus Wasser: Knöcheltief waten Sänger und Schauspieler durch ein großes Becken, Regen nieselt auf sie nieder, all das vor der Kulisse eines riesig-tristen sozialen Wohnbaus. Schutz bieten Schirme und Zylinderhüte, Herren im Frack. Ein Teil der Damen trägt schwarze Kleider mit Culs de Paris. „Und einmal sah ich noch in die kalte Luft der Menschen zurück und schauerte und weinte vor Freuden." – ein Zitat aus Friedrich Hölderlins Roman „Hyperion" führt zu Beginn in das düstere Spektakel ein; der Text läuft in „Untertiteln" über den Häuptern der Darsteller mit. Erzählt wird in vier Akten anhand eines experimentellen Szenarios die Geschichte von 13 Menschen, die nach einer Katastrophe die Möglichkeit erhalten, ihr Leben ein zweites Mal anzugehen. Sicht in eine lebbare Zukunft Dann geht es „Zurück – im freien Fall". Götter und Menschen finden sich alt und gebrechlich ins heutige Leben zurückgeworfen wieder. Es folgt die Angst unter einem totalitären Regime, der Versuch einer Revolution. Durchlaufen eines extraterrestrischen Raums. Am Ende der Lichtblick: die „Sicht in eine lebbare Zukunft", wie sie sich Regisseur Torsten Fischer wünschte. 13 Sänger und 13 Schauspieler erzählen Seite an Seite, die beiden Genres Oper und Sprechtheater werden einander entgegengestellt. Ursprünglich waren Doubles vorgesehen, was der Regisseur für „nicht so angebracht" hielt. Ebenso nahm Fischer Abstand von der zunächst konzipierten Multimediashow. Starke Bilder, Musik, Text – im Mittelpunkt der Mensch. Das genügt. Eine Handlung im klassischen Sinn gibt es nicht. Das Libretto stammt von Peter Mussbach, dem langjährigen Intendanten der Lindenoper, der vor sechs Monaten im Streit sein Amt niederlegte. Kurzfristig sprang Torsten Fischer ein. Wegen Änderungen ist Mussbach erzürnt und autorisierte den Text in der jetzigen Fassung nicht (siehe unten). Dennoch prangte Sonntagabend sein Name in großen Lettern neben dem des Komponisten. Die Oper, in der Mussbach Hölderlin-Zitate mit eigener Trash-Lyrik kombinierte, beschäftigt sich nicht mit der Biografie des Dichters, sondern geht vielmehr seinem dichterischen Wirken in unserer Zeit nach. Eine Reise durch die Zeiten in vier Akten. Revolutionen, Nationalsozialismus (Hölderlin wurde im Dritten Reich stark missbraucht), Studentenrevolte. Nicht umsonst lautet der Untertitel der Oper „Eine Expedition". Über die zentrale Figur des Empedokles wird die Geschichte spielbar. Großartige Leistungen liefern Schauspieler wie Sänger, unter Letzteren Dietrich Henschel, Anna Prohaska, Stephan Rügamer und Carola Höhn. Aufopfernd spielend und kämpferisch das Ensemble, das sich – nebenbei bemerkt – ja den ganzen Abend über nasse Füße holt. Die Führung der Dutzenden Personen, die gleichzeitig die Bühne füllen, sitzt exakt, Bühnenbild und szenische Gestaltung gehen unter die Haut. Handlung und Text geben dem Publikum zugleich so manches Rätsel auf. Allzu viel Klarheit darf man nicht erwarten. Vielleicht wieder einmal Hölderlin lesen – 1770 bis 1843, Freund der Philosophen Hegel und Schelling, Zeitdiagnostiker. Zurücklehnen in die Musik In die Musik, die Anklänge an Wagner und Mahler aufweist, kann sich der Zuschauer zurücklehnen. Ruzicka stand bei seinem zweiten abendfüllenden Musiktheaterstück selbst am Dirigentenpult. 2001 hatte die Dresdner Uraufführung von Ruzickas Oper „Celan" für Aufsehen gesorgt. Im selben Jahr begann auch die Zeit seiner künstlerischen Leitung der Salzburger Festspiele, die bis 2006 andauerte. Der heute 60-jährige Ruzicka bleibt bis zum Jahr 2012 Leiter der Münchener Biennale für zeitgenössisches Musiktheater. |
|
Kultur Welten-Winterreise: Erfolgreiche Uraufführung von Peter Ruzickas Oper "Hölderlin" an der Berliner Staatsoper Unter den Linden Gerald Felber Berlin (SN) . Es war keine fröhliche Kunde, die dem Berliner Publikum durch Peter Ruzickas zweite Oper "Hölderlin" überbracht wurde: wie wir unseren ewigen Kreisläufen ausgeliefert sind und welche tiefe Unlogik deshalb eine Konstruktion wie der menschliche Geist darstellt, der über sich selbst hinaus zur Schönheit und Ewigkeit denken kann und trotzdem, wie alles andere, letztlich der Vernichtung geweiht ist.Figur des Utopisten Friedrich Hölderlin (1770-1843) hat uns die Sprache für diesen existenziellen Riss zwischen Ewigkeit und Endlichkeit geliefert. Mit seiner Figur des Empedokles zeigt er uns auch den Utopisten, der wider besseres Wissen gegen die Urverzweiflung angeht.Die Oper, die der frühere Intendant der Salzburger Festspiele, Peter Ruzicka, über Hölderlin komponiert hat und die am Sonntag in der Staatsoper Berlin uraufgeführt worden ist, ist weder eine musikalische Biografie noch gibt sie Einblick in den in geistiger Umnachtung vollzogenen Rückzug des schwäbischen Dichtergenies in den Tübinger Turm. Peter Mussbach, bis vor kurzem Intendant der Berliner Staatsoper, baute als Librettist um diesen Dichter und sein Geschöpf ein überfrachtetes Weltpanorama, das in zwei langen Stunden beides - Verzweiflung und Widerstand - zu transportieren vermag. Mussbachs Intellektuellen-Babysprech der Figuren ("Oh Leben! Umbringen mich um! Kann nicht mehr!") nervt streckenweise. Nun kommt - überhöhend und damit rettend - Peter Ruzickas Musik ins Spiel, die trotz aller teils heftigen Verdichtungen aus einer tiefen Zartheit steigt, alle Trauerklänge der Geschichte von Johann Sebastian Bachs Passionen bis zu Gustav Mahlers lebensübersatten Streicher-Kantilenen in sich einfängt, neu durchleidet, durchlichtet und sublimiert. Diese Musik klingt wie eine Beschwörung, die vielleicht um ihre Sinnlosigkeit weiß, aber wenigstens - wie Empedokles - etwas versucht haben will. Nicht immer hält die Partitur diese Intensität. Und vor allem die fragmentarisch zerlegten Gesangspartien - Schattenrisse nur, die ebenso oft sprechend wie singend zu artikulieren sind - erfordern von den Sängern oft Verzicht und Selbst-Zurücknahme. Das Premierenensemble stellte sich dem durchweg mit Ernst, wenigstens Dietrich Henschel als prometheischer Widerständler soll trotzdem individuell erwähnt sein. Vor allem aber waren es Peter Ruzickas leid- und hoffnungsvolle Orchesterklänge, die diesen Abend trugen, zumal sich dafür kaum ein besseres Ensemble denken lässt als die vom Komponisten selbst geleitete, im weltschmerzlichen Entsagungston bestens geübte Staatskapelle Berlin. Torsten Fischer hat nach Mussbachs Abgang die Inszenierung in die Hände genommen und das ihm anvertraute Material mit hohem Respekt behandelt. Mehr noch: er hat es in organischem Zusammenwirken mit dem (trotz des allzu modischen Wassergeplansches im Bühnen-Bassin) fantasievollen Bühnenbildner Herbert Schäfer und dem Kostümbildner Andreas Janczyk vertieft. Unter anderem gelang dies durch die Doppelung der 13 Bühnenrollen in Sänger und Schauspieler sowie durch eine Profilierung der Dichterfigur, die vor allem im ersten Teil des Stückes mehr Gewicht und (durch zusätzlich eingefügte Zitate) Stimme erhält. Fischer hat eine recht verkopfte Vorlage in beachtlicher Weise theatertauglich gemacht. Dass Peter Mussbach selbst das nicht so sieht, erfreut die Klatschspalten, sollte aber eine Fußnote in der Auseinandersetzung mit einem Projekt bleiben, das weitere Versuche verdient hat. |
|
Eine Expedition ins (N)irgendwo: Die Oper "Hölderlin" von Peter Ruzicka wurde in Berlin uraufgeführt Der Wirrnis wundersame Pfade Von Jörn Florian Fuchs
Zur Adventszeit 2007 ereignete sich an der Berliner Staatsoper ein künstlerischer Tiefpunkt, der seinesgleichen suchte: Intendant Peter Mussbach inszenierte hilflos und düster beleuchtet einen "Don Giovanni", als Begleitmusik erklang aus dem Graben ein diffuser, merklich kaum geprobter Soundtrack. Der Dirigent hieß Daniel Barenboim und war zu der Zeit sehr intensiv mit dem "Tristan" in Mailand und – vermutlich – mit einer Intrige gegen Mussbach beschäftigt. Wenige Monate später drückte man den auch in finanzieller Hinsicht eher glücklosen Intendanten vorzeitig aus seinem Vertrag. Unglücklicherweise war Mussbach jedoch als Uraufführungsregisseur des zweiten abendfüllenden Opernwerks des ehemaligen Salzburger Festspielchefs Peter Ruzicka vorgesehen, zudem verfasste er auch das Libretto. Bereits beim mittlerweile zurecht öfters nachgespielten Musiktheater "Celan" arbeiteten Ruzicka und Mussbach zusammen. Nach den Querelen rund um die Staatsoper kam letzterer jedoch als Regisseur nicht mehr in Frage, sodass man den nicht gerade einschlägigen Torsten Fischer fürs Szenische verpflichtete. Der biss sich an Mussbachs krudem Textkonglomerat die Zähne aus, strich und änderte einiges, fügte ein paar Hölderlin-Zitate hinzu. Vom neuen Libretto distanzierte sich nunmehr der ursprüngliche Urheber und ließ seinen Namen flugs aus dem Programmheft streichen. Ein peinlicher Abend Übrig geblieben ist also ein veritabler Streit vor und hinter den Kulissen um ein Projekt, das am Sonntag von einer riesigen Anzahl Prominenter verfolgt wurde: Die Komponisten Wolfgang Rihm und Helmut Lachenmann, altehrwürdige Politiker wie Richard von Weizsäcker sowie Showstars (Alfred Biolek) gaben sich die Ehre. Sie alle erlebten einen unerwartet peinlichen Abend, an dem nicht ein einziger Parameter zu stimmen schien. "Hölderlin – eine Expedition" führt ins musiktheatrale Nirgendwo. Ohne Sinn und Sinnlichkeit schleppen sich zwei Stunden lang langatmige Streicherklänge, Mahlersche Tragikkantilenen oder an Luigi Nono erinnernder Chorgesang dahin. Immer wieder durchsetzt eine Art Tristan-Motiv die völlig heterogene Klanglandschaft. Fitness und Fäkalien Auch wenn man die Übertitel aufmerksam verfolgt, bleibt unklar, wohin die Reise gehen soll. Die neue Textfassung besteht aus einer Unzahl (meist gesprochener) Hölderlin-Gedichtzeilen, vermischt mit kitschigem Schwulst und peinlichen Fäkalsentenzen. Inhaltlich geht es angeblich um eine Gruppe (gestorbener) Menschen, die die Chance auf ein zweites Leben erhalten. Reflektionen über das Vergangene, einen gegenwärtigen Nicht-Zustand sowie eine (mögliche?) Utopie gehen parallel mit derbem Sozialrealismus einher: Man spricht über (oder auch wie in) Fernsehtalkshows, über misshandelte Kinder oder Fitnesswahn. Dazu gibt es ein paar Kämpfe zwischen Individuen und größeren Gruppen, eine Führerstatue erscheint und verschwindet wieder, Leute von heute treffen auf Menschen von gestern mit Frack und Zylinder. Völlig konfus bleibt dieses Bühnen-Gewusel, keine einzige Szene erklärt oder hellt etwas auf. Fototapeten zeigen triste Wohnblocks, einmal fährt eine Plastikwand herunter, der gesamte Bühnenboden ist mit Wasser geflutet. Eigentlich sollten hier auch Götter sowie Hölderlins Dramenheld und Alter Ego Empedokles auftreten, was für normalsterbliche Zuschauer indes nicht erkennbar wurde. Was Ruzicka, dieser kluge und eigentlich mit allen Mitteln der musiktheatralen Avantgarde gewaschene Seelen(er)forscher, an dieser Nicht-Geschichte interessiert, ist schlicht unbegreiflich. Warum seine Musik zudem als bloßer, mäßig inspirierter Eklektizismus mit Hang zu endlosen Repetitionsmustern daherkommt, bleibt ebenso rätselhaft. Bleibt zu erwähnen, dass die Staatskapelle Berlin unter Ruzickas Leitung immerhin präzise spielte und einige Sänger exzeptionell sangen (vor allem Dietrich Henschel, Stephan Rügamer, Anna Prohaska und Anne-Carolyn Schlüter). Am Ende gab es kurzen, freundlichen Applaus, einige deutliche Buhs für die Inszenierung, wenige für Ruzicka. In den Gesprächen danach: betroffene Ratlosigkeit. |
|
Utopie eines befreiten Lebens Von Georg-Friedrich Kühn Nach der "Celan"-Uraufführung wurde Peter Ruzicka gefragt, was er sich als nächstes Opernprojekt vorstellen könnte. Hölderlin, antwortete er spontan - und entwarf das Werk zusammen mit seinem damaligen Librettisten, dem Regisseur Peter Mussbach. Doch nach Mussbachs Rausschmiss von der Intendanz der Berliner Staatsoper gab es Komplikationen, die möglicherweise noch zu rechtlichen Auseinandersetzungen führen. Es ist eine Versuchsanordnung, und sie stellt die alte Frage: Was wäre wenn? Was wäre, wenn man sein Leben noch einmal leben könnte? Was würde man ändern? Hier sind es 13 Figuren, die nach einer Katastrophe von den Göttern eines imaginären Griechenland wieder erweckt werden und diese utopische Chance erhalten. Und sie nehmen sich dazu Hölderlin, seine Philosophie, als quasi Kompass. Ruzicka: "In dieser utopischen Vision eines befreiten Lebens, eines Lebens jenseits der Beschädigung des Alltags und mit den Möglichkeiten, die Hölderlin in seinem Werk thematisiert, des Eins-Seins mit der Natur, der Selbstfindung - in dieser Perspektive bleibt diese Utopie. Und der offene Schluss gibt das Heft des Geschehens an den Zuschauer zurück." "Hölderlin. Eine Expedition" nennen Peter Ruzicka und Peter Mussbach ihre nach "Celan" zweite gemeinsame Arbeit. In seinem Libretto mischt Mussbach eigene Texte, Realien wie die Geschichte jenes Mädchens, das die Eltern haben verhungern lassen, mit Texten von Hölderlin. Hölderlin und seine Kunstfigur Empedokles durchwandern und durchleiden eine ihrer Spiritualität verlustig gegangene Welt bis ins Außerirdische. Die Musik Peter Ruzickas grundiert das mit "Als-ob-Zitaten", die Romantik assoziieren sollen. Bestimmte "Module" kehren immer wieder: Eine Art "Tristan"-Musik, ein Mahlerscher Trauermarsch oder lang gezogene Streicher-Unisoni. "Ferne Choräle" der Erinnerung sind das, immer wieder aufgerissen durch harte Orchesterschläge. Mussbach sollte und wollte das ursprünglich auch selbst inszenieren. Die Überlegungen, die er dafür angestellt hatte, reichten, wie bei einem Regisseur wie ihm nicht anders zu erwarten, auch schon über das eigene Libretto hinaus. Nach Mussbachs "Freistellung" von der Staatsopern-Intendanz im Frühjahr wurde Torsten Fischer mit der Uraufführungs-Inszenierung betraut. Fischer seinerseits fügte kleine Erweiterungen ein, derentwegen Mussbach dann zunächst eine Aufführung verhindern wollte. Nun behält er sich eine Klage vor. Die Staatsoper kennzeichnet die Aufführung als "Berliner Fassung". Regisseur Fischer: "Ich habe auf Wunsch von Herrn Ruzicka [mit dem Dramaturgen der Staatsoper, der auch der von Herrn Mussbach war] an den Stellen, die Herr Mussbach ausgesucht hat, recherchiert. Und wir meinten, teilweise insgesamt drei Sätze von Hölderlin öffnen zu müssen. Und um diese drei Sätze habe ich in meiner Interpretation dieses Werkes versucht, das Libretto zu ergänzen." Im Bühnenbild von Herbert Schäfer entfacht Fischer eine der Hermetik und Innerlichkeit Hölderlins eher entgegengesetzte Turbulenz. Die in Zylindern gekleideten Götter fischen anfangs aus einem fast bühnenfüllenden Pfuhl die Menschen, die sie wiederbeleben. Der zweite Akt ist ein Gang durchs beschädigte Leben zwischen Hochhaus-Silo und Pflegeheim. Die in dem Pfuhl als Plattform ausgelegten Gitterroste werden im dritten Akt zu Barrikaden gegen eine Diktatur. Am Ende ist das "geschmolzene Eis" eine Art Lethe-Fluss des Vergessens, durch den hindurch Hölderlin den Menschen den Weg weist. "Leben ist Tod, und Tod ist auch ein Leben", wie es im Zitat heißt. Über die Schwächen des textlastigen Buchs und der meist nur sphärischen Musik kann das nicht hinwegtäuschen. Der zweistündige Abend wirkt langatmig, flüchtet sich in Äußerlichkeiten, hat durch die vielen von Schauspielern gesprochenen Hölderlin-Zitate auch mehr was von Melodram und Vorlesestunde denn Musiktheater. Durch Ruzickas eigenes Dirigat bekam er musikalisch gleichwohl Authentizität. Dietrich Henschel ist als "Mann 1" ein höchst präsenter Hölderlin, vom Publikum am meisten applaudiert. Mussbach selbst zeigte sich nicht. Die Prügel durfte der Regisseur einstecken. |
|
www. Opernnetz.com18. November 2008 Tiefe Depression
Es heißt „Eine Expedition", und es ist zu erleiden eine hochdepressive Wasserwanderung der unbehausten Gott-, Menschen- und Todsuchenden. Peter Mussbach hat sich – als Kompilator der Hölderlin-Texte - von der aufgeführten Version distanziert, wohl weil weitere Zitate eingefügt wurden, die ihm zu handlungsorientiert erschienen. Torsten Fischer inszeniert diesen narrationslosen Rezitationsabend im Stil des expressiven Theaters der Zwanziger Jahre, schafft immer wieder dramatische Massenszenen, weckt Leidenschaften und setzt Hölderlins zerquälte Prosa um in berührendes Bühnenhandeln – scheitert aber permanent an der kaum möglichen Identifizierbarkeit der Personen: gesungene, gesprochene und mit den Mitteln des Ausdruckstanzes artikulierte „Philosophie" entzieht sich offenbar jeglicher kommunikativen Opern-Ästhetik. Herbert Schäfers dramatisierend-monumentale Bühnenbauten – ein Gitterboden bedeckt die wassergefüllte Bühne, begrenzt von unwirtlichen Fassaden der Massenbauten, Projektionen auf durchsichtige Vorhänge vermitteln quälende Assoziationen – schaffen variable Handlungsräume - in ihrer rigiden Abstraktion aber ohne Compassion auslösende Effekte. Peter Ruzicka hat zu diesen hochpoetisch-unsinnlichen Hölderlin-Texten eine nahezu meditative Musik komponiert – mit spätromantischen Anklängen, elektronischen Verstörungen, impressionistischen Versatzstücken, aufwallenden Perkussion-Einsätzen, flirrenden Winden und faszinierenden Momenten bedrückender Stille. Ruzicka vertraut in seinem beinah unterkühlt wirkenden Dirigat offenbar der stupenden Professionalität der Staatskapelle Berlin; es entsteht ein eingängig-unaufgeregt-vielschichtiges Klangbild – mit einem frappierend raumfüllenden Streicherkorpus als absolut verlässliche Basis. Für die dreizehn Gesangs-Solisten stellt sich die schwierige Aufgabe, mit kurzen Passagen des Sprechgesangs Ausdruck zu vermitteln; das gelingt mit sehr viel Sensibilität für die Bedeutungs-Gehalte der inhaltsschweren Text-Rudimente! Den dreizehn Schauspielern verbleibt das dramatische Deklamieren von aktuell-plakativen und fragmentarischen Hölderlin-Zitaten. Die heroische Kollektiv-Leistung der Staatsopern-Statisterie - zwei Stunden bis über die Knöchel im dümpelnden Wasser - verdient absolute Bewunderung! Das Berliner Premieren-Publikum - mit viel Prominenz im Parkett - wirkt während der Aufführung kollektiv gespannt und hoch aufmerksam; doch im konkreten Umfeld sind mit Weg-Schlummern, Blättern im Programmheft, Flüstern mit dem Nachbarn, versteckte Blicke auf die Uhr Zeichen abnehmender Spannung zu bemerken. Höflicher Applaus für Peter Ruzicka, Buhs und Bravos für das Regieteam, Respekt für die Protagonisten – Peter Mussbach kommt nicht vor den Vorhang. (frs)
nnnnn Musiknnnnn Gesang nnnnn Regie nnnnn Bühne nnnnn Publikum nnnnn Chat-Faktor |
|
FINANCIAL TIMES
Hölderlin By Shirley Apthorp Presumably there was no curse upon the Berlin Staatsoper, but there might as well have been one. When Peter Mussbach penned the libretto for Peter Ruzicka's new opera, Hölderlin , the Intendant of the Berlin Staatsoper meant to stage it himself. Six months before the opening, political ructions led to Mussbach's ousting. His name was also struck from the job of stage director. Torsten Fischer was found to fill the breach. Fischer's job was not an enviable one. Mussbach's text is fabulously convoluted, Ruzicka's score fastidiously complex and the working atmosphere after such an exodus must have been horribly fraught. Just over a week before the premiere, Mussbach threatened legal action. Fischer had added three Hölderlin quotes to the libretto. Mussbach refused to authorise the changes, and demanded that his name be removed as author. As so often in Berlin, the offstage drama became more interesting than the end result. Hölderlin received its world premiere on Sunday without the endorsement of He Who Must Not Be Named. The finished product, after all that excitement, is frankly dull. Under the circumstances, dull rather than dreadful is a praiseworthy achievement. Fischer has found his own language for Mussbach's tangentially associative text. His images have their own nightmare beauty, and his cast moves with disciplined conviction. Ostensibly, this piece is about 13 individuals who must begin a new life after a catastrophe, incidentally tracing Hölderlin's influence on modern thought over two and a half centuries of history. You have to read the programme book to know this. Text and action are a tangle of shouted phrases and disjointed references, with tales of horror from today's tabloids intermingled with snatches of historic poetry. Fischer and his design team (sets: Herbert Schäfer; costumes: Andreas Janczyk) trot us from 19th-century corsets via Nazi stormtroopers to today, all the characters sloshing through inches of water throughout. Gods and icons are thrown in for good measure. Ruzicka's score quotes Wagner ad nauseam, and borrows swatches of other "suffering" motifs from music history. Ruzicka sets long-winded melodies for unison upper strings against scampering percussion effects, or gives the full orchestra handfuls of ascending and descending scales. For two hours there is no hint of light relief or sense of forward motion. He conducts with detached efficiency. Twelve singers, including Dietrich Henschel, Anna Prohaska and Stephan Rügamer give their all. This is a laudable realisation of a mediocre work under unfortunate circumstances. |
|
HÖLDERLIN, MA LA POESIA DOV'È? A Berlino debutta l'"Hölderlin. Eine Expedition" di Mussbach con musica di Ruzicka
In tempi di pensiero debole, l'utopia ha il respiro corto e il messaggio rischia di annacquarsi in pedante ovvietà. È questo forse il limite maggiore della nuova creazione di Ruzicka e Mussbach, alla seconda collaborazione dopo il più riuscito "Celan". Il soggetto: dopo aver vissuto i passaggi più significativi dell'esistenza, una catastrofe naturale porta i tredici protagonisti nel grigiore condominiale del mondo contemporaneo. In un contesto di incomunicabiltà e violenza, di indifferenza alla vita come alla morte, si impone un tiranno che riporta l'ordine con la paura. La liberazione dalla tirannia apre alla speranza in un mondo in cui gli dei sono morti ma che vede riconciliati uomini e natura. Dunque, l'Hölderlin del titolo è poco più di un pretesto per un libretto piuttosto abile nell'incastro di citazioni hölderliniane ma dalle gracili ali, che non lo sollevano negli spazi infiniti della poesia. Nuocciono un eccesso di verbosità (soprattutto nell'insostenibile finale) e un certo banale didascalismo. Con il sostegno fondamentale della brillante Staatskapelle Berlin e dell'impeccabile compagnia di canto, Ruzicka fornisce una sontuosa colonna sonora, in cui spiccano le articolate percussioni e prevalgono le ampie arcate mahleriane, vero e proprio tessuto connettivo dell'eterogenità di veicoli espressivi dispiegati nel testo (recitato, melologo, canto). In tempi di pensiero debole, semplificare paga: ne è conferma la buona accoglienza del pubblico berlinese. Qualche contestazione, in odore di claque, solo a Torsten Fischer, che firma uno spettacolo lineare e con belle immagini, nel quale l'acqua è molto presente. Verosimilmente pesano i contrasti con Mussbach provocati dalle aggiunte al testo non autorizzate, per le quali il librettista annuncia azioni legali. Stefano Nardelli |