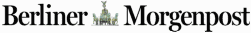|
Ruzicka’s HÖLDERLIN to be premiered in Berlin To cease that eternal conflict between our self and the world, Composers have made literary source material into the subjects of their operas a number of times. Verdi’s Shakespeare-Operas "Macbeth" and "Othello," Bizet’s "Carmen" based on the French novella by Prosper Merimée and Alban Berg’s "Wozzeck" based on Georg Büchner’s play are just a few examples. The invocation of a poet himself, on the other hand, as the source material of an operatic plot, is a rare occurrence. Peter Ruzicka, who celebrated his 60th birthday this year on 3 July, has so far written two operas and, in both cases, focussed on poet personalities. The world premiere of his new opera HÖLDERLIN in Berlin on 16 November is now forthcoming. CELAN was the name of Ruzicka’s first opera to a libretto by Peter Mussbach, premiered on 25 March 2001 at the Semperoper in Dresden. The subtitle "Music Theatre in Seven Sketches," as the composer then commented, refers to an open, process-like structure. CELAN is not a musical biography about the Jewish poet Paul Celan, who was born in Czernowitz in Bukovina, experienced the persecution of the Jews there and emigrated to Paris via Bucharest, Budapest and Vienna and – driven by feelings of guilt at having escaped – searched for a language to express the unforgotten, incomprehensible aspect of the Holocaust. Ruzicka himself met the poet in 1970, shortly before the latter’s suicide. The fate and the motives of this poet and his unique oeuvre have never lost their grip on Ruzicka. "Paul Celan described a wound of the twentieth century: spiritual shock by the Holocaust and the identity of our society which we are trying to find, precisely after this twentieth-century event." Hölderlin, too, the great puzzling hymn poet of a period of upheaval, is an author who was broken by the contradictions within himself and in his environment. On 16 November 2008, Peter Ruzicka’s opera HÖLDERLIN will receive its world premiere at the State Opera Unter den Linden in Berlin. Who was this poet, who lived from 1770 until 1843, was descended from the thought and poetry of the Enlightenment and who accompanied the Romantic era with his hymns, created under the impression of an intensive experience of nature with a completely individual poetic language? Hölderlin’s encounter with Friedrich Schiller in 1794 was decisive for the course of his life. Hölderlin, who hailed from Lauffen am Neckar and had completed theological studies in Tübingen, received a post as a private tutor for Charlotte von Kalb in Weimar, thanks to Schiller. In 1796 he became a private tutor in the household of the Frankfurt banker Gontard, to whose wife Susette he soon developed a deep attachment. The critical opinion of Goethe and Schiller concerning the young Hölderlin can be gathered from a letter written by Schiller to Goethe in 1797. It reads as follows: "I would like to know if these Schmidts, these Richters, these Hölderlins would have remained so subjective, so eccentric, so one-sided, absolutely and under all circumstances, whether this unfortunate effect is due to something primitive or simply to the lack of aesthetic nourishment and outside influences, and the opposition of the empirical world in which they live against their idealistic inclination. I am very inclined to believe the latter, and if a powerful and happy nature immediately triumphs over everything, I think that some good talent is lost in this way." Hölderlin wandered restlessly from one European city to the next, was a private tutor for a short period in St. Gallen and Bordeaux and, in 1802, set out on a strenuous hike home from France. His mental state darkened during these years. In 1807, Hölderlin was discharged from the sanatorium in Tübingen as incurable and spent the remaining four decades of his life in the custody of a local carpenter family. Numerous poems were created in the isolation of his existence in the "Hölderlin Tower" in Tübingen. Hölderlin died in Tübingen on 7 July 1843. Peter Ruzicka has responded as follows to a series of questions concerning his new music theatre HÖLDERLIN: After CELAN, your second opera is also dedicated to a poet. Was this pure chance or is there a programme behind it? Ruzicka: At the premiere celebrations of CELAN in April 2001 in Dresden, Giuseppe Sinopoli, my friend who unfortunately died much too soon, asked me what the subject of my next opera would be. I replied "Hölderlin," completely spontaneously, without being able to explain it in more detail at the time. But it is clear to me that these two poets have in fact become decisive fixed points in my thinking. They appear to me as two focal points of an aesthetic ellipse over the centuries. With CELAN you expressly pointed out that no stations in the life of the poet would be arranged chronologically. Do you pursue a similar concept in HÖLDERLIN? Ruzicka: I certainly did not want to write a biographical opera. The idea of a Hölderlin singing in the Tübingen tower would have been rather bizarre. Peter Mussbach, who created the textual basis, and I are far more concerned with the history of a collective of 13 persons who have the possibility, after an unspecified catastrophe, to begin their lives a second time. And Hölderlin’s philosophy may be represented here as an intellectual compass in this second life; the point is mankind’s eternal longing for unity with himself and nature, with himself and the world. Why do you call the opera an "expedition" in the subtitle? Ruzicka: The starting point for the 13 individuals who are starting their lives over again, but who are also thrown back into it, is a common starting point. They experience scenes which are adventurous and dangerous, sometimes reminiscent of a freefall. These are scenes which are absurd, crazy and without any guarantee of survival. Are the poet Hölderlin and his work as relevant today as they were then? Do people read Hölderlin nowadays? Ruzicka: I don’t know any other poet who is as relevant and significant for us today, at the beginning of a spiritually marked 21st century! What is Hölderlin’s most important text, in your opinion? Ruzicka: This text is at a hidden spot. It is the fragment "Das Werden im Vergehen" (Becoming in Passing Away) and is about the downfall or the transition of the "fatherland." What role do Hölderlin’s original texts play in the libretto? Ruzicka: I did not want to actually dramatise Hölderlin texts in the opera. However, there is a series of Empedocles fragments which is given the significance of the aforementioned "compass" at central points. Then there is a series of fragmentary texts which are primarily recited by actors as an "inner voice." I hope that these texts will be perceived by the spectator as realisations from the subconscious. How should we imagine the music of HÖLDERLIN? Is it similar to that of CELAN? Ruzicka: It has a different basic sound – darker, but also more flowing, more of a stream. Before I began the score of the opera, I wrote a preparatory orchestral piece entitled VORECHO (Pre-Echo), which has meanwhile been performed in Madrid, Berlin, Vienna and Hamburg. My impression is that the sound space is at any rate deeper, more expanded… In what ways do your operas HÖLDERLIN and CELAN essentially differ, aside from their subjects? Ruzicka: In the CELAN project, I completely dispensed with the inclusion of original texts because their language has always seemed to me to be imbued with music, one could also say "composed." CELAN is an opera about the Holocaust and reflects this largest, probably never-healing wound of the twentieth century with the help of fictitious life-situations of the poet. HÖLDERLIN, on the other hand, is an opera which attempts to pose questions about our present and future: is there Hölderlin "in us?" There was a surprising change of producer. What were the reasons? Ruzicka: After Peter Mussbach left his post as Director of the State Opera Unter den Linden, a new production team also had to be found, which was not easy due to the late point in time a few months before the beginning of rehearsals. I am glad that the producer Torsten Fischer could be found for the project; he has a great deal of understanding for the special intellectual dimensions of the project and has found an approach of great scenic imagination. From the very outset, he has gone into the special musical parameters of the score and yet developed his own concept as a completely independent interpretation. So there will be 13 actors at the side of the 13 singers who will symbolise Hölderlin’s idea of a dichotomy of gods and human beings. Since I shall be conducting the premiere, I am greatly looking forward to an exciting collaboration in the sense of giving and taking… |
|
KOMPONIST PETER RUZICKA Komponist Peter Ruzicka über das Lebenswunder Oper und die Arbeit in Salzburg und Berlin.
In Berlin hat er das Deutsche Symphonie-Orchester geleitet, in Hamburg das Opernhaus und zuletzt als Intendant die Salzburger Festspiele. Doch seit zwei Jahren geht der 1948 geborene Peter Ruzicka wieder dem nach, was ihm vor allem am Herzen liegt: dem Komponieren. Am kommenden Samstag wird seine Oper „Hölderlin. Eine Expedition" an der Berliner Staatsoper uraufgeführt. Herr Ruzicka, die Umstände, unter denen das Werk jetzt uraufgeführt wird, sind nicht gerade glücklich. Eigentlich sollte der inzwischen entlassene Intendant Peter Mussbach, der auch das Libretto verfasst hat, das Stück auf die Bühne bringen. Jetzt hat Mussbach gegen die Inszenierung des Ersatzmannes Torsten Fischer protestiert und ursprünglich sogar mit Klage gedroht. Für mich gehört es zu den Theaterwundern, dass Torsten Fischer, der die Inszenierung im Juni übernahm, es in dieser extrem kurzen Zeit nicht nur geschafft hat, das Stück zu durchdringen, sondern ihm sogar noch weitere Interpretationsschichten zu erschließen. Fischer hatte auch die Idee, zusätzliche Originaltexte Hölderlins in den musikalischen Ablauf zu integrieren. Dabei hat er meine volle Zustimmung. An Mussbachs Text wird jedoch kein Wort verändert – er wird auch vollständig im Programmheft abgedruckt. Peter Mussbach hat deshalb auch auf eine Klage gegen die Staatsoper verzichtet, die ohnehin keine Aussicht auf Erfolg gehabt hätte. Nach Ihrem Erstling über Paul Celan haben Sie sich erneut ein tragisches Dichterschicksal ausgesucht. Die Entscheidung für Hölderlin ist eher intuitiv gefallen. Bei der Premierenfeier meiner Celan-Oper 2001 in Dresden fragte mich Giuseppe Sinopoli nach dem Stoff für eine weitere Oper, die er an der Scala uraufführen wollte. Und da sagte ich ihm ganz spontan, dass dieses Werk wohl eine Hölderlin-Oper sein werde. Innerlich war mir sofort klar, dass dieser Stoff die nötige Schaffensenergie bei mir zünden würde. Hölderlin war für mich seit jeher eine prägende Figur. Sowohl Celan wie Hölderlin haben an ihrer Umwelt gelitten. Leiden Sie auch? Das Leiden ist ganz alltäglich. An dem Taxifahrer zum Beispiel, der heute Vormittag trotz inständiger Bitten nicht bereit war, die Heavy-Metal-Musik abzustellen. Oder an der Selbstentblößung, die man in irgendwelchen Nachmittags-Talkshows im Fernsehen vorgeführt bekommt. Oder schon allein am Verlust der Stille: Überall wird man von Hintergrundmusik belästigt, was den Menschen immer mehr die Fähigkeit zum Zuhören, zum Aufeinander-Eingehen nimmt. Solche Beschädigungen spiegeln sich auch in der Oper: Die Figuren gehen auf eine Zeitreise, von der aus sie auf eine beklemmende Gegenwart zurückblicken, die auch aus Talkshows, Fitnesscentern und Kriminalität besteht. Man darf sich unter Ihrer Oper also keine Erzählung von Hölderlins Leben und Leiden vorstellen? Nein, so etwas wie einen singenden Hölderlin im Turm kann man heute gewiss nicht auf die Bühne stellen. Schon bei Celan habe ich mich ja auf biografische Andeutungen und Spiegelungen beschränkt, hier fehlen sie ganz. Ich glaube, die Oper hat wenig Talent, um Künstlerbiografien bloß nachzustellen. Das können andere Medien besser. Wenn das Leben des Dichters keine Rolle spielt, worum geht es denn dann? Hölderlin und sein Denken erscheinen in der Oper wie ein Kompass bei der Findung eines möglichen neuen Lebens. Es geht um die Frage, ob es für unsere Gesellschaft noch Hoffnung gibt oder ob sich die Geschichte mit ihren Katastrophen einfach immer wiederholt. Und? Gibt es Hoffnung? Es gibt zumindest die Möglichkeit, dass wir uns ändern. Ich glaube an das „Yes, we can". In der Oper wird eine solche Botschaft durch alle Widerständlichkeit hindurchgezweifelt in eine Sphäre, die zulässt, dass eine Gesellschaft etwas lernt. Sucht man nach einem gemeinsamen Nenner zwischen dem Dichter Hölderlin und dem Komponisten Ruzicka, fällt einem schnell der Begriff Fragment ein. Mir wurde früher manchmal vorgehalten, dass ich eine eigene Fragmentästhetik verfolge. Aber dies war nie so angelegt: Ich stellte einfach fest, dass zuweilen das Material die Spannung der musikalischen Entwicklung nicht aushielt. Und statt das Werk in eine Form zu zwingen, habe ich die klingenden Gestalten als Bruchstücke, als Zeugnisse produktiven Scheiterns stehengelassen. Die Oper verlangt freilich einen großen Bogen, der ein Ganzes definiert. Aber auch hier gibt es Räume, reflexive Momente, in denen die Musik auf sich selbst zu hören scheint, Klangschatten entstehen. Sie sind ja nicht nur Komponist, sondern als Chef der Münchener Biennale und ehemaliger Intendant der Salzburger Festspiele auch nicht ganz ohne Einfluss in der Kulturszene. Nutzen Sie das, um Ihren Werken zu helfen? Nein, ich entlasse meine Werke und freue mich, wenn sie wiederaufgeführt werden. Meine Celan-Oper wird im nächsten Jahr etwa in Bremen und Bukarest neu inszeniert. In Bremen realisiert das Vera Nemirova, die als junge Regisseurin das Stück völlig anders sieht als die drei Regisseure zuvor, die auf jeweils ganz eigene Weise stimmige Perspektiven eröffnet hatten. Sehen Sie da bei der Generation dreißig plus grundsätzlich neue Fragen an die Kunstform Oper? Solche Paradigmenwechsel werden stets vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Aber ich denke schon, dass neue Sichtweisen bevorstehen könnten: dass die Begabten dieser Generation das Verhältnis des Künstlers zur Gesellschaft vielleicht neu definieren, dass der Begriff des künstlerischen Fortschritts wieder eine Bedeutung erhält. Der Überdruss an der Zeichensprache der Postmoderne ist jedenfalls manifest. Ihr Name wird in Berlin immer wieder genannt, wenn es um Intendantenposten geht: bei den Philharmonikern, an der Staatsoper oder an der Deutschen Oper. Hätten Sie überhaupt Lust dazu, eine dieser Aufgaben zu übernehmen? Als Intendant hätte ich ja die Aufgabe in Salzburg fortführen können. Ein Vertrag bis 2011 lag schon auf dem Tisch. Ich habe mich aber entschlossen, meinen künstlerischen Freiraum zurückzugewinnen. Sonst hätte ich mich wohl als Komponist verabschieden müssen. Ich hatte damals das Beispiel meines Hamburger Amtsvorgängers Rolf Liebermann vor Augen: Als er nach 20 Jahren Intendantentätigkeit wieder Komponist sein wollte, wurde er damit nicht mehr glücklich – die ästhetischen Koordinaten hatten sich zu stark verändert. Das Kapitel Intendant ist für Sie also abgeschlossen? Ja, die Entscheidung ist unwiderruflich, auch weil ich nach Salzburg wieder erkannt habe, dass die Freiheit als Künstler durch nichts aufzuwiegen ist. Ich nehme nur die Münchner Biennale aus, die ich von meinem Lehrer Hans Werner Henze übernommen habe. Ich glaube, dass der dortige Dialog mit den Komponisten der jungen Generation zu den schönsten Aufgaben zählt, denen man sich stellen kann. Das Gespräch führte JÖRG KÖNIGSDORF. |
|
OPER Am Sonntag dirigiert Peter Ruzicka an der Staatsoper die Uraufführung seines "Hölderlin. Eine Expedition". Das Libretto stammt von Peter Mussbach, dem im Frühjahr geschassten Intendanten der Staatsoper. Mussbach sieht sich als Regisseur von Torsten Fischer verdrängt, er hatte juristische Schritte gegen die neue Regiefassung des Stückes erwogen. Mit Komponist Peter Ruzicka sprach Volker Tarnow. Berliner Morgenpost: Ist Mussbachs Verärgerung angesichts der fremden Zusätze in seinem Libretto nicht verständlich? Peter Ruzicka: Es geht innerhalb der zwei Stunden Spieldauer letztlich um zwei Minuten. Hier sind aus dramaturgisch gliedernden Gründen durch den Regisseur weitere Hölderlin-Zitate eingefügt worden. Peter Mussbachs Libretto, das bereits originale Texte von Hölderlin enthält, wird als solches also gar nicht berührt. Ich habe ihn gerade eingeladen, sich vor einem abschließenden Urteil doch erst einmal die Endproben der Produktion anzusehen. Kein Bühnenschiedsgericht würde hier eine Entstellung des Librettos annehmen. Richten sich seine Bedenken nicht eher gegen die Inszenierung von fremder Hand? Jeder Regisseur wird mit seiner Interpretation eines Werkes zwangsläufig einmal vom Wortlaut abweichen, selbst wenn es sein eigener Text ist. Das wäre Peter Mussbach mit dem Hölderlin ebenfalls passiert. Es kann in Wahrheit keine authentische Inszenierung geben. In Wagners Tannhäuser werden ja auch keine Tiere geschlachtet, obwohl dies eigentlich so vorgesehen ist. Wie viel Hölderlin steckt in Ihrem Hölderlin? Es ist keine biographische Oper. Hölderlin tritt nicht auf. Aber seine Dichtung, sein Denken mögen als beständiger Kompass dienen, einen Ausweg aus dem beschädigten Leben zu finden. Also alles sehr frugal, klirrend kühl und trostlos? Nein, überhaupt nicht, die Oper beschreibt immer wieder emotionale Grenzsituationen, selbst in den Trash-Szenen, die unsere heutige Lebenswirklichkeit grell widerspiegeln. Umso nachdrücklicher versucht die Musik einen Ausweg. Und entsprechend weit und licht werden am Ende die Räume. Was kann Musik denn aus Ihrer Sicht inmitten des allgemeinen Kulturverfalls überhaupt noch bewirken? Natürlich hat jeder von uns pessimistische Szenarien im Kopf. Aber es gibt immer auch die Möglichkeit der Versöhnung, der Selbstfindung des Menschen. Kunst kann die Sensibilität der Wahrnehmung schärfen und damit ungeahnte Perspektiven eröffnen. Man darf sich weder in der Kunst noch in der Politik einfach bequem abfinden mit dem, was geschieht. Sehen Sie doch die USA: dort wurde ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg inszeniert und dabei das ganze Volk, ja die ganze Welt belogen aber plötzlich zeigt sich, dass aus der erkannten Wahrheit doch reale politische Konsequenzen gezogen werden können. Und richtige Impulse zu setzen, das bleibt auch eine ästhetische Herausforderung! Inwiefern? Seit Jahren werden Begriffe wie Fortschritt oder Avantgarde in der Musikszene nicht mehr benutzt. Wir haben uns in der Postmoderne behaglich eingerichtet. Aber auf Dauer ist dieser Zustand ungenügend, es entsteht jener Überdruss an den ewig gleichen Produkten, an der Verdinglichung und Kommerzialisierung von Kunst. Es ist Zeit, aus diesem Bannkreis auszubrechen. Die Opern von Helmut Lachenmann, Brian Ferneyhough und Chaya Czernowin haben bewiesen, dass es geht. Ist "Hölderlin. Eine Expedition" eine Fortsetzung Ihrer Celan-Oper? Mir war wichtig, den musikalischen Eigenklang von Celan weiterzuentwickeln, der sehr hart und streng war. Der Hölderlin hat dagegen einen eher stürmenden Duktus und versucht nicht zuletzt durch einen Chor, der im Orchester sitzt, eine noch größere Klangtiefe. Steht der Intendant Ruzicka nicht manchmal dem Komponisten und Dirigenten Ruzicka im Weg? Zumindest in meiner Salzburger Intendantenzeit fühlte ich mich richtig gespalten. Der Künstler musste sich erst gegen den Kunstmanager durchsetzen, um seine Freiheit wiederzugewinnen. Und mit der Münchener Biennale habe ich ja noch genug Gestaltendes zu tun. Für einen Intendantenposten in Berlin stehen Sie jedenfalls nicht zur Verfügung. Das Stiftungsgesetz für die drei Opernhäuser wurde leider bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt verwässert. Was soll ein Generaldirektor, der künstlerisch nichts zu sagen hat, der nicht einmal über Querfinanzierungen entscheiden darf! Sogar die typischen Doubletten sind im Programm anzutreffen wie eh und je. Unter anderen Umständen wäre Berlin damals vielleicht eine Alternative gewesen zu Salzburg. Heute genieße ich den wieder gewonnenen Freiraum als Komponist und Dirigent. Ziehen Sie nicht Instrumentalmusik eigentlich der Oper vor? Nein, das Musiktheater hat mich fasziniert, seit ich als Elfjähriger die Uraufführung von Henzes "Prinz von Homburg" hörte. Es war mein erster Opernbesuch! Die gewaltige Sprengkraft dieses Stückes versetzte mich in Aufruhr. Ihre nächste Oper wird also nicht lange auf sich warten lassen. Vielleicht schreibe ich ein Bühnenwerk in kleinerem Format, vielleicht auch wieder mit dichterischem Bezug. Aber wer könnte neben Paul Celan und Hölderlin stehen! Wir schlagen Novalis vor. Herzlichen Dank, mir wurde auch schon Theodor W. Adorno vorgeschlagen. Die Frage muss offenbar bis zur Premierenfeier gelöst sein. |
|