|
In den knisternden Müllbergen der Geschichte VON HANS-JÜRGEN LINKE Es ist kein Land für alte Männer. König Lear, noch ganz im Bewusstsein seiner Machtfülle, will sein Erbe regeln und ruft vom Thron aus unter seinen Töchtern einen Wettbewerb aus, welche ihn am meisten liebe. Und weil er Worthülsen nicht von Wahrheiten unterscheiden kann, liefert er sich sogleich aus, ein großes Bedrängen, Augenausstechen, Bekriegen, Metzeln und Morden hebt an, die wenigen Überlebenden bleiben fassungslos zurück. In Aribert Reimanns 1978 in München uraufgeführter Oper "Lear", die den Königstitel vermeidet und dem Drama damit etwas Universelles gibt, weiß die Musik von Anfang an Bescheid. Obwohl in Keith Warners Inszenierung für die Oper Frankfurt der Narr (Graham Clark) als Erster auf der Bühne zu sehen ist und ein Kartenhaus baut, liegt die Idee, dass hier etwas Komisches oder Groteskes geschehen könnte, fern. Alles ist düster, und die Düsternis ist kompositorisch gestaltet, so dass sie von Anfang an alles einhüllt und einfärbt. Es ist mal eine leise herumdämmernde Düsternis, die Licht wie eine Sinnestäuschung erscheinen lässt, mal ist es eine bedrohlich umherziehende oder heranwallende, mal eine schreiend alles überlagernde Düsternis. Wer hier singt, ist allein Auch drei Jahrzehnte nach der Uraufführung kann diese Musik staunen machen: wie eindeutig, umfassend und ausweglos sie Atmosphäre gestaltet, wie sehr sie sich von der Aufgabe, Gesang zu untermalen, emanzipiert hat und wie sehr andererseits der Gesang melodisch und agogisch allein der Sprachunterstützung dient: Wer in dieser Oper singt, ist mit seinem Text einsam und ohne Rückhalt wie auf einem leergefegten Trümmerfeld zurückgelassen. Aribert Reimanns "Lear" ist kompositorisch von größter Eindringlichkeit, die sich heute vielleicht noch besser würdigen und realisieren lässt als zur Zeit ihrer Uraufführung: Dirigenten, Orchester und Publikum sind, was ihre Interpretations- und Hörfähigkeiten anbelangt, längst in einem weniger unschuldigen Stadium angelangt als damals. Und so ist der Druck, mit dem die Musik ihre starke Präsenz entfaltet, zu einem nicht unbeträchtlichen Teil ein Verdienst der Arbeit, die Sebastian Weigle mit dem Orchester der Oper Frankfurt geleistet hat. Was zu hören ist, ist nie zu laut, stets von mustergültiger Differenziertheit und Dichte, von lupenreiner klanglicher und dynamischer Präzision und Durchhörbarkeit. So wird die Musik verständlich in ihrer dramatischen Autonomie und der immensen Bedeutung, die sie hier einnimmt. Sie besetzt eine eigene Erzählebene und definiert ihren Horizont, und das Premierenpublikum wusste diese famose Leistung Weigles und seines Orchesters zu würdigen. Was kann die bildgebende Arbeit von Regie und Bühnenbild dagegen ausrichten? Zum Glück unternehmen Keith Warner (Regie) und Boris Kudlicka (Bühne) nichts gegen die Musik. Kudlicka schafft stilisierte Handlungsräume und baut sehr wirkungsvolle, vieldeutige Videoprojektionen (Evita Galanou, Thomas Wollenberger) in seine Räume ein, die eine Zeit lang sogar als sich drehender Raumteiler fungieren und der Handlung in einer beschleunigten Phase Plausibilität und der Bühne einen trügerischen, lyrischen Zauber geben. Meist sind die Räume von machtvoller Leere und beträchtlicher Innenhöhe, manchmal geben Jalousien oder Bögen einen Rahmen mit menschlichem Maß. Der zweite Teil spielt auf und vor einem hohen, von Plastikfolien knisternden Müllberg, dem Müllhaufen der Geschichte, auf dem Lear sich und einige Mit-Leidende finden. Auf dem nach und nach alle landen, die eben noch zu handeln glaubten: Kein Land für junge Männer, aber auch nicht für machtversessene oder gar für einfühlsame Frauen. Eher Abbild als Interpretation Reimanns Oper fordert von ihren Protagonistinnen und Protagonisten weniger Differenzierungsvermögen als vielmehr volle Breitseiten stimmlicher Souveränität in schwierigstem Gelände. Einzig Britta Stallmeister kann ihre erhebliche lyrische Kompetenz in der Partie der Cordelia einsetzen. Jeanne-Michèle Charbonnet (Goneril) und Caroline Whisnant (Regan) entwickeln jeweils raumfüllende Präsenz und machen die Kraft, mit der sie alle ins Verderben treiben, glaubhaft. Frank van Aken als Edmund gestaltet die Rohheit dieser Figur als Ergebnis ihrer Selbstzweifel. Martin Wölfel als Edgar zeigt eindrucksvolle Materialbeherrschung im Tenor- wie im Countertenor-Fach. Johannes Martin Kränzles feinsinnig timbrierter Gloster ist ein klares Gegenbild zu Wolfgang Koch als alles beherrschender, auch in Wahnsinn und Verzweiflung vehementer Lear mit einer bis zum endgültigen Zusammenbruch unbeugsamen Kraftentfaltung. Leider haben nicht alle Teile dieser insgesamt bemerkenswerten Inszenierung das gleiche Niveau. Der Zugang, den Keith Warners Regie zum Stoff sucht, ist eher einer der Abbildung als der Interpretation. Damit greift er des öfteren zu kurz und manchmal geradezu einfallslos in alte Illustrations-Mottenkisten. Es gibt viel zu viel dämonisches Abgangs-Stakkato-Lachen und zu viel hilfloses Stolpern mit aufgerissenem Mund und szenische Arrangements und Ideen, die mehr als einen Hauch von peinlichem Sechziger-Jahre-Pathos ausdünsten, und ein Schlusstableau, in dem eine gewisse Tapsigkeit die große Tragik unfreiwillig konterkariert. Die Personenführung lässt also noch Wünsche offen und ist nicht immer auf der interpretatorischen Höhe der Musik. So ist der Frankfurter "Lear" ein Erfolg vor allem für Sebastian Weigle, der für sein Debüt als GMD viel gewagt und alles gewonnen hat. Wovon man sich bald auch anderweitig wird überzeugen können: Aus der Frankfurter Produktion wird eine CD entstehen, die im Frühjahr erscheint. Oper Frankfurt: 2., 5., 9., 12., 19., 25. Oktober. [ document info ] |
|
Weigle startet in Frankfurt mit Reimanns "Lear" Von Uwe Wittstock Bei Shakespeare hat der Machtmissbrauch noch Menschenmaß. Ob König Lear seine jüngste Tochter verstößt, oder ob ihm die zwei älteren übel mitspielen, immer bleibt der Verrat in der Königsfamilie. Als Aribert Reimann vor dreißig Jahren seine Oper "Lear" komponierte, hatten die politischen Großverbrechen des 20. Jahrhunderts längst andere Maßstäbe der Gewalt gesetzt. In seiner Musik versuchte er dem gerecht zu werden und davon muss jede Aufführung zumindest eine Ahnung vermitteln. Keith Warners großartige Inszenierung an Frankfurts Oper schlägt sich angesichts dieser enormen Herausforderung beeindruckend gut. Dass der im Lauten (oft) wie im Leisen (seltener) souveräne Sebastian Weigle sich ausgerechnet mit einer so anspruchsvollen Arbeit dem Publikum als Generalmusikdirektor präsentiert, ist nicht ohne Risiken. Doch der aufbrandende Applaus, mit dem gerade er bedacht wurde, zeigt, dass er von den Frankfurtern erwartungsvoll empfangen wird. Bei Warner beginnt und endet alles im beengten Palast. Die selbstverliebte Verblendung, mit der Lear sein Land unter seine Töchter verteilt, bringt den Machtkampf in Gang und raubt dem Reich jede Ordnung. Shakespeare veranschaulicht das in der archetypische Szene, in der Lear durch eine sturmdurchtoste Heide-Einöde torkelt. Warner lässt den Opern-Lear stattdessen über eine von Unwettern gepeitschte Müllhalde irren. Der dem Wahnsinn nahe Lear wird hier zu Mad Max, der durch die Reste einer zerstörten Zivilisation stapft. Aber auch für die politischen Morde und die flüchtigen Liebesmomente in der zweiten Hälfte findet Warner überzeugend starke Bilder. Er lässt ein schmales Band aus Sprühregen über den Kriegszügen niedergehen, nutzt die seidige Wasserwand als Leinwand, auf die er Hoffnungsszenen der Zärtlichkeit projiziert. Schon bei der Münchner Uraufführung des "Lear" unterstrich Dietrich Fischer-Dieskau, wie schutzlos ein Sänger in dieser Oper "dem keineswegs stützenden Orchester gegenübertritt". Gesang und Musik scheinen hier wie auseinander gebrochen, zerrissen wie Lears Welt. Alle Auftretenden sind stimmlich wie schauspielerisch eindrucksvoll. Vor allem Wolfgang Koch als Lear meistert mit machtvollem Bariton die mörderische Partie. Daneben stechen Frank van Aken als Edmund, Martin Wölfel als Edgar und Jeanne-Michèle Charbonnet, Caroline Whisnant und Britta Stallmeister als die drei Töchter hervor. Reimanns "Lear" wurde seit der Münchner Uraufführung 1978 zwanzig Mal nachgespielt. Niemand wird behaupten wollen, dass er damit schon zum Repertoire gehörte. Aber beinahe. |
|
Ab auf den Müllhaufen Von Heinz Zietsch DARMSTADT. Aribert Reimanns Oper „Lear" gehört seit der erfolgreichen Münchner Uraufführung von 1978 zu den wichtigsten Werken des zeitgenössischen Musiktheaters und ist immer für einen Neuanfang abseits der gewohnten Pfade gut. Am vergangenen Sonntag war die Premiere des epochalen Stückes, die erste Neuproduktion der Saison und zugleich der Einstand für den neuen Generalmusikdirektor Sebastian Weigle an der Oper Frankfurt. Und er löste die Aufgabe glänzend; er und der Sänger der Titelgestalt, Wolfgang Koch, erhielten nach der mit Pause drei Stunden dauernden Aufführung den meisten, mit vielen Bravos durchsetzten Beifall. Bei aller Härte des Stoffs, dem die Musik Reimanns mit gigantisch aufgetürmten Akkordballungen entspricht, die wie Klangwände auffahren und den Hörer bedrängen und einengen: Weigle entdeckt die lyrischen, ja melodischen Seiten in diesem Werk, die darin aufgebaut werden, woraus sich erst allmählich anwachsend eine geballte dissonanten Ladung ergibt. Bezeichnend ist dafür auch der klagende Schluss, mit dem das Stück geradezu lyrisch ausklingt, um wieder dorthin zurückzukehren, wo es begonnen hat. Keith Warner macht aus dem Stück ein Kammerspiel, das den Untergang von Lears Familie zeigt. Denn Reimanns Librettist Claus H. Henneberg, der sich auf Shakespeares „König Lear" stützt, stellt Lears Schicksal und dessen Verkennung der Realitäten in den Mittelpunkt. Das Herrschaftliche, wobei es um Macht, Intrige, Triebe und Verrat geht, ist eher sekundär. Die Menschen nehmen nur jene Realität wahr, die ihnen angenehm erscheint, die sich nicht querstellt und Widerpart wird. Nur einen Ausschnitt, gleichsam wie durch eine Jalousie, die im Bühnenbild von Boris Kudlička ganz realistisch sichtbar wird, macht sich Lear zu eigen und scheitert daran kläglich. Am Ende erstarrt er zur Pietŕ, die tote Tochter Cordelia auf den Knien wiegend. So wie hier Historisches zitiert wird, so sind die Kostüme von Kaspar Glarner stilisiert in ihrer Mischung aus zeitloser Moderne und historisierenden Renaissance-Gewändern. Lear will nicht und kann nicht sehen. Im Grunde ist er wohl ein demenzkranker alter Mann, der wahnsinnig wird – so zeichnet ihn Regisseur Keith Warner. Wer zu nichts mehr nutze ist in dieser von Hartz IV geprägten Gesellschaft, der wird abgeschoben auf eine riesige Müllhalde. Das ergeht dem Narren nicht anders als dem verrückten Tom, der in Wirklichkeit Glosters Sohn Edgar ist, der sich nur verstellt und seinen Vater aus dem Elend führt. Was bleibt, ist absurdes Theater in einer absurden Gesellschaft auf einem im Grunde vorwiegend engen Raum. Da war die symbolische Darmstädter Inszenierung von 1991 unter dem Regisseur Gerd Heinz und dem damaligen Generalmusikdirektor Hans Drewanz, der sich den „Lear" gewünscht hatte, zu Beginn der Ära des Intendanten Peter Girth noch großräumiger angelegt: Die Menschen befinden sich auf der Straße des Lebens. In Frankfurt indes läuft alles auf eine Enge hinaus, die die Menschen einschnürt, der sie letztlich nicht mehr entrinnen können. Dennoch sind die Stimmen alles andere als eng. Obwohl man die Sänger recht gut versteht, läuft die deutsche Übertitelung mit. Man bekommt als Zuschauer schließlich so mehr Feinheiten mit. Daran sollte sich auch andere Häuser, etwa Darmstadt, ein Beispiel nehmen. Zudem ist es ziemlich anmaßend zu behaupten, die Sänger würden sich bei mitlaufendem deutschen Text mit der Aussprache weniger anstrengen. In Frankfurt sorgten jedenfalls alle für expressiven und intensiven Gesang, allen voran Wolfgang Koch in der Titelpartie, der außerdem den Ton noch in einem wunderbar klar konturierten Piano zurückzunehmen verstand. Auch die drei Lear-Töchter leisteten Beachtliches, Jeanne-Michèle Charbonnet als Goneril, Caroline Whisnant als Regan und Britta Stallmeister als Cordelia. Nicht zu vergessen Graham Clark als Narr, der mit seinen weitsichtigen Bemerkungen stets den Nagel auf den Kopf traf. Überhaupt hatte es der Regisseur verstanden, jede Figur treffend zu charakterisieren. Rundum also ein famoser Start – nicht nur für den Dirigenten. |
|
Die Welt ist aus den Fugen Mit der Frankfurter Erstaufführung von Aribert Reimanns Oper "Lear" gab Sebastian Weigle einen triumphalen Einstand. Von Michael Dellith Es klang schon fast wie eine Warnung an das Publikum: Reimanns "Lear" offenbare in einer avancierten, äußerst dramatischen und bohrenden musikalischen Sprache eine vollends aus den Fugen geratene Welt, wird Sebastian Weigle über sein erstes Premierenstück an der Frankfurter Oper als neuer Generalmusikdirektor im Programmheft zitiert. Und in der Tat, Reimanns vor 30 Jahren uraufgeführte Musik ist eine, die es nicht jedem Opernfreund leicht macht, sie zu lieben. Sie lässt in aller Drastik die Brutalität des tragischen Shakespeare-Stoffes, den Hass, den Schmerz und die Gewalt ihrer Protagonisten spüren. Schneidende Bläserakzente, dicht geballte Akkorde, dynamisch anschwellende Schichtungen von Ton-Clustern, dazu exotisch anmutendes Schlagwerk, auch Viertelton-Klänge scheinen den Raum sprengen zu wollen. Die Musik sucht – bei nur wenigen lyrischen Momenten – fast unablässig die Exaltation. Doch sie nimmt den Hörer, der sich darauf einlässt, mit in einen Sog, dem man sich nicht mehr entziehen kann. Vor allem dann nicht, wenn sie so kongenial interpretiert wird wie von Sebastian Weigle und dem Museumsorchester. Weigle spornte das Orchester zu größter Expressivität und Spannkraft an, ließ so eine starke Musik erleben, die ihre Entsprechung in einer nicht minder starken Bildsprache auf der Bühne fand. Regisseur Keith Warner, der in Frankfurt schon einige zeitgenössische Werke wie etwa die Dallapiccola-Einakter zwingend auf die Bühne brachte, ist auch diesmal eine in ihrem Reichtum fast überbordende Inszenierung geglückt, wobei Bühnenbild (Boris Kudlicka) und Kostüme (Kaspar Glarner) mit ihren Zitaten quer durch alle Epochen und Stile (vom Barock-Sessel bis zum Plastikschwingstuhl) die Zeitlosigkeit des Stoffes sichtbar machen. Warner inszeniert streng am Text und an der Musik entlang und macht dabei manchmal fast ein wenig zu viel des Guten – nicht jede Regung in der Musik braucht zur Verdeutlichung eine Bewegung auf der Bühne! Insgesamt aber schafft er eine nicht nur in sich schlüssige, sondern auch ebenso faszinierende wie tiefgründige Bilderwelt – ob mit den durchlässigen Jalousie-Wänden am Anfang und Ende, mit dem apokalyptisch anmutenden vulkanartigen Müllberg in der so genannten "Heide-Szene" oder mit dem variablen Regenvorhang, der auch noch zur Projektionsfläche von Video-Einspielungen wird. Im Mittelpunkt freilich stehen die fabelhaften Sänger, allen voran Wolfgang Koch in der Titelpartie. Wie facettenreich er stimmlich und schauspielerisch den Schmerz, die Einsamkeit und den Wahn des alternden König Lear mit aller gebotenen Intensität verkörperte, ohne seinen kultivierten Bariton je zu forcieren, verdient höchste Anerkennung. Bei den Sängerinnen ließ vor allem Britta Stallmeister aufhorchen: engelsgleich und lupenrein ihre Höhe in den Passagen der aufrichtig liebenden Tochter Cordelia. Die machthungrigen Schwestern-Rivalinnen Goneril und Regan waren mit den vibratostärkeren Kolleginnen Jeanne-Michèle Charbonnet und Caroline Whisnant kontrastierend dazu besetzt. Mit ihrer famosen Präsenz nahmen auch Frank van Aken in der Partie des Edmund und der Countertenor Martin Wölfel als Edgar ein, adäquat ergänzt durch Ensemblemitglieder wie Dietrich Volle (Albany) oder Johannes Martin Kränzle (Gloster). Für komische Momente sorgte Graham Clark als Narr, dessen jahrzehntelange Erfahrung als Bayreuther Mime und Loge nicht zu leugnen ist. Klangfein und sensibel setzte schließlich Frankfurts neuer Chordirektor Matthias Köhler die Herren des Opernchores in Szene. Am Ende gab’s für diesen mutigen Abend Beifallstürme, vor allem für Wolfgang Koch und Sebastian Weigle – und für einen überglücklichen Aribert Reimann. © 2008 Frankfurter Neue Presse |
|
Blutiges Familiendrama im Regen
FRANKFURT Sebastian Weigle, der neue Frankfurter Generalmusikdirektor, hätte es sich wahrlich leichter machen können mit seinem Saison-Auftakt. Nachdem er vor zwei Wochen schon ein starkes konzertantes Zeichen gesetzt hatte, indem er Brahms ("Ein deutsches Requiem") mit Wolfgang Rihm ("Das Lesen der Schrift") verzahnte, folgte nun eines der gewichtigsten Musiktheater-Werke des 20. Jahrhunderts, Aribert Reimanns Shakespeare-Oper "Lear". 1978 wurde "Lear" uraufgeführt - und hat sich wie wenige zeitgenössische Opern auf den Bühnen behauptet. Ins Frankfurter Profil der Intendanz Bernd Loebes passt Reimanns Opus schon deshalb bestens, weil über dem florierenden Opernhaus das Motto schwebt: "Hier gilt´s dem Gesang". Und in der Tat: So kakophonisch sich im Orchestergraben die Cluster ballen können, so wild das Schlagwerk dem Publikum das grausame Schicksal des englischen Königs einbläut, so kunstvoll die Streicher am komplexen Klangteppich weben: In der Kunst der Kantilene und der vokalen Charakterisierung von Shakespeares Figuren bleibt Reimann bei allem Extremismus der Tradition verpflichtet. Cordelia etwa, Lears treue Tochter, darf sich mit glühender Emphase ins Herz des Publikums singen, und Britta Stallmeister bestätigt mit dieser Partie ihren Rang als außerordentliche Sängerdarstellerin. Die charakterlichen Defizite der bösen Schwestern Goneril (Jeanne-Michèle Charbonnet) und Regan dagegen (Caroline Whisnant) unterstreicht Reimann mit den Mitteln seiner musikalischen Rhetorik: In üppiger Melismatik wird das Ornament zum Vorschein der Verbrechen. Für diese haben Regisseur Keith Warner und Boris Kudlicka (Bühne) düstere, suggestive Bilder gefunden. Höchste Intensität erreicht die Tristesse nicht im Müllkippen-Realismus, sondern auf der leeren Bühne des zweiten Teils, wenn die traurigen Figuren auch noch einen Dauerregen über sich ergehen lassen müssen. Kaspar Glarners Kostüme unterstreichen - von der historischen Halskrausen-Reminiszenz bis zum modernen Leder-Outfit - den überzeitlichen Charakter dieses Dramas. Die Mörder sind also unter uns, und als Ober-Bösewicht waltet Graf Glosters Sohn Edmund seines intriganten Amtes. Frank van Aken lässt im tenoralen Aplomb die Brutalität dieses Charakters spüren. Grandios auch der Countertenor Martin Wölfel als Edgar und Johannes Martin Kränzles Gloster. Im Zentrum steht die traurige Vaterfigur Lear. Anfangs präsentiert er sich mit Degen und Schärpe als eine Art Operetten-König, der bald aus dem Schein seiner Herrschaft in das harte Sein auf der Müllkippe fallen wird. Der Bariton Wolfgang Koch vollzieht die Wandlungen des alten Mannes mit beeindruckender Intensität nach. Ovationen für den GMD Der König steht seinem Schicksal in der Unterwäsche schutzlos gegenüber und wird mit seiner toten Tochter Cordelia auf den Knien am Ende zu einer Pietà arrangiert, zu einem Schmerzensmann, dem höchstens aus dem Orchestergraben ein wenig Trost zuwächst. Jedenfalls hört das der Komponist selbst so: "Er sieht etwas", sagt Reimann im Einführungsgespräch mit Bernd Loebe über den leidenden Lear und seine tote Tochter, "und dieses Sehen musste ich hörbar machen (...), dieses Aufsteigen in eine andere Welt". Weigle stemmt diesen schweren Opern-Brocken mit bewundernswerter Umsicht, hart im perkussiven Dauerfeuer und doch sensibel in der klanglichen und dynamischen Differenzierung. Die Ovationen, die ihm das Publikum bereitet, zeigen, dass ein so ambitionierter Auftakt sehr wohl honoriert wird. In zwei Jahren kann Weigle seine Reimann-Kompetenz dann mit einem ganz neuen Werk ausbauen. Die Medea-Oper, an der der Komponist zur Zeit arbeitet, wird nach der Wiener Uraufführung im Herbst 2010 in Frankfurt ihre deutsche Erstaufführung erleben. |
|
Kein Kuss für Vater [...] Das Museumsorchester brachte die Qualitäten der spieltechnisch anspruchsvollen Partitur [...] sehr suggestiv mit nicht nachlassender Intensität und Energie zum Klingen: die facettenreiche Klanglichkeit, die effektvollen Kontraste zwischen dem gelegentlich leicht monochromen Bruitismus der Akkordballungen und den flirrenden, leisen Klangzuständen, das berückende Bassflötensolo, das den Auftritt des von seinem Vater Gloster und dem „Bastard" Edmund flüchtenden Edgar. Letztlich dominieren in diesem Werk bei aller Präsenz des Orchesters jedoch die vokalen Mittel. Nicht umsonst war es der Bariton Dietrich Fischer-Dieskau, dem Reimann die Anregung zur Komposition und einen guten Anteil am Uraufführungserfolg verdankt. Wolfgang Koch setzte in Frankfurt seine geballte baritonale Energie daran, den Lear nicht als jenen feinsinnig Leidenden auf die Bühne zu stellen, dem Fischer-Dieskau in der Uraufführungsinszenierung all seine lyrische Versenkungskunst schenkte, sondern ihn stattdessen alberichgleich als Gewaltmenschen wüten zu lassen. [...] Die Partie des Narren – in dem man bei Shakespeare Lears geheime Identität entdecken kann, während Reimann und Henneberg die Rolle reduzierten – erfährt durch Graham Clarks fulminante Darstellung eine enorme Aufwertung. Die blutrünstigen Schwestern, Monsterpartien alle beide, sind charakteristisch gegeneinander abgesetzt: Jeanne-Michèle Charbonnet gab mit großem, dramatischen Sopran die Goneril, während Caroline Whisnant die hysterischen Koloraturen der Regan mit leichtgängiger, giftig gurrender Stimme absolvierte. Britta Stallmeister schenkte der Cordelia hingebungsvollen lyrischen Sopranklang, Martin Wölfel den orientalisierenden Vokalisen und Melismen des Edgars wunderbar changierendes Countertenortimbre. Das Frankfurter Premierenpublikum bedankte sich mit viel Applaus für den höchst eindrucksvollen Saisonauftakt. JULIA SPINOLA |
|
Das Böse in uns Von Christoph Schmitz Kafkas "Schloss", Euripides Troerinnen-Drama, "Bernarda Albas Haus" von Lorca - Der Komponist Aribert Reimann hat sich immer für die großen Vorlagen interessiert, die großen Konflikte, die großen Tragödien, und sie in Musik umgesetzt. "Archetypische Stoffe faszinieren mich", so hat Reimann es bei der Premiere seines "Lear" in Frankfurt ausgedrückt. König Lear ist alt und müde und will die Verantwortung der Macht auf jüngere Schultern verteilen. Seine drei Töchter sollen über das Land herrschen. Die ihn am meisten liebt, bekommt am meisten. Mit seinem Eingeständnis der Altersschwäche setzt Lear das Räderwerk von Gier, Machtgelüsten und Intrigen in Gang. Am Ende haben sich fast alle gegenseitig gemeuchelt. Wolfgang Koch als Lear singt und spielt die Schwäche, die Wut, den Wahnsinn und die Vereinsamung bis in jede Verästelung des Gefühls. Stimmlich und mimisch ist er bewundernswert wandlungsfähig, auch noch am Schluss im leisen sphärischen Abgesang nach einer mörderischen Partie. Aber auch die Sängerinnen von Lears Töchter, Goneril, Regan und Cordelia, meistern in der Frankfurter Inszenierung ihre höchst anspruchsvollen Rollen mit großer Sicherheit und Ausstrahlung. Gonerils geheuchelte Liebe zum Vater schmiedet Jeanne-Michèle Charbonnet in glühende kantige Formen, die gleich am Anfang alle Bosheit offenbaren. Dich Vater, liebe ich mehr als meiner Augen Licht und Freiheit. Das Furienhafte der bösen Töchter liefert auch Caroline Whisnant in der Rolle Regans, Lears zweiter Tochter. In den höllisch zerklüfteten Tonfolgen, den gespreizten Koloraturen und den hysterischen Melismen legt sie den Schrecken des von unbedingter Machtgier zerfressenen Menschen frei. Hätte ich für dich nicht Leib und Seele geopfert? Wer sich dieser Kultur des Todes widersetzt ist Lears dritte Tochter Cordelia. Sie will dem öffentlichen Ritual eines Lippenbekenntnisses zur Vaterliebe nicht folgen. Den leuchtenden Höhen von Cordelias Stimme verleiht Britta Stallmeister alle Festigkeit und ätherische Aura des Mitfühlens. Bis zur Umarmung des wahnsinnigen Vaters gegen Ende. Jetzt sollst du Frieden finden. Sehr genau arbeiten Sänger und Orchester unter dem neuen Frankfurter Generalmusikdirektor Sebastian Weigle die musikalischen und charakterlichen Verwandtschaften zwischen einzelnen Figuren heraus, wie die zwölftönigen Reihen von Cordelia und dem Sohn des Grafen von Gloster, Edgar. Der gute Mensch Edgar wird schlank gesungen vom Countertenor Martin Wölfel - rein, lieblich, verletzlich und entschieden stark, wenn es um den Kampf gegen die Machenschaften des Bösen geht. Die Machenschaften des Bösen in der Musik lässt der Dirigent Sebastian Weigle auf atemberaubende Weise aufbrechen. Ekstatisch und kontrolliert zugleich führt er die Klangmassen, die Cluster, die flageolettierten Flächen, die herumirrenden Solostimmen der Instrumente. Aribert Reimanns Komposition über die selbstzerstörerischen Urkräfte des Menschen hat der britische Regisseur Keith Warner bebildert. Die altgewordene Welt des Herrschers Lear hat er in Kostüme des 19. Jahrhundert gepackt. In einem beengten tapezierten Raum hockt der Adel zusammen und starrt blind für sich und die Welt durch Jalousien ins Publikum. Die Jugend schreibt sich die Post aber schon per E-Mail. Die Einöde, durch die die Verbannten und Wahnsinnigen irren, ist eine gewaltige Müllhalde. Man ist versucht, die Zeichen als politische Aktualisierung zu lesen, kommt damit aber nicht so recht weiter, weil Warner und sein Bühnenbildner Boris Kudlicka den letzten konkreten Zugriff verweigern, was auch gut ist. Ein paar Versuche Warners, aus dem Stück eine schwarze Komödie zu machen, scheitern. Am besten wird die Inszenierung, wo sie auf Bilder verzichtet und wie im zweiten Teil nur eine Regenwand auf schwarzer Bühne hinabrieseln und die Akteure unter Regenschirm und Baldachin herumziehen lässt. Dann versteht man am besten, dass Machtgier keine Zeit und keinen Ort hat, sondern überall und immer da ist. |
|
Lear und der Müll
Das düstere Drama begann als Kammerspiel - in einem kleinen Renaissance-Raum für die Eingangs(Schlüssel-)Szene, in der Lear sein Reich unter den Töchtern Regan, Goneril und Cordelia aufteilen will und die unaufhaltsame Tragödie lostritt: ?Nach den auf einem Rezitationston gesprochenen Sätzen und dem ersten Akkord, auf den Lears mit einem einzigen Wort - 'Schlaf' - antwortet, sind die Figuren gefangen in einem Gitter, aus dem sie bis zum Ende nicht mehr herauskommen, sagte Reimann in einem Podiumsgespräch vor der Aufführung. Und genau das bekommt man in Frankfurt auch zu sehen. Denn am Ende findet im selben Raum, der durch drei Jalousien verschlossen oder geöffnet werden kann, der Mord an Regan und Edmund und der Suizid von Goneril statt, bevor zum bitteren Ende Lear wieder auf seinem alten Thron sitzt - der nun nichts mehr bedeutet - und seine tote Tochter Cordelia beweint, die er ob ihrer vermeintlichen Gefühlskälte einst verstoßen hat. Im Verlauf des Stücks weitet sich der Raum zum Aufriss einer düsteren Fabrikhalle oder schieben sich zwei Müllberge voller Platiktüten und alter Kleider herein - Sinnbild des Sturms auf der Heide, der in der Natur und im Kopf Lears wütet und schließlich seinen Geist zerrüttet (Bühnenbild: Boris Kudlicka). Nach der Pause allerdings ist die Bühne weitgehend leer und schwarz, ereignet sich die große Simultanszene der Oper unter einem fein stäubenden Regenvorhang, der sich dreht, verkleinert oder vergrößert und beleuchtet wird mit den grünen Schlieren eines geheimnisvoll schillernden Nordlichts, während sich die Figuren wie in Trance bewegen. Hier und in der ungeheuer anrührenden anschließenden Szene des wahnsinnigen Lear und Cordelia hat die Inszenierung Keith Warners denn auch ihre magischsten Momente. Wolfgang Koch, der bei den letzten Münchner Festspielen als Busonis Doktor Faust brillierte, verkörpert als Lear alle Facetten des altersstarrsinnigen Königs, der erniedrigt, gequält und schließlich zum Sinnbild menschlichen Leids und Leidens wird. Er singt und gestaltet mit ausdrucksstarkem Bariton intensiv bis zur Schmerzgrenze, spielt gar den Wahnsinn mutig realistisch an der Grenze zum Nicht-mehr-Darstellbaren. Neben ihm muss als erster Martin Wölfel genannt werden, der eine kaum zu übertreffende Darstellung des Edgar bietet. Von seinem Halbbruder Edmund (hier kein Monster, sondern eher ein Amok laufender Verlierer mit heldentenoraler Attacke: Frank van Aken) denunziert und von Gloster, seinem Vater, verstoßen, begleitet er diesen, nachdem man diesem die Augen ausgestoßen hat, mit verstellter (Countertenor-)Stimme und bewahrt ihn vor dem Suizid. Außerordentlich präzise, ausdrucksvoll und schön in der hohen Lage singend, setzt Wölfel auch seinen hohen Bariton und eine dunkle Sprechstimme perfekt im Dienst der Rolle ein. Johannes Martin Kränzle vermag als Gloster den aberwitzigen Mut eines Gefangenen, der vor seiner Folterung steht, mit differenzierter Bariton-Gewalt zu gestalten - trotz eigentlich lyrisch gefärbter Stimme. Graham Clarke ist ein geradezu troll-artig absurder Narr, der am Ende des erten Teils unter nervösen Zuckungen sein Leben aushaucht. Gegen diese auch in den Nebenrollen exzellent besetzte Männer-Riege fallen die Damen etwas ab. Jeanne-Michèle Charbonnet (Goneril) und Caroline Whisnant (Regan) sind mit ihren hochdramatischen Stimmen etwas eindimensional Verkörperungen des Bösen, wie Britta Stallmeister zwar schön, aber mit allzu nazarenischer Süße die sanfte Cordelia singt. Sebastian Weigle gab als neuer GMD der Frankfurter Oper mit dem Museumsorchster einen bemerkenswerten Einstand. Denn er ließ zwar anfangs bei den wüsten Blechbläser-Clustern oder manch anderen komponierten Reibungen und dem nervösen, vielstimmigen Flirren der Streicher und im Schlagwerk dieser komplexen Partitur die nötige Schärfe und Differenzierung vermissen, aber wie er subtilste Klangfarben im zweiten Teil mit seinem Orchester zauberte, am Ende die große Kantilene der Streicher beim Dialog des wahnsinnigen Lear und seiner einst verstoßenen jüngsten Tochter Cordelia - die melodische Ausformung ihrer von kleinen Sekunden geprägten Zwölfton-Reihe ? expressiv modellierte und dann Lears verzweifelt herausgeschriene Trauer über die erwürgte Tochter in ein komponiertes weißes Rauschen als Symbol des Todes überführte, war von bestürzender Intensität. Klaus Kalchschmid Oehms Classics hat die Aufführung mitgeschnitten und veröffentlicht die Doppel-CD im März 2009. |
|
www. Opernnetz.de20. September 2008 Alle sind Einsame in diesem Dröhnen"
Neue Opern oder Werke für das Musiktheater, die es aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ins sogenannte Standardrepertoire geschafft haben, kann man an zwei Händen abzählen. Aribert Reimanns Lear gehört (aus deutscher Perspektive jedenfalls) zweifellos dazu. Seit der Uraufführung in München 1978 ist er einigermaßen regelmäßig in den Spielplänen vertreten. Jetzt in Frankfurt ist es ein kleiner Geburtstag: Zum 30-jährigen gibt es die 20. Neuinszenierung! Und für das Geburtstagsfest hat man in Frankfurt mit großem Engagement und Enthusiasmus alle Kräfte des Hauses gebündelt, ein Sängerensemble der Extraklasse zusammengestellt und ihnen eine ausgedehnte Probenzeit ermöglicht. Für Sebastian Weigle, der an der Frankfurter Oper schon mehrfach dirigierte und der diese Saison als Generalmusikdirektor die Nachfolge von Carignani antritt, ist es ein extrem vielversprechender und hoffentlich auch ein programmatischer Einstand. Der erste Eindruck: Das Stück ist frisch wie am ersten Tag, kein 'Altern der Neuen Musik' ist hier feststellbar. Musik und Inszenierung mit einer anhaltenden, hochgespannten Sogwirkung nehmen das Publikum von Anfang an gefangen. Das Glück der Besetzung zeigt sich schon vor dem Beginn. Graham Clark ist der 'Narr' dieser Produktion. Wer Clark einmal als Mime als begnadeten Schauspieler gesehen und gehört hat, weiss sogleich, was für ein gelungener Coup die Besetzung dieser (Sprech-) Rolle mit ihm ist. Als Anfang vor dem Anfang bastelt er aus Spielkarten ein Kartenhaus, das kurz darauf in sich zusammenfällt. Der Narr im Lear ist jemand, der alles weiß, aber nie beachtet wird und so nimmt er es gleich vorweg: Lears Plan misslingt. Clark verkörpert den Narren auch gestisch als Fremdkörper, der er als Schauspieler unter Sängern ja konzeptuell auch ist, er ist beweglicher, schneller, agiler. Als er am Ende des ersten Teils nicht mehr benötigt wird, weil Lear selbst zum Narren wird, aber zu einem, der nichts erkennt und in den Wahn abgleitet, zieht sich der Narr eine Plastiktüte über den Kopf und tritt ab. Lear in der Person von Wolfgang Koch ist der Kern der Aufführung. Er beherrscht die Rolle schauspielerisch und gesanglich ganz hervorragend, vom Flüstern bis zum großen Ausbruch hat er sich den Lear ganz anverwandelt. Es ist ein Weg vom eitlen, selbstverliebten Herrscher zum Wahnsinnigen, doch seine Entmachtung und die damit verbundene Identitätskrise, das Hilfloswerden im Alter wie im Wahn ist auch ein Zu-sich-selbst-kommen. Erschütternd dann die große Trauer nach dem Tod der Cordelia und der Zusammenbruch. Hochrangig auch die drei Töchter: Die furienartig agierenden, so machtbewusst wie kampfbereiten Töchter Goneril und Regan - Jeanne-Michèle Charbonnet und Caroline Whisnant. Britta Stallmeister als sich verweigernde Cordelia, als Lichtgestalt weißgewandet, entspricht ganz der Sicht Reimanns: „lyrisch, immer abgerundet, ausgewogen". Martin Wölfel überwältigt mit der Stimmakrobatik des Edgar: Tenor als Sohn Glosters und Counter-Tenor als sich wahnsinnig stellender Tom. Frank van Aken als sein Bruder, der 'Bastard' Edmund, ist von ganz anderem Holz: der Makel der falschen Geburt löst bei ihm eine skrupellose Karrierewut aus, der er gewissenlos brutal nachgibt. Die weiteren Rollen: König von Frankreich: Magnus Baldvinsson; Herzog von Albany: Dietrich Volle; Herzog von Cornwall: Michael McCown; Graf von Kent: Hans-Jürgen Lazar und als Graf von Gloster: Johannes Martin Kränzle. Die Textverständlichkeit war fast immer ausgezeichnet gegeben. Die Frankfurter Oper hatte die Aufführung trotzdem als Verständnishilfe mit Übertiteln versehen. Das Riesenorchester ist bei Lear extrem gefordert. Das Frankfurter Museumsorchester stellt sich dem Werk mit Bravour und Eindringlichkeit und bleibt dem Werk nichts schuldig: Die charakteristischen Streicher-Klangflächen, die bedrohlichen Ballungen und Eruptionen in Blech und Schlagwerk. Weigle wählt eine klare, transparente Sichtweise, sorgfältig gestaltet sind die dynamischen Abstufungen und Intensitätsgrade, vom Kammermusikalischen bis in die Forte-Extreme, gerät dabei aber nicht ins Hässliche. Der britische Regisseur Keith Warner, Bühnenbildner Boris Kudlička und der Kostümbildner Kaspar Glarner legen den Lear überzeitlich an: Die Kostüme zitieren einen Zeithorizont vom späten Mittelalter bis heute, Goneril benutzt mit Laptop ganz heutiges Equipment. Edmund hat ein Outfit wie ein Guerillakrieger und die Armeen könnten auch aktuellen Kampfhandlungen entsprungen sein. Die Inszenierung des erbarmungslosen Ablaufs vereint eine wirkungsvolle, schlüssige Personenführung mit starken Bildern. Komprimierte Räumlichkeiten wechseln mit hohen Hallen, diese mit fast requisitenlosen Freiflächen. Einzelne Szenen werden zu lang in Erinnerung bleibenden Menetekeln und Theaterbildern. Stark etwa die 'Heide'-Szene: Von Natur keine Spur. Die Heide ist verdreckt und zu einer riesigen bühnenhohen Müllhalde mit zeitgenössischen Abfällen denaturiert. Das Ganze ist minutiös und mit viel Liebe zum Detail, zugleich aber auch funktional – es gibt Verstecke, Unterschlüpfe, Leitern und Seile zum Fortbewegen – organisiert. Der Narr, ganz praktisch veranlagt, organisiert noch einigen Sperrmüll, um wohnlich einen Unterstand einzurichten. Im Gegensatz zu Shakespeare ist die Natur nicht mehr feindlich. Es gibt keine Natur mehr. Nicht nur die menschlichen Verhältnisse sind beziehungslos egoistisch erkaltet, auch die Beziehung zur Natur ist an einem ausweglosen Ende angekommen, das auch die Lebensbedingungen an ein Ende führt. Lears Beschwörung: „Vernichte die Natur, ersticke den Schöpfungskeim" ist schon längst realisiert. Auch die schwierigen Simultanszenen des Lear im zweiten Teil sind so ästhetisch wie praktisch grandios gelöst. Die Bühne leer und dunkel, in der Mitte eine rotierende Regenwand, die zugleich als Screen für die dezenten Videoprojektionen (Thomas Wollenberger, Evita Galanou) dient. Bei dem Wetter ist schlechte Sicht nur folgerichtig und Simultaneität eine praktische Konsequenz.Ob die Inszenierung eine eigene 'These' vertritt, ist schwer zu entscheiden, auch, wieviel Spielraum die düstere Partitur mit dem gnadenlosen Ablauf dafür überhaupt lässt. Das Menschen- und Weltbild ist negativ. Alle Werte und Zusammenhänge sind nihiliert: Familie, Freundschaft, Liebe. Macht dient nur dem Machtmissbrauch, zur Durchsetzung egoistischer Ziele. Ansätze von Moral oder Ethik sind nicht erkennbar und am Ende herrscht nur Tod und Vernichtung. Das Werk endet mir einer Klage- oder Trauermusik, auch musikalisch ist es ohne jeglichen Hoffnungsschimmer. „Der Horror geht immer weiter." sagt Warner. Trotzdem, oder um die Geschichte etwas erträglicher zu machen, baut Warner einige ironische Wendungen ein, etwa ein paar Amüsierdamen im Gefolge des Lear, die schönen Fundstücke auf der Müllhalde, Graham Clark vermag da sogar noch eine Vase und Blümchen aufzutreiben: Irgendwie muss man es ja aushalten. Wichtig ist Warner die Jalousiemetapher, die er zweimal in die Inszenierung einfügt. In der ersten wie in der letzten Szene, Familientableaus im engeren Sinne, sehen wir die Handlung diskret hinter einer nur partiell durchblickbaren Jalousie. Man sieht nicht alles, nur Ausschnitte, es gibt nur eine Perspektive und die ist immer begrenzt. Das Publikum feierte Dirigat, Orchester, Regie und Ensemble mit langen Ovationen. Auch Aribert Reimann erschien sichtlich bewegt auf der Bühne. Ein Ausblick: Diese Eröffnungspremiere der Spielzeit 2008/09 wurde von dem Label Oehms Classics mitgeschnitten und soll im kommenden Frühjahr als CD auf den Markt kommen. Eine Wiederaufnahme der Inszenierung in einer der nächsten Spielzeiten ist schon in Aussicht gestellt. Aktuell arbeitet Reimann an einer 'Medea'-Oper als Koproduktion der Wiener Staatsoper und der Oper Frankfurt. Die Deutsche Erstaufführung ist für September 2010 angesetzt, die Uraufführung in Wien im März 2010. Dirk Ufermann
nnnnn Musiknnnnn Gesang nnnnnRegie nnnnn Bühne nnnnnPublikum nnnnnChat-Faktor |
|
Frankfurt am Main OpernhausAribert Reimann LEAR Sebastian Weigles Einstand als Generalmusikdirektor mit Aribert Reimanns fast dreißig Jahre altem Werk Lear ist klug und richtig gewählt. Der junge deutsche Dirigent wird herzlich und zu Recht für seine überzeugende, souveräne und engagierte Leistung und Leitung gefeiert. Das Museumsorchester klingt frisch, aufmerksam und spielfreudig, und gebiert die teils unerhört lauten akustischen Gebilde lust- und gehaltvoll. Reimanns Oper wirkt immer noch brisant, aktuell, denn sie unterstützt emotional die unvergleichlich große Vorlage Shakespeares. Oft aggressiv und hart, seltener zärtlich und fragil klagt die Partitur an, zeigt das immense Grauen des Stoffes um den machtlos gewordenen uralten König auf. Für diese Klangwelten starke Bilder zu finden, war die Aufgabe des englischen Regisseurs Keith Warner. Sehr eindringlich gelingt es ihm, Spannungsbögen zu ziehen und durchaus drastisch, Mord und Totschlag unbarmherzig in Szene zu setzen. Boris Kudlickas Bühnenbilder sind große, sehr unterschiedliche Räume, Kaspar Glarner setzt opulente Kostüme ein. Alles ist gekonnt, perfekt dargeboten. Regen, Blitz und Wind kommen uns tatsächlich nahe. Gut und Böse werden von Beginn an klar schwarzweiß gegeneinander gestellt, und damit leider beraubt man sich einiger Geheimnisse und Entwicklungsmöglichkeiten. Auch zeigt sich ein Lear in der Mitte seiner Zeit, kraftstrotzend im Leben und nicht willens, seiner Ämter müde zu sein. Die große Ballade des Siechens und der inneren Einsicht sind nicht Anliegen dieser Inszenierung. Hier geht es um dramatische Bilder und „Action" im besten Sinne. Lyrische, sensible Töne nimmt man dadurch als Höhepunkte war, wie die eindringliche Selbstmordszene Glosters (mit Edgar) oder das Duett Cordelia- Lear. Diesem Lear gibt Wolfgang Koch wuchtig großartige Gestalt: Ein wirklicher Heldenbariton bar jeder Ermüdung, auch zu leisen Tönen fähig, darstellerisch hingebungsvoll und immer im klingenden Fokus. Wie oben erwähnt steht ihm grandiose vokale Kraft zur Verfügung, sodass der Figur Lear das Gebrochene und sich Selbstaufgebende abgeht. Ein Sänger in der Blüte, nicht im Herbst seiner Karriere, dem man diese Rolle eigentlich später wünschen möchte. Seine dritte, ihn wahr liebende Tochter Cordelia singt Britta Stallmeister mit viel Wärme und Fähigkeit, lange Gesangslinien leuchtend aufblühen zu lassen. Demgegenüber wirken die hier fast karikaturhaft- bösen Schwestern recht eindimensional. Carolin Whisnant kann mit ihrem dramatischen Koloraturpart weit besser umgehen als die dauerforcierende, unverständlich artikulierende und unschön tremolierende Jeanne-Michele Charbonnet als Goneril, die in der sehr starken Frankfurter Sängerriege der einzige Schwachpunkt ist. Die hervorragende Herrenriege kann sich durchwegs hören und sehen lassen. Die englische Tenor-Ikone Graham Clark zeigt Shakespeares Narren als grellen, aufdringlichen Spaßmacher, Hans- Jürgen Lazars Charaktertenor ist der treue und zuverlässige Graf Kent.Die parallele Handlung um Gloster und seine beiden Söhne gewinnt sängerisch und darstellerisch mit Johannes Martin Kränzle als baritonal einnehmenden, durch Blendung einsichtigem Vater und Frank Van Aken als heldisch übermütigem Edmund sowie Martin Wölfel als zerbrechlichem, zwischen den Stimmwelten (Counter- und Tenor) sich bewegendem Edgar emotional sehr an Bedeutung und Aussagekraft. Dietrich Volles aufrichtiger Albany, Magnus Baldvinssons integerer König von Frankreich, Michael McCowns fieser Cornwall, und der gut disponierte Herrenchor runden eine vorbildliche Ensembleleistung ab, zu der die Oper Frankfurt mühelos fähig ist. Begeisternde Ovationen für alle Mitwirkenden runden einen großen Abend gebührend ab. Damian Kern PS: völlig unnötig wirkt allerdings ein Plakat: WIR SIND DIE NUMMER 1, dass die Oper Frankfurt über die anderen deutschen Operhäuser erheben will. Betreibt man mit Kalkül Etikettenschwindel und gibt die Quelle nur sehr klein an (Zeitschrift: Die deutsche Bühne)? Ob diese Art der Werbung den Kritikern der landesweit weit repräsentativeren Opernwelt-Umfrage gefallen wird? Frankfurts Oper präsentiert sich mit dieser Produktion selbstredend als eines der führenden Opernhäuser und hat Selbstlob gar nicht nötig. |
|
Lear
Intellektuelle Aufbaunahrung für Liebhaber zeitgenössischer Opern. Christian Rupp |
|
C'ERA UNA VOLTA UN RE Il "Lear" di Aribert Reimann apre con successo la stagione dell'Oper Frankfurt.
Stefano Nardelli |

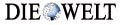







 Dreißig Jahre hat es gedauert, bis auch Frankfurt den im Münchner Nationaltheater mit Dietrich Fischer-Dieskau in der Titelrolle uraufgeführten "Lear" auf die Bühne brachte. Es war die bereits 20. Inszenierung der seit 1978 in ganz Europa zu erlebenden, großartigen Shakespeare-Vertonung Aribert Reimanns, die als eine der ganz wenigen Opern der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts einen Weg ins Repertoire fand. Am Ende wurde die zunehmend fesselnde Aufführung und ihr anwesender Komponist mit großem Applaus bedacht.
Dreißig Jahre hat es gedauert, bis auch Frankfurt den im Münchner Nationaltheater mit Dietrich Fischer-Dieskau in der Titelrolle uraufgeführten "Lear" auf die Bühne brachte. Es war die bereits 20. Inszenierung der seit 1978 in ganz Europa zu erlebenden, großartigen Shakespeare-Vertonung Aribert Reimanns, die als eine der ganz wenigen Opern der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts einen Weg ins Repertoire fand. Am Ende wurde die zunehmend fesselnde Aufführung und ihr anwesender Komponist mit großem Applaus bedacht.





 Sie zählt zu den am meisten gespielten zeitgenössischen Opern, doch noch nie war sie in Frankfurt zu sehen: "Lear" von Aribert Reimann. Wegen unseres vorgezogenen Redaktionsschlusses haben wir uns in die Hauptprobe gesetzt. Regisseur Keith Warner hat sich des Stücks aus dem Jahr 1978 angenommen - und herausgekommen ist eine der emotionalsten und zugleich tiefgründigsten Lesarten, die die Oper Frankfurt seit Langem präsentiert hat. Warner hat hier bereits unter anderem Rossinis "Aschenbrödel" oder Brittens "Death in Venice" realisiert. Doch so scharfsinnig seine Interpretationen auch in der Vergangenheit stets waren, diesmal ist ihm ein richtig großer Wurf gelungen. Er verdichtet den Shakespeare'schen Stoff auf geradezu beängstigend- packende Art auf die inneren Befindlichkeiten der Protagonisten und arbeitet Polaritäten heraus: Gut gegen Böse, Alt gegen Jung, Mann gegen Frau, Modern gegen Alt. Diese Positionen übersetzt er in bezwingende Bilder, überträgt sie in ein sorgsam gesponnenes Geflecht intensiver Symbole. Den bösen Schwestern ist die Sphäre der Dunkelheit, des Schwarzen vorbehalten, während Cordelia, die Gute, in reinem Weiß daherkommt. Das Gefolge von Goneril und Regan trägt schwarze Schlachterschürzen. Lediglich der Narr wird zu einer Art allwissendem Erzähler puppenspielerhaften Zuschnitts. So entwirft Warner Welten und Pa rallelwelten, spannt Räume auf und setzt diese in Beziehung zueinander. Dabei setzen er und sein Bühnenbildner Boris Kudlicka auf massig Nebel-, Licht und Windeffekte, generieren Stimmungen der Beklemmung und der Fatalität - wenn sich etwa der König als verrückter, alter Mann, als abgerissener Penner auf einer endzeitlichen Mülldeponie inmitten eines Berges von Altkleidern und Unrat wiederfindet. Packendstes Bild ist dabei ein Vorhang aus feinem Nieselregen, auf den Warner kommentierende Symbole projizieren lässt. Das ist Regiearbeit im ureigensten Sinne. Zugleich extrahiert er aber auch aus der Handlung eine Art Zahlenmystik. Allgegenwärtig ist bei ihm dabei das Triptychon als Metapher. Zugegeben, kein leichter Tobak; doch Genuss war gestern - heute gibt es endlich wieder was zum Nachdenken. So muss Oper sein.
Sie zählt zu den am meisten gespielten zeitgenössischen Opern, doch noch nie war sie in Frankfurt zu sehen: "Lear" von Aribert Reimann. Wegen unseres vorgezogenen Redaktionsschlusses haben wir uns in die Hauptprobe gesetzt. Regisseur Keith Warner hat sich des Stücks aus dem Jahr 1978 angenommen - und herausgekommen ist eine der emotionalsten und zugleich tiefgründigsten Lesarten, die die Oper Frankfurt seit Langem präsentiert hat. Warner hat hier bereits unter anderem Rossinis "Aschenbrödel" oder Brittens "Death in Venice" realisiert. Doch so scharfsinnig seine Interpretationen auch in der Vergangenheit stets waren, diesmal ist ihm ein richtig großer Wurf gelungen. Er verdichtet den Shakespeare'schen Stoff auf geradezu beängstigend- packende Art auf die inneren Befindlichkeiten der Protagonisten und arbeitet Polaritäten heraus: Gut gegen Böse, Alt gegen Jung, Mann gegen Frau, Modern gegen Alt. Diese Positionen übersetzt er in bezwingende Bilder, überträgt sie in ein sorgsam gesponnenes Geflecht intensiver Symbole. Den bösen Schwestern ist die Sphäre der Dunkelheit, des Schwarzen vorbehalten, während Cordelia, die Gute, in reinem Weiß daherkommt. Das Gefolge von Goneril und Regan trägt schwarze Schlachterschürzen. Lediglich der Narr wird zu einer Art allwissendem Erzähler puppenspielerhaften Zuschnitts. So entwirft Warner Welten und Pa rallelwelten, spannt Räume auf und setzt diese in Beziehung zueinander. Dabei setzen er und sein Bühnenbildner Boris Kudlicka auf massig Nebel-, Licht und Windeffekte, generieren Stimmungen der Beklemmung und der Fatalität - wenn sich etwa der König als verrückter, alter Mann, als abgerissener Penner auf einer endzeitlichen Mülldeponie inmitten eines Berges von Altkleidern und Unrat wiederfindet. Packendstes Bild ist dabei ein Vorhang aus feinem Nieselregen, auf den Warner kommentierende Symbole projizieren lässt. Das ist Regiearbeit im ureigensten Sinne. Zugleich extrahiert er aber auch aus der Handlung eine Art Zahlenmystik. Allgegenwärtig ist bei ihm dabei das Triptychon als Metapher. Zugegeben, kein leichter Tobak; doch Genuss war gestern - heute gibt es endlich wieder was zum Nachdenken. So muss Oper sein.
 Ha trent'anni il "Lear" di Aribert Reimann e; nonostante qualche piccola ruga del tempo, regge bene la prova del palcoscenico. Buona parte del merito va dato all'immortale soggetto shakesperiano, che l'abile adattamento di Henneberg asciuga e amplifica nella sua portata tragica. Malgrado qualche omaggio al gusto del tempo, la partitura di Reimann aderisce con convinzione alla materia drammatica e usa con duttilità una tavolozza sonora complessa ed elaborata che, linguaggio musicale a parte, è sostanzialmente rispettosa di moduli melodrammatici tradizionali. Una tradizione cui si rifà anche la regia di Keith Warner: nessuna stravaganza sulla scena ma un racconto lineare e solidamente ancorato al soggetto. Come in una favola, i segni sono chiari ed inequivocabili - le malvagie Regan e Goneril e il loro seguito vestono abiti leather neri, mentre Lear e Cordelia e l'innocente Edgar vestono di bianco - le scene paradigmatiche nella loro essenzialità che molto deve alle luci. Non mancano i colpi di scena sapientemente dosati: la montagna di spazzatura in cui il reietto Lear ritrova i segni dismessi del potere, la pioggia che lava i corpi prima del sacrificio, la splendida scena fra Lear e Cordelia raccontata nella nudità totale della scena. Grande spettacolo, grande cast. Ammirevole per misura e senso del dramma il Lear di Wolfgang Koch ma è davvero difficile trovare delle smagliature nel lunghissimo cast, in cui anche punti deboli fanno gioco al teatro (la vocalità scabra della Charbonnet, la fragilità della Stallmeister, la precarietà di Wölfel). In buca Sebastian Weigle si fa ammirare soprattutto per la chiarezza nell'esposizione e per l'abilità con la quale regge le fila di una partitura non semplicissima, specie per l'equilibrio con la scena. Successo sincero per tutti.
Ha trent'anni il "Lear" di Aribert Reimann e; nonostante qualche piccola ruga del tempo, regge bene la prova del palcoscenico. Buona parte del merito va dato all'immortale soggetto shakesperiano, che l'abile adattamento di Henneberg asciuga e amplifica nella sua portata tragica. Malgrado qualche omaggio al gusto del tempo, la partitura di Reimann aderisce con convinzione alla materia drammatica e usa con duttilità una tavolozza sonora complessa ed elaborata che, linguaggio musicale a parte, è sostanzialmente rispettosa di moduli melodrammatici tradizionali. Una tradizione cui si rifà anche la regia di Keith Warner: nessuna stravaganza sulla scena ma un racconto lineare e solidamente ancorato al soggetto. Come in una favola, i segni sono chiari ed inequivocabili - le malvagie Regan e Goneril e il loro seguito vestono abiti leather neri, mentre Lear e Cordelia e l'innocente Edgar vestono di bianco - le scene paradigmatiche nella loro essenzialità che molto deve alle luci. Non mancano i colpi di scena sapientemente dosati: la montagna di spazzatura in cui il reietto Lear ritrova i segni dismessi del potere, la pioggia che lava i corpi prima del sacrificio, la splendida scena fra Lear e Cordelia raccontata nella nudità totale della scena. Grande spettacolo, grande cast. Ammirevole per misura e senso del dramma il Lear di Wolfgang Koch ma è davvero difficile trovare delle smagliature nel lunghissimo cast, in cui anche punti deboli fanno gioco al teatro (la vocalità scabra della Charbonnet, la fragilità della Stallmeister, la precarietà di Wölfel). In buca Sebastian Weigle si fa ammirare soprattutto per la chiarezza nell'esposizione e per l'abilità con la quale regge le fila di una partitura non semplicissima, specie per l'equilibrio con la scena. Successo sincero per tutti.